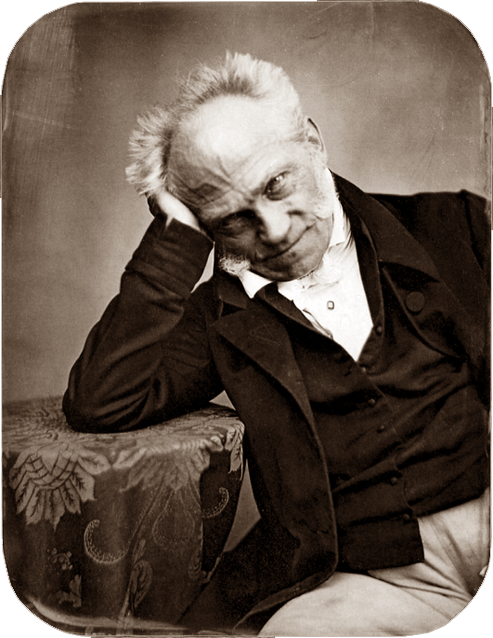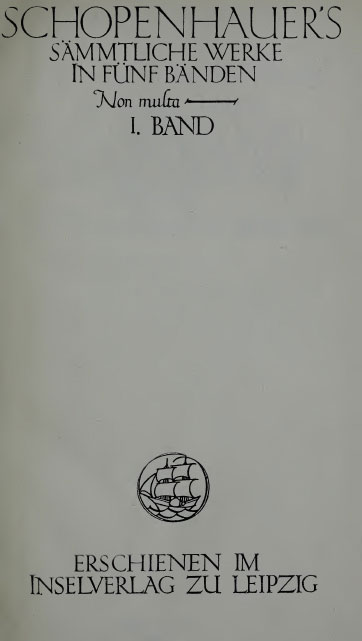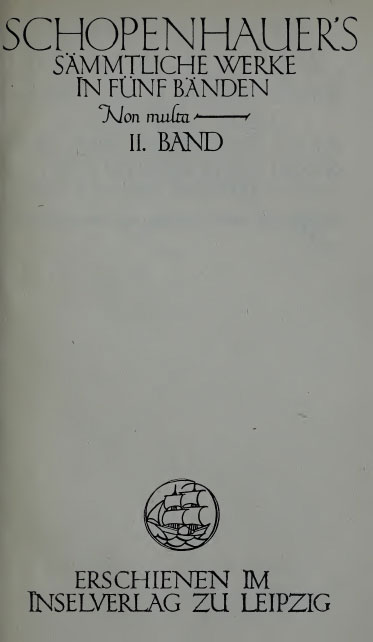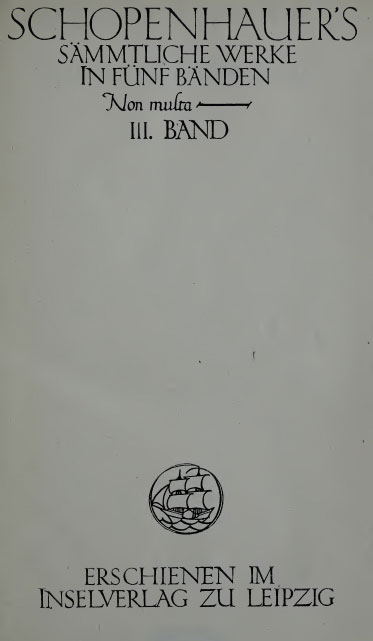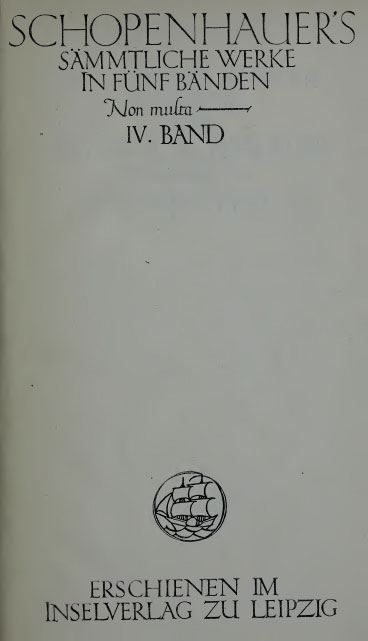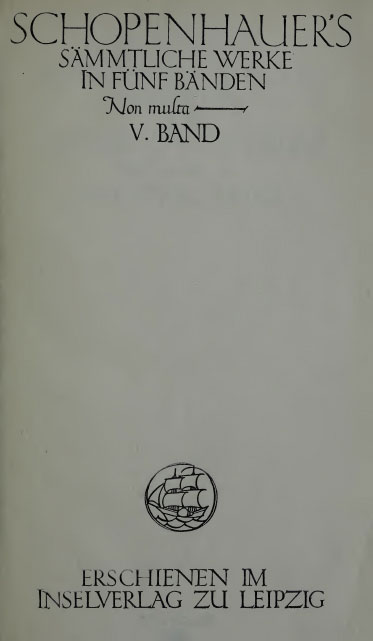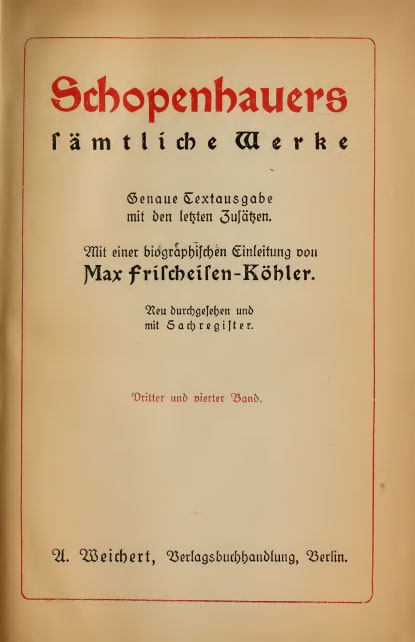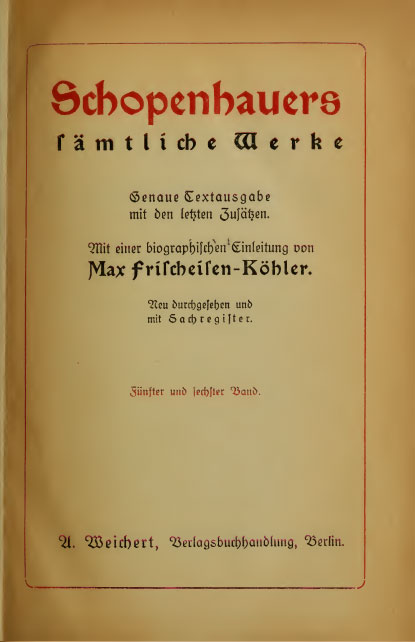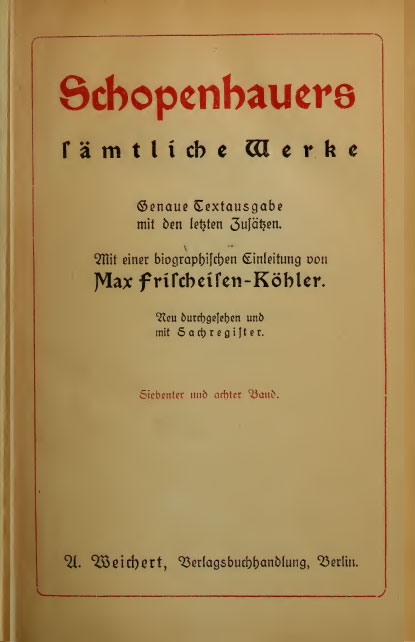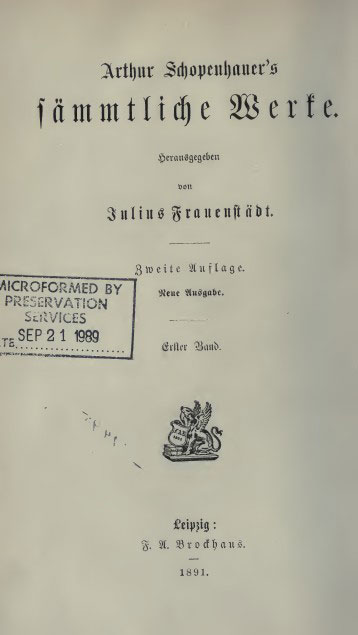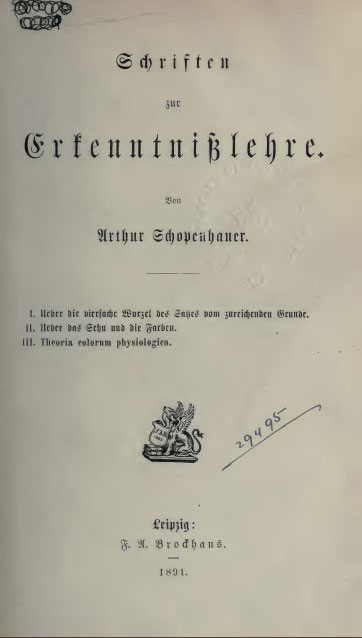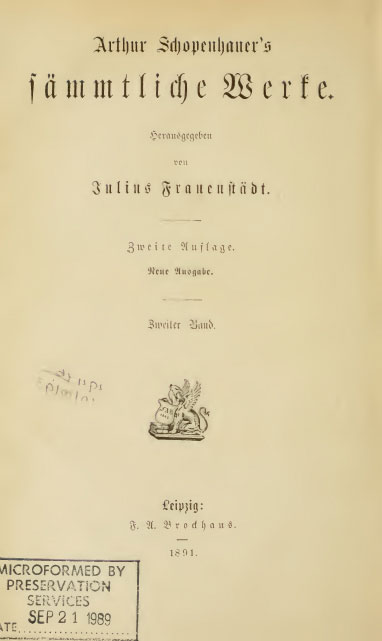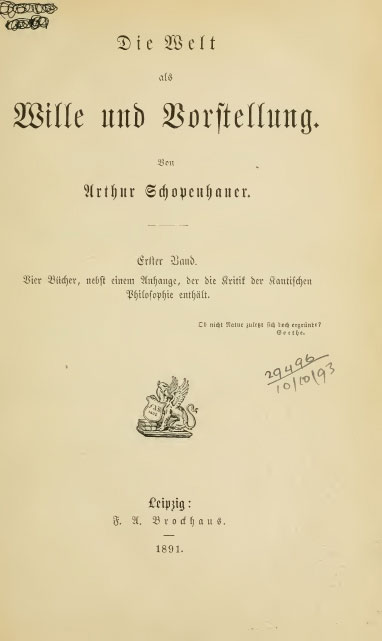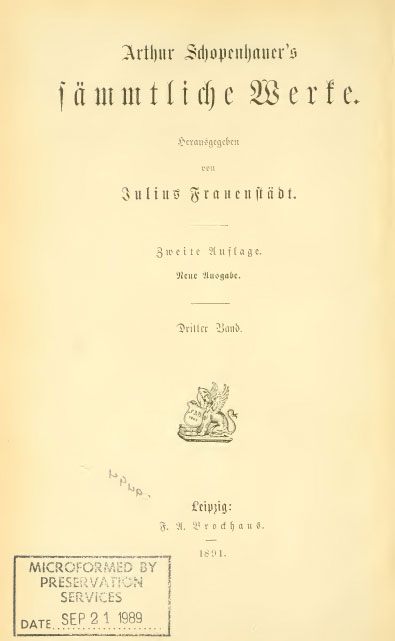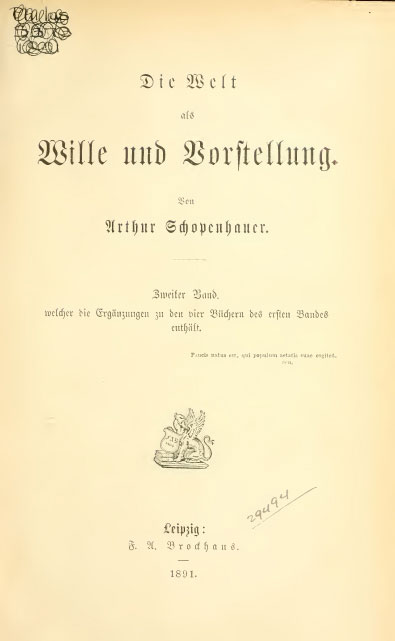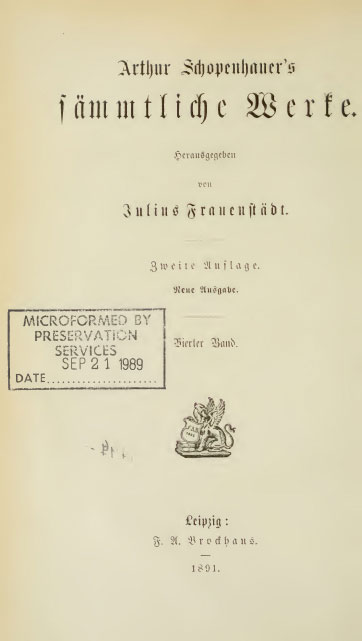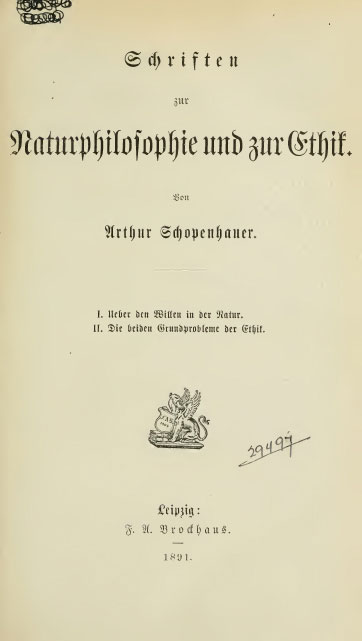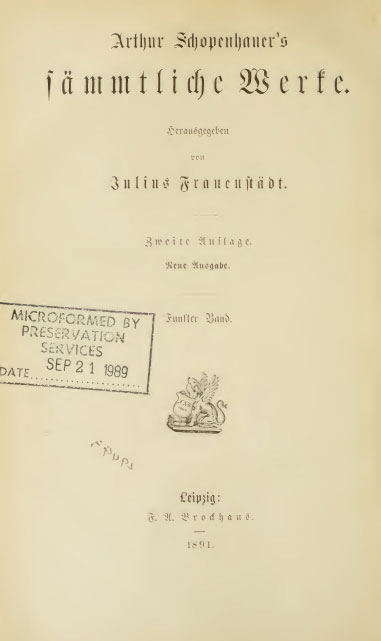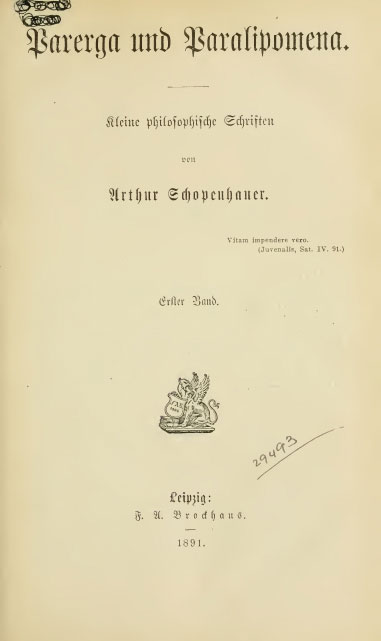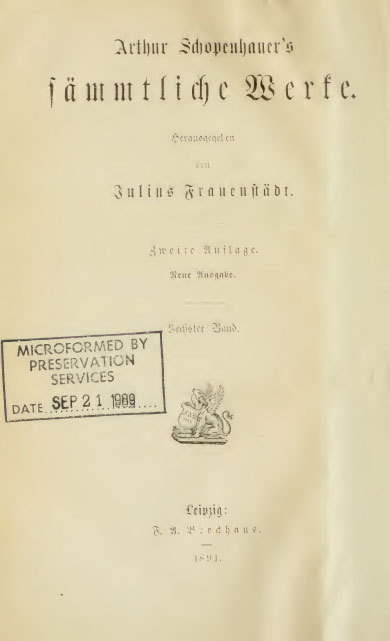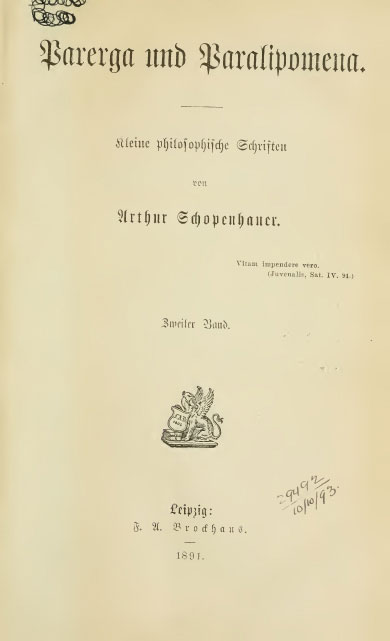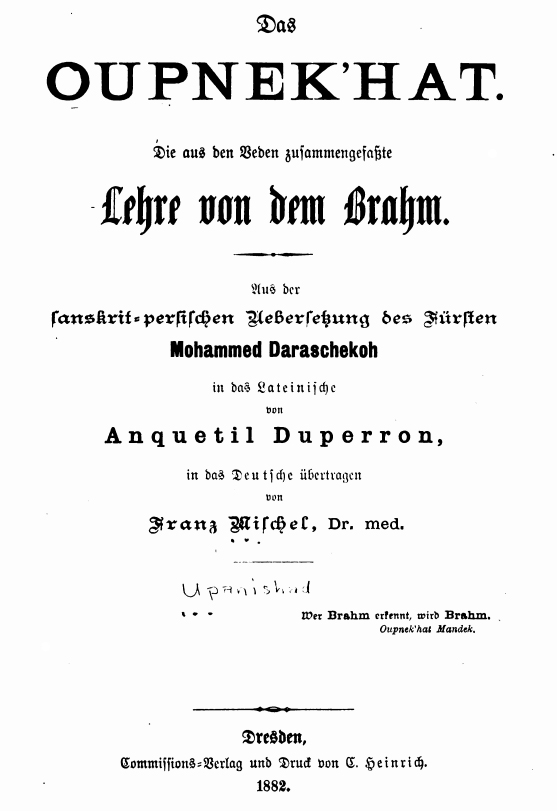| |
Den
Anblick einer schönen Landschaft so überaus erfreulich zu machen, trägt
unter anderm auch die durchgängige Wahrheit und Konsequenz der Natur
bei. Diese befolgt hier freilich nicht den logischen Leitfaden, im Zusammenhange
der Erkenntnisgründe, der Vordersätze und Nachsätze, Prämissen und
Konklusionen; aber doch den ihm analogen des Kausalitätsgesetzes, im
sichtlichen Zusammenhange der Ursachen und Wirkungen. Jede Modifikation,
auch die leiseste, welche ein Gegenstand durch seine Stellung, Verkürzung,
Verdeckung, Entfernung, Beleuchtung, Linear- und Luftperspektive u. s.
w. erhält, wird durch seine Wirkung auf das Auge unfehlbar angegeben
und genau in Rechnung gebracht; das indische Sprichwort: „Jedes Reiskörnchen
wirft seinen Schatten“ findet hier Bewährung. Daher zeigt sich hier
alles so durchgängig folgerecht, genau regelrecht, zusammenhängend und
skrupulos richtig: hier gibt es keine Winkelzüge. Wenn wir nun den Anblick
einer schönen Aussicht bloß als Gehirnphänomen in Betracht nehmen;
so ist er das einzige stets ganz regelrechte, tadellose und vollkommene,
unter den komplizierten Gehirnphänomenen; da alle übrigen, zumal unsere
eigenen Gedankenoperationen, im Formalen oder Materialen, mit Mängeln
oder Unrichtigkeiten, mehr oder weniger, behaftet sind. Aus diesem Vorzug
des Anblicks der schönen Natur ist zunächst das Harmonische und durchaus
Befriedigende seines Eindrucks zu erklären, dann aber auch die günstige
Wirkung, welche derselbe auf unser gesamtes Denken hat, als welches dadurch,
in seinem formalen Teil, richtiger gestimmt und gewissermaßen geläutert
wird, indem jenes allein ganz tadellose Gehirnphänomen das Gehirn überhaupt
in eine völlig normale Aktion versetzt und nun das Denken im Konsequenten,
Zusammenhangenden, Regelrechten und Harmonischen aller seiner Prozesse,
jene Methode der Natur zu befolgen sucht, nachdem es durch sie in den
rechten Schwung gebracht worden. Eine schöne Aussicht ist daher ein Kathartikon
des Geistes, wie die Musik, nach Aristoteles, des Gemütes, und in ihrer
Gegenwart wird man am richtigsten denken. –
Daß der sich plötzlich vor uns aufthuende Anblick der Gebirge uns so
leicht in eine ernste, auch wohl erhabene Stimmung versetzt, mag zum Teil
darauf beruhen, daß die Form der Berge und der daraus entstehende Umriß
des Gebirges die einzige stets bleibende Linie der Landschaft ist, da
die Berge allein dem Verfall trotzen, der alles übrige schnell hinwegrafft,
zumal unsere eigene, ephemere Person. Nicht, daß beim Anblick des Gebirgs
alles dieses in unser deutliches Bewußtsein träte, sondern ein dunkles
Gefühl davon wird der Grundbaß unserer Stimmung. –
Ich möchte wissen, warum, während für die menschliche Gestalt und Antlitz
die Beleuchtung von oben durchaus die vorteilhafteste und die von unten
die ungünstigste ist, hinsichtlich der landschaftlichen Natur gerade
das Umgekehrte gilt. –
Wie ästhetisch ist doch die Natur! Jedes ganz unangebaute und verwilderte,
d. h. ihr selber frei überlassene Fleckchen, sei es auch klein, wenn
nur die Tatze des Menschen davon bleibt, dekoriert sie alsbald auf die
geschmackvollste Weise, bekleidet es mit Pflanzen, Blumen und Gesträuchen,
deren ungezwungenes Wesen, natürliche Grazie und anmutige Gruppierung
davon zeugt, daß sie nicht unter der Zuchtrute des großen Egoisten aufgewachsen
sind, sondern hier die Natur frei gewaltet hat. Jedes vernachlässigte
Plätzchen wird alsbald schön. Hierauf beruht das Prinzip der englischen
Gärten, welches ist, die Kunst möglichst zu verbergen, damit es aussehe,
als habe hier die Natur frei gewaltet. Denn nur dann ist sie vollkommen
schön, d. h. zeigt in größter Deutlichkeit die Objektivation des noch
erkenntnislosen Willens zum Leben, der sich hier in größter Naivetät
entfaltet, weil die Gestalten nicht, wie in der Tierwelt, bestimmt sind
durch außerhalb liegende Zwecke, sondern allein unmittelbar durch Boden,
Klima und ein geheimnisvolles Drittes, vermöge dessen so viele Pflanzen,
die ursprünglich demselben Boden und Klima entsprossen sind, doch so
verschiedene Gestalten und Charaktere zeigen.
Der mächtige Unterschied zwischen den englischen, richtiger chinesischen
Gärten und den jetzt immer seltener werdenden, jedoch noch in einigen
Prachtexemplaren vorhandenen, altfranzösischen, beruht im letzten Grunde
darauf, daß jene im objektiven, diese im subjektiven Sinne angelegt sind.
In jenen nämlich wird der Wille der Natur, wie er sich in Baum, Staude,
Berg und Gewässer objektiviert, zu möglichst reinem Ausdruck dieser
seiner Ideen, also seines eigenen Wesens, gebracht. In den französischen
Gärten hingegen spiegelt sich nur der Wille des Besitzers, welcher die
Natur unterjocht hat, so daß sie, statt ihrer Ideen, die ihm entsprechenden,
ihr aufgezwungenen Formen, als Abzeichen ihrer Sklaverei, trägt: geschorene
Hecken, in allerhand Gestalten geschnittene Bäume, gerade Alleen, Bogengänge
u. s. w.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] — In fast allen Menschen hat die Vernunft eine beinahe ausschließlich
praktische Richtung: wird nun aber auch diese verlassen, verliert das
Denken die Herrschaft über das Handeln, wo es dann heißt: scio meliora
proboque, deteriora sequor, oder „le matin je fais des projets, et le
soir je fais des sottises“, läßt also der Mensch sein Handeln nicht
durch sein Denken geleitet werden, sondern durch den Eindruck der Gegenwart,
fast nach Weise des Tieres, so nennt man ihn unvernünftig (ohne dadurch
ihm moralische Schlechtigkeit vorzuwerfen), obwohl es ihm eigentlich nicht
an Vernunft, sondern an Anwendung derselben auf sein Handeln fehlt, und
man gewissermaßen sagen könnte, seine Vernunft sei lediglich theoretisch,
aber nicht praktisch. Er kann dabei ein recht guter Mensch sein, wie mancher,
der keinen Unglücklichen sehen kann, ohne ihm zu helfen, selbst mit Aufopferungen,
hingegen seine Schulden unbezahlt läßt. Der Ausübung großer Verbrechen
ist ein solcher unvernünftiger Charakter gar nicht fähig, weil die dabei
immer nötige Planmäßigkeit, Verstellung und Selbstbeherrschung ihm
unmöglich ist. Zu einem sehr hohen Grade von Tugend wird er es jedoch
auch schwerlich bringen: denn, wenn er auch von Natur noch so sehr zum
Guten geneigt ist; so können doch die einzelnen lasterhaften und boshaften
Aufwallungen, denen jeder Mensch unterworfen ist, nicht ausbleiben und
müssen, wo nicht Vernunft sich praktisch erzeigend, ihnen unveränderliche
Maximen und feste Vorsätze entgegenhält, zu Thaten werden.
Als praktisch zeigt sich endlich die Vernunft ganz eigentlich in den recht
vernünftigen Charakteren, die man deswegen im gemeinen Leben praktische
Philosophen nennt, und die sich auszeichnen durch einen ungemeinen Gleichmut
bei unangenehmen, wie bei erfreulichen Vorfällen, gleichmäßige Stimmung
und festes Beharren bei gefaßten Entschlüssen. In der That ist es das
Vorwalten der Vernunft in ihnen, d. h. das mehr abstrakte, als intuitive
Erkennen und daher das Ueberschauen des Lebens, mittelst der Begriffe,
im allgemeinen, ganzen und großen, welches sie ein für allemal bekannt
gemacht hat mit der Täuschung des momentanen Eindrucks, mit dem Unbestand
aller Dinge, der Kürze des Lebens, der Leerheit der Genüsse, dem Wechsel
des Glücks und den großen und kleinen Tücken des Zufalls. Nichts kommt
ihnen daher unerwartet, und was sie in abstracto wissen, überrascht sie
nicht und bringt sie nicht aus der Fassung, wann es nun in der Wirklichkeit
und im einzelnen ihnen entgegentritt, wie dieses der Fall ist bei den
nicht so vernünftigen Charakteren, auf welche die Gegenwart, das Anschauliche,
das Wirkliche solche Gewalt ausübt, daß die kalten, farblosen Begriffe
ganz in den Hintergrund des Bewußtseins treten und sie, Vorsätze und
Maximen vergessend, den Affekten und Leidenschaften jeder Art preisgegeben
sind. Ich habe bereits am Ende des ersten Buches auseinandergesetzt, daß,
meiner Ansicht nach, die Stoische Ethik ursprünglich nichts, als eine
Anweisung zu einem eigentlich vernünftigen Leben, in diesem Sinne, war.
Ein solches preiset auch Horatius wiederholentlich an sehr vielen Stellen.
Dahin gehört auch sein Nil admirari und dahin ebenfalls das delphische
Μηδεν αγαν. Nil admirari mit „Nichts bewundern“ zu übersetzen,
ist ganz falsch. Dieser Horazische Ausspruch geht nicht sowohl auf das
Theoretische, als auf das Praktische, und will eigentlich sagen: „Schätze
keinen Gegenstand unbedingt, vergaffe dich in nichts, glaube nicht, daß
der Besitz irgend einer Sache Glückseligkeit verleihen könne: jede unsägliche
Begierde auf einen Gegenstand ist nur eine neckende Chimäre, die man
ebensogut, aber viel leichter, durch verdeutlichte Erkenntnis, als durch
errungenen Besitz, los werden kann.“ In diesem Sinne gebraucht das admirari
auch Cicero, De divinatione, II, 2. Was Horaz meint, ist also die αϑαμβια
und ακαταπληξις, auch αϑαυμασια, welche schon Demokritos
als das höchste Gut pries (siehe Clem. Alex. Strom. II, 21, und vergl.
Strabo, I, S. 98 und 105). — Von Tugend und Laster ist bei solcher Vernünftigkeit
des Wandels eigentlich nicht die Rede, aber dieser praktische Gebrauch
der Vernunft macht das eigentliche Vorrecht, welches der Mensch vor dem
Tiere hat, geltend, und allein in dieser Rücksicht hat es einen Sinn
und ist zulässig von einer Würde des Menschen zu reden. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wenn wir annehmen (was sich ziemlich gewiß ergibt, sobald man die Evangelien
als in der Hauptsache ganz wahr ansieht), daß Jesus Christus ein Mensch
gewesen sei ganz frei von allem Bösen und von allen sündigen Neigungen
*); so muß (da mit dem Leibe sündige Neigungen eigentlich notwendig
gesetzt sind, ja der Leib nichts ist als die verkörperte, sichtbar gewordene
sündige Neigung) — Jesu Leib allerdings nur ein Scheinleib genannt
werden **). Einen solchen von allen sündigen Neigungen ganz freien Menschen,
einen solchen Träger eines Scheinleibs, sich als von einer Jungfrau geboren
zu denken, ist ein vortrefflicher Gedanke. Selbst physisch läßt sich
davon eine, wiewohl entfernte, Möglichkeit aufzeigen. Gewisse Tiere nämlich
(ich glaube einige Insekten) haben das Eigne, daß die Befruchtung der
Mutter auch auf das Junge und selbst auf dessen Junges nachwirkt, so daß
dieses Eier legt, ohne selbst befruchtet zu sein. Daß dieses ein einziges
Mal beim Menschen eingetreten sei, ist nicht so unwahrscheinlich zu denken,
als daß es einen wirklich sündenfreien Menschen gegeben habe, und sobald
wir letzteres annehmen, kann jenes, bei der, aller Vernunft unerreichbaren
Harmonie zwischen der Korporisation und dem intelligibeln Charakter jedes
lebenden Wesens und der Erblichkeit vieler Neigungen und Charakterzüge,
sehr wohl angenommen werden.
*) Paulus ad Romanos 8, 3: „Deus filium suum misit in similitudinem
carnis peccati.“ — Dies erläutert S. Augustinus, liber 83 quaestionum
quaestio 66: Non enim caro peccati erat, quae non de carnali delectatione
nata erat: sed tamen inerat ei similitudo carnis peccati, quia mortalis
caro erat.
**) „Alii Valentinum secuti historiam generationis Christi totam converterunt
in allegoriam; cui se opposuit ex orthodoxis Irenaeus. Post hunc Appelles
aliique Christum verum hominem esse negarunt, Phantasma sine corpore esse
affirmantes. Contra quos disputavit Tertullianus, eo praecipue argumento,
quod incorporum nihil est. — Arrii haeresis negavit Christum esse Deum.“
Hoppes,
Leviathan c. 46.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Was Theisten unterscheidet von Atheisten, Spinozisten, Fatalisten, ist,
daß jene ein willkürliches, diese ein natürliches Prinzip der Welt
setzen: jene sie aus einem Willen, diese aus einer Ursache entstehn lassen.
Eine Ursache wirkt mit Notwendigkeit, ein Wille mit Freiheit. Allein ein
Wille ohne Motiv ist so undenkbar, als eine Wirkung ohne Ursache. Soll
die Welt entstanden sein, so muß entweder, nach Art der Atheisten, eine
Ursach die erste gewesen sein: d. h. sie muß nichts vor sich gehabt haben,
dessen Wirkung sie war, das sie selbst zu wirken zwang, und woraus sie
sich erklären ließe: sie wirkt also mit absoluter Notwendigkeit, sie
wirkt durch absolutes (d. h. eben an keinem weitern Grund hängendes)
Müssen, und dies ist denn der eigentliche Fatalismus. Lassen hingegen
die Theisten einen Willen ohne Motiv wirken, so ist das Resultat etwas
ebenso Unsinniges, als der Fatalismus: nämlich ein Wollen ohne Grund,
wie dort ein Müssen ohne Grund.
Daß die meisten Menschen sich lieber bei einem Wollen ohne Grund befriedigen,
als bei einem Müssen ohne Grund, ist sonderbar genug. Es mag daher kommen,
daß jede Ursach an und für sich erforschlich ist, nicht aber jedes Motiv:
denn der Handelnde kann es verhehlen: so schieben sie denn heimlich ein
verborgnes Motiv unter.
Beide Parteien sind nur dadurch auflösbar, daß man zeigt, wie Wille
und Kausalität, Freiheit und Natur eins sind. Den Weg hiezu wird meine
neue Lehre zeigen, daß nämlich der Leib der Objekt gewordne Wille ist:
und dennoch der Wille an sich dem Gesetz der Motivation, als Leib aber
dem der Kausalität unterworfen ist. So wie ein Wille ist, ist aber ein
Leib, folglich so wie Motivation zugleich Kausalität.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Das starre Festhalten des großen Haufens an Vorurtheilen, Wahnbegriffen,
Sitten, Gebräuchen und Trachten, das langsame Eindringen erkannter Wahrheiten
in’s Volk beweist, daß in Hinsicht auf die Schnelligkeit der Fortpflanzung
dem physischen Lichte nichts unähnlicher ist, als das geistige.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Unmöglich könnte, wenn diese Welt von eigentlich denkenden Wesen bevölkert
wäre, der Lärm jeder Art so unbeschränkt erlaubt und freigegeben sein,
wie sogar der entsetzlichste und dabei zwecklose es ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Unser Lebenslauf ist keineswegs schlechthin unser eigenes Werk, sondern
das Product zweier Factoren, nämlich der Reihe der Begebenheiten und
der Reihe unserer Entschlüsse, welche stets in einander greifen und sich
gegenseitig modificiren. Von beiden sind uns wegen der Beschränktheit
unsers Horizonts eigentlich nur die gegenwärtigen recht bekannt. Deshalb
können wir, so lange unser Ziel noch fern liegt, nicht ein Mal gerade
darauf hinsteuern; sondern nur approximativ und nach Muthmaßungen unsere
Richtung dahin lenken, müssen also oft lawiren. Alles nämlich, was wir
vermögen, ist unsere Entschlüsse allezeit nach Maßgabe der gegenwärtigen
Umstände zu fassen, in der Hoffnung, es so zu treffen, daß es uns dem
Hauptziel näher bringe. So sind denn meistens die Begebenheiten und unsere
Grundabsichten zweien, nach verschiedenen Seiten ziehenden Kräften zu
vergleichen und die daraus entstehende Diagonale ist unser Lebenslauf.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Mensch edlerer Art glaubt in seiner Jugend, die wesentlichen und entscheidenden
Verhältnisse und daraus entstehenden Verbindungen zwischen Menschen seien
die ideellen, d. h. die auf Aehnlichkeit der Gesinnung, der Denkungsart,
des Geschmacks, der Geisteskräfte u. s. w. beruhenden; allein er wird
später inne, daß es die reellen sind, d. h. die, welche sich auf irgend
ein materielles Interesse stützen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Es giebt in der That wahrhaft ehrliche Leute, — wie es auch wirklich
vierblätterigen Klee giebt; aber Hamlet spricht ohne Hyperbel, wenn er
sagt: Nach dem Laufe dieser Welt heißt ehrlich sein ein aus Zehntausend
Auserwählter sein.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Luxus ist die entferntere Ursache jenes Uebels, welches entweder unter
dem Namen der Sclaverei, oder unter dem des Proletariats, jederzeit auf
der großen Mehrzahl des Menschengeschlechts gelastet hat. Damit nämlich
einige Wenige das Entbehrliche, Ueberflüssige und Raffinirte haben, ja,
erkünstelte Bedürfnisse befriedigen können, muß auf Dergleichen ein
großes Maß der vorhandenen Menschenkräfte verwendet und daher dem Nothwendigen,
der Hervorbringung des Unentbehrlichen, entzogen werden. So lange daher
auf der einen Seite der Luxus besteht, muß nothwendig auf der andern
übermäßige Arbeit und schlechtes Leben bestehen, sei es unter dem Namen
der Armuth oder dem der Sclaverei. Der ganze unnatürliche Zustand der
Gesellschaft, der allgemeine Kampf, um dem Elend zu entgehen, die so viel
Leben kostende Seefahrt, das verwickelte Handelsinteresse und endlich
die Kriege, zu welchen das Alles Anlaß giebt, — alles Dieses hat zur
alleinigen Wurzel den Luxus. Demnach würde zur Verminderung des menschlichen
Elends das Wirksamste die Verminderung, ja, Aufhebung des Luxus sein.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Geschlechtstrieb arbeitet stets (durch Vermehrung der Bevölkerung)
dem Hunger in die Hände, so wie dieser, wann er befriedigt ist, dem Geschlechtstrieb.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Ernährungsproceß ist ein stetes Zeugen, der Zeugungsproceß ein
höher potenziertes Ernähren. Andererseits ist die Excretion, das stete
Aushauchen und Abwerfen von Materie, das Selbe, was in erhöhter Potenz
der Tod, der Gegensatz der Zeugung ist. Wie wir nun hiebei allezeit zufrieden
sind, die Form zu erhalten, ohne die abgeworfene Materie zu betrauern;
so haben wir uns auf gleiche Weise zu verhalten, wenn im Tode das Selbe
in erhöhter Potenz und im Ganzen geschieht, was täglich und stündlich
im Einzelnen bei der Excretion vor sich geht. Wie wir beim erstern gleichgültig
sind, sollten wir beim andern nicht zurückbeben. Von diesem Standpunkt
aus erscheint es daher eben so verkehrt, die Fortdauer seiner Individualität
zu verlangen, welche durch andere Individuen ersetzt wird, als den Bestand
der Materie seines Leibes, die stets durch neue ersetzt wird; es erscheint
eben so thöricht, Leichen einzubalsamiren, als es wäre, seine Auswürfe
sorgfältig zu bewahren.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Es gibt keinen größern Kontrast, als den zwischen der unaufhaltsamen
Flucht der Zeit, die ihren ganzen Inhalt mit sich fortreißt, und der
starren Unbeweglichkeit des wirklich Vorhandenen, welches zu allen Zeiten
das eine und selbe ist. Und faßt man, von diesem Gesichtspunkt aus, die
unmittelbaren Vorgänge des Lebens recht objektiv ins Auge; so wird einem
das Nunc stans im Mittelpunkte des Rades der Zeit klar und sichtbar. —
Einem unvergleichlich länger lebenden Auge, welches mit einem Blick das
Menschengeschlecht, in seiner ganzen Dauer, umfaßte, würde der stete
Wechsel von Geburt und Tod sich nur darstellen wie eine anhaltende Vibration,
und demnach ihm gar nicht einfallen, darin ein stets neues Werden aus
Nichts zu Nichts zu sehen; sondern ihm würde, gleichwie unserm Blick
der schnell gedrehte Funke als bleibender Kreis, die schnell vibrierende
Feder als beharrendes Dreieck, die schwingende Saite als Spindel erscheint,
die Gattung als das Seiende und Bleibende erscheinen, Tod und Geburt als
Vibrationen. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Auf die Erkenntniß der Identität des Wesentlichen in der Erscheinung
des Thiers und des Menschen leitet nichts entschiedener hin, als die Beschäftigung
mit Zoologie und Anatomie. Man muß wahrlich an allen Sinnen blind sein,
um nicht zu erkennen, daß das Wesentliche und Hauptsächliche im Thiere
und im Menschen das Selbe ist, und daß was Beide unterscheidet nicht
im Primären, im Principe, im innern Wesen und im Kern beider Erscheinungen
liegt, als welcher in der einen wie in der andern der Wille ist, sondern
allein im Secundären, im Intellect, im Grade der Erkenntnißkraft. Des
Gleichartigen zwischen Thier und Mensch, sowohl psychisch als somatisch,
ist ohne allen Vergleich mehr, als des Unterscheidenden. Auch in ethischer
Hinsicht findet wesentliche Gleichartigkeit Beider Statt. Die Maxime der
Ungerechtigkeit, das Herrschen der Gewalt statt des Rechts, ist das wirklich
und factisch in der Natur herrschende Gesetz, nicht etwa nur in der Thierwelt,
sondern auch in der Menschenwelt. Seinen nachtheiligen Folgen hat man
bei den civilisirten Völkern durch die Staatseinrichtung vorzubeugen
gesucht; sobald aber diese, wo und wie es sei, aufgehoben oder eludirt
wird, tritt jenes Naturgesetz gleich wieder ein. Fortwährend aber herrscht
es zwischen Volk und Volk; der zwischen diesen übliche Gerechtigkeits=Jargon
ist bekanntlich ein bloßer Kanzleistil der Diplomatik; die rohe Gewalt
entscheidet.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Auf der Identität des Willens in der Thier= und Menschenwelt beruht der
Krieg. Der Mensch ist im Grunde ein wildes, entsetzliches Thier. Wir kennen
es bloß im Zustande der Bändigung und Zähmung, welcher Civilisation
heißt; daher erschrecken uns die gelegentlichen Ausbrüche seiner Natur.
Aber wo und wann ein Mal Schloß und Kette der gesetzlichen Ordnung abfallen
und Anarchie eintritt, da zeigt sich was er ist. — Wer inzwischen auch
ohne solche Gelegenheit sich darüber aufklären möchte, der kann die
Ueberzeugung, daß der Mensch an Grausamkeit und Unerbittlichkeit keinem
Tiger und keiner Hyäne nachsteht, aus hundert alten und neuen Berichten
schöpfen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Gobineau hat den Menschen mit Recht l`animal mèchant par excellence genannt;
denn der Mensch ist das einzige Thier, welches andern Schmerz verursacht
ohne weitern Zweck, als eben diesen. Die andern Thiere thun es nur, um
ihren Hunger zu befriedigen, oder im Zorn des Kampfes. Kein Thier jemals
quält, bloß um zu quälen; aber dies thut der Mensch, und dies macht
den teuflischen Charakter aus, der weit ärger ist, als der bloß thierische.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der durch die ganze Natur gehende Streit der Erscheinungen, welcher die
Offenbarung der dem Willen wesentlichen Entzweiung mit sich selbst ist,
kommt zuletzt im Menschengeschlecht, welches alle andern überwältigt
und die Natur für ein Fabricat zu seinem Gebrauch ansieht, zur furchtbarsten
Deutlichkeit.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Askese hat ihren Ursprung in der das principium individuationis durchschauenden
Erkenntniß, d. h. in jener Erkenntniß, welche den Unterschied zwischen
dem eigenen und dem fremden Individuum aufhebt und die Einheit des Wesens
in allen Erscheinungen intuitiv erkennt, welche Erkenntniß auch schon
der ächten Tugend zu Grunde liegt.
Wenn ein Mensch nicht mehr den egoistischen Unterschied zwischen sich
und den Andern macht, sondern am Leiden der Andern so viel Antheil nimmt,
als an seinem eigenen, so folgt von selbst, daß ein solcher in allen
Wesen sein Selbst wiedererkennender Mensch auch die endlosen Leiden alles
Lebenden als die seinen betrachten und so den Schmerz der ganzen Welt
sich zueignen muß. Er erkennt das Ganze, faßt das Wesen desselben auf,
sieht die Nichtigkeit alles Strebens ein, und diese Einsicht wird ihm
zum Quietiv des Willens. Der Wille wendet sich nunmehr vom Leben ab, der
Mensch gelangt zum Zustande der freiwilligen Entsagung, der Resignation,
der Verneinung des Willens zum Leben. Das Phänomen, wodurch dieses sich
kundgiebt, der Abscheu vor dem Wesen der Welt, dem Willen zum Leben, ist
der Uebergang von der Tugend zur Askesis.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Askese äußert sich in der gänzlichen Gelassenheit und Gleichgültigkeit
gegen die Dinge dieser Welt. Der Asket hütet sich, seinen Willen an irgend
etwas zu hängen. Obgleich sein Leib den Geschlechtstrieb durch Genitalien
ausspricht, will er keine Geschlechtsbefriedigung. Freiwillige, vollkommene
Keuschheit ist der erste Schritt in der Askese. Sodann ferner zeigt sich
die Askese in freiwilliger und absichtlicher Armuth. Endlich, da der Asket
den in seiner Person erscheinenden Willen selbst verneint, so widerstrebt
er auch nicht, wenn ein Anderer es thut, d. h. ihm Unrecht zufügt. Daher
freudiges und gelassenes Ertragen jedes Schadens, jeder Schmach, jeder
Beleidigung.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der einzige wirkliche Vorzug, den die deutsche vor den übrigen europäischen
Nationen hat, ist die Sprache. Die deutsche Sprache nämlich ist die einzige,
in der man beinahe so gut schreiben kann, wie im Griechischen und Lateinischen,
welches den andern europäischen Hauptsprachen, als welche bloße patois
sind, nachrühmen zu wollen lächerlich sein würde. Daher eben hat, mit
diesen verglichen, das Deutsche etwas so ungemein Edles und Erhabenes.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der pedantische Purismus jedoch, die Deutschthümelei und Deutschmichelei,
die alle Fremdwörter, namentlich die termini technici der Wissenschaften,
verdeutschen will, ist zu verwerfen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Ob wohl gar die Menschheit in dem Maaße, als sie an Quantität zunimmt,
an Qualität verliert? wie (nach Schnurrers Geschichte der Seuchen), als
nach dem schwarzen Tod im 14. Jahrhundert eine so ungewöhnliche Fruchtbarkeit
der Weiber eintrat, daß Zwillingsgeburten alltäglich wurden, diesen
sämmtlichen Kindern zwei Zähne fehlten. Wenn man Griechen und Römer
mit dem jetzigen Geschlecht vergleicht, die Urzeit denkt, in der die Vedas
verfaßt wurden, und die Erbärmlichkeit des gegenwärtigen Geschlechts
betrachtet, das sich wie Unkraut vermehrt, auch erwägt, daß unter einer
größern Zahl noch mehr große Männer arithmetisch möglich sind und
keine kommen; — so kann man auf eine solche Hypothese kommen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wie die dunkle Farbe, so auch ist dem Menschen die vegetabilische Nahrung
die natürliche. Aber wie jener, so bleibt er auch dieser nur im tropischen
Klima getreu. Als er sich in die kältern Zonen verbreitete, mußte er
dem ihm unnatürlichen Klima durch eine ihm unnatürliche Nahrung entgegenwirken.
Der Mensch ist also zugleich weiß und carnivor geworden. Eben dadurch
aber, wie auch durch die stärkere Bekleidung hat er eine gewisse unreine
und ekelhafte Beschaffenheit angenommen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Nie soll man der Kürze des Ausdrucks die Deutlichkeit, geschweige die
Grammatik zum Opfer bringen. Den Ausdruck eines Gedankens schwächen,
oder gar den Sinn einer Periode verdunkeln, oder verkümmern, um einige
Worte weniger hinzusetzen, ist beklagenswerther Unverstand. Gerade Dies
aber ist das Treiben jener falschen Kürze, die heut zu Tage im Schwange
ist und darin besteht, daß man das Zweckdienliche, ja, das grammatisch,
oder logisch Nothwendige wegläßt. In Deutschland sind die schlechten
Scribenten jetziger Zeit von ihr, wie von einer Manie, ergriffen und üben
sie mit unglaublichem Unverstand.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Intoleranz ist nur dem Monotheismus wesentlich; ein alleiniger Gott ist
seiner Natur nach ein eifersüchtiger Gott, der keinem andern das Leben
gönnt. Daher sind es die monotheistischen Religionen allein, also das
Judenthum und seine Verzweigungen, Christenthum und Islam, welche uns
das Schauspiel der Religionskriege, Religionsverfolgungen und Ketzergerichte
liefern, wie auch das der Bilderstürmerei und Vertilgung fremder Götterbilder
u. s. w.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Alle Zeiten und alle Länder haben sehr wohl das Mitleid als die Quelle
aller Moralität erkannt, nur Europa nicht; woran allein der foetor judaicus
Schuld ist, der hier Alles und Alles durchzieht. Da muß es dann schlechterdings
ein Pflichtgebot, ein Sittengesetz, ein Imperativ, kurzum eine Ordre und
Kommando sein, dem parirt wird; davon gehen sie nicht ab, und wollen nicht
einsehen, daß Dergleichen immer nur den Egoismus zur Grundlage hat.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Was dem über das ganze Menschengeschlecht verbreiteten und den Weisen,
wie dem Volke einleuchtenden Glauben an Metempsychose entgegensteht, ist
das Judenthum, nebst den aus diesem entsprossenen zwei Religionen, sofern
sie eine Schöpfung des Menschen aus Nichts lehren, an welche er dann
den Glauben an eine endlose Fortdauer nach dem Tode zu knüpfen die harte
Aufgabe hat. Ihnen freilich ist es, mit Feuer und Schwert, gelungen, aus
Europa und einem Theile Asiens jenen tröstlichen Urglauben der Menschheit
zu verdrängen; es steht noch dahin auf wie lange.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Von dem gewöhnlichen Selbstmorde gänzlich verschieden scheint eine besondere
Art desselben zu sein, der aus dem höchsten Grade der Askese freiwillig
gewählte Hungertod. Es scheint, daß die gänzliche Verneinung des Willens
den Grad erreichen könne, wo selbst der zur Erhaltung der Vegetation
des Leibes durch Aufnahme von Nahrung nöthige Wille wegfällt. Weit entfernt,
daß diese Art des Selbstmordes aus dem Willen zum Leben entstände, hört
ein solcher völlig resignirter Asket bloß darum auf zu leben, weil er
ganz und gar aufgehört hat zu wollen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
(Passend zu diesem Thema ist hier
ein Link zu dem preisgekrönten Dokumentarfilm: Das Summen der
Insekten / Bericht einer Mumie. Ein weiterer Link befindet sich hier.)
Die Verwebung der Moral mit mythischen Dogmen in den positiven Glaubenslehren
— welche Verwebung jeder positiven Glaubenslehre ihre große Kraft giebt
— hat zur Folge, daß die Gläubigen die Moral von dem mit ihr verwebten
Mythos nicht mehr zu trennen vermögen und nun jeden Angriff auf den Mythos
für einen Angriff auf Recht und Tugend ansehen. Dies geht so weit, daß
bei den monotheistischen Völkern Atheismus, oder Gottlosigkeit, das Synonym
von Abwesenheit aller Moralität geworden ist. Den Priestern sind solche
Begriffsverwechselungen willkommen, und nur in Folge derselben konnte
jenes furchtbare Ungeheuer, der Fanatismus, entstehen und nicht etwa nur
einzelne verkehrte und böse Individuen, sondern ganze Völker beherrschen
und zuletzt, was zur Ehre der Menschheit nur Ein Mal in ihrer Geschichte
dasteht, in diesem Occident sich als Inquisition verkörpern, welche in
Madrid allein in 300 Jahren 300,000 Menschen, Glaubenssachen halber, auf
dem Scheiterhaufen qualvoll sterben ließ.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die wirklich überlegenen und privilegirten Geister, welche dann und wann
ein Mal zur Erleuchtung der übrigen geboren werden, sind es „von Gottes
Gnaden“ und verhalten sich demnach zu den Akademien und zu deren illustres
confrères, wie geborene Fürsten zu den zahlreichen und aus der Menge
gewählten Repräsentanten des Volkes. Daher sollte eine geheime Scheu
die Herren Akademiker warnen, ehe sie sich an einem solchen rieben, —
es wäre denn, sie hätten die triftigsten Gründe aufzuweisen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Eine Akademie ist kein Glaubenstribunal. Wohl aber hat nun jede, ehe sie
so hohe, ernste und bedenkliche Fragen, wie z. B. die über die Freiheit
des Willens und das Fundament der Moral aufstellt, vorher bei sich selbst
auszumachen, ob sie auch wirklich bereit ist, der Wahrheit, wie immer
sie lauten möge, öffentlich beizutreten. Denn hinterher, nachdem auf
eine ernste Frage eine ernste Antwort eingegangen, ist es nicht mehr an
der Zeit, sie zurückzunehmen. Diese Bedenklichkeit ist ohne Zweifel der
Grund, weshalb die Akademien Europas sich in der Regel wohl hüten, Fragen
solcher Art aufzustellen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wenn der Staat seinen Zweck vollkommen erreicht, wird er die selbe Erscheinung
hervorbringen, als wenn vollkommene Gerechtigkeit der Gesinnung allgemein
herrschte. Das innere Wesen und der Ursprung beider Erscheinungen wird
aber der umgekehrte sein. Nämlich im letztern Fall wäre es dieser, daß
Niemand Unrecht thun wollte; im erstern aber dieser, daß Niemand Unrecht
leiden wollte und die gehörigen Mittel zu diesem Zweck vollkommen angewandt
wären. So läßt sich die selbe Linie aus entgegengesetzten Richtungen
beschreiben und ein Raubthier mit einem Maulkorb ist so unschädlich,
wie ein grasfressendes Thier. — Weiter aber als bis zu diesem Punkte
kann es der Staat nicht bringen; er kann also nicht eine Erscheinung zeigen,
gleich der, welche aus allgemeinem wechselseitigen Wohlwollen und Liebe
entspringen würde.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Es ließe sich denken, daß ein vollkommener Staat jedes Verbrechen hinderte;
politisch wäre dadurch viel, moralisch nichts gewonnen, vielmehr nur
die Abbildung des Willens durch das Leben gehemmt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Erreichte der Staat seinen Zweck vollkommen, so könnte gewissermaßen,
da er durch die in ihm vereinigten Menschenkräfte auch die übrige Natur
sich mehr und mehr dienstbar zu machen weiß, zuletzt durch Fortschaffung
aller Arten von Uebel etwas dem Schlaraffenlande sich Annäherndes zu
Stande kommen. Allein theils ist er noch immer sehr weit von diesem Ziel
entfernt geblieben, theils würden auch noch immer unzählige, dem Leben
durchaus wesentliche Uebel es nach wie vor im Leiden erhalten; theils
ist auch sogar der Zwist der Individuen nie durch den Staat völlig aufzuheben,
da er im Kleinen neckt, wo er im Großen verpönt ist, und endlich wendet
sich die aus dem Innern glücklich vertriebene Eris zuletzt nach Außen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der wahre Nationalcharakter der Deutschen ist Schwerfälligkeit. Sie leuchtet
hervor aus ihrem Gange, ihrem Thun und Treiben, ihrem Reden, Erzählen,
Verstehen und Denken, ganz besonders aber aus ihrem Stil im Schreiben.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Den Deutschen sind, in allen Dingen, Ordnung, Regel und Gesetz verhaßt;
er liebt sich die individuelle Willkür und das eigene Caprice. In geselligen
Vereinen, Clubs und dergleichen kann man sehen, wie gern, selbst ohne
allen Vortheil ihrer Bequemlichkeit, Viele die zweckmäßigsten Gesetze
der Gesellschaft muthwillig brechen. Aus dieser besagten Eigenthümlichkeit
der Deutschen entspringt bei ihnen die gegenwärtig so allgemein gewordene
Manie der Sprachverhunzung.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Von den Deutschen sagt Thomas Hood (up the Rhine), für eine musikalische
Nation seien sie die lärmendste, die ihm je vorgekommen. Daß sie dies
sind, liegt aber nicht daran, daß sie mehr, als Andere, zum Lärmen geneigt
wären, sondern an der aus Stumpfheit entspringenden Unempfindlichkeit
Derer, die den Lärm anzuhören haben, als welche dadurch in keinem Denken
oder Lesen gestört werden, weil sie eben nicht denken. Die allgemeine
Toleranz gegen unnöthigen Lärm, z. B. gegen das Thürenwerfen, ist geradezu
ein Zeichen der allgemeinen Stumpfheit und Gedankenleere der Köpfe. In
Deutschland ist es, als ob es ordentlich darauf angelegt wäre, daß vor
Lärm Niemand zur Besinnung komme.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Deutschen sind frei von Nationalstolz und legen hiedurch einen Beweis
der ihnen nachgerühmten Ehrlichkeit ab; vom Gegentheil aber Die unter
ihnen, welche einen solchen vorgeben und lächerlicher Weise affectiren,
wie die Demokraten.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Keine Nation ist so wenig, wie die Deutschen, geneigt, selbst zu urtheilen
und danach zu verurtheilen, wozu das Leben und die Litteratur stündlich
Anlaß bietet. Sie sind ohne Galle, wie die Tauben; aber wer ohne Galle
ist, ist ohne Verstand und ohne die aus diesem hervorgehende Schärfe
zum Tadeln tadelhafter Dinge, welche vom Nachahmen derselben abhält.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Von den Bekennern des eigentlichen Theismus, der allein in der Jüdischen
und den beiden aus ihr hervorgegangenen Religionen zu finden ist, werden
die Anhänger aller andern Religionen auf Erden unter dem Namen Heiden
zusammengefaßt, — was ein höchst einfältiger und roher Ausdruck ist,
der wenigstens aus den Schriften der Gelehrten verbannt sein sollte, weil
er Brahmanisten, Buddhaisten, Aegypter, Griechen, Römer, Germanen, Gallier,
Irokesen, Patagonier, Karaiben, Otaheiter, Australier u. a. m. identificirt
und in Einen Sack steckt. Für Pfaffen ist solcher Ausdruck passend; in
der gelehrten Welt aber muß ihm sogleich die Thüre gewiesen werden.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Das innere Wesen der Heiligkeit, abstract und rein von allem Mythischen
ausgesprochen, ist Verneinung des Willens zum Leben, eintretend, nachdem
ihm die vollendete (intuitive) Erkenntniß seines eigenen Wesens zum Quietiv
alles Wollens geworden.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Zahl der Freunde, die Einer hat, ist kein Beweis seines Werthes. Nichts
verräth weniger Menschenkenntniß, als wenn man als einen Beleg der Verdienste
und des Werthes eines Menschen anführt, daß er sehr viele Freunde hat;
als ob die Menschen ihre Freundschaft nach dem Werth und Verdienst verschenkten.
Es läßt sich gegentheils behaupten, daß Menschen von vielem Werth und
Verdienst nur wenig Freunde haben können.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Man kann sich das Menschengeschlecht bildlich als ein animal compositum
vorstellen, eine Lebensform, von welcher viele Polypen, besonders die
schwimmenden, wie Veretillum, Funiculina und andere, Beispiele darbieten.
Wie bei diesen der Kopftheil jedes einzelne Thier isolirt, der untere
Theil hingegen, mit dem gemeinschaftlichen Magen, sie alle zur Einheit
eines Lebensprocesses verbindet; so isolirt das Gehirn mit seinem Bewußtsein
die menschlichen Individuen; hingegen der unbewußte Theil, das vegetative
Leben, mit seinem Gangliensystem, ist ein gemeinsames Leben Aller, mittelst
dessen sie sogar ausnahmsweise communiciren können, wie der animalische
Magnetismus und die Magie beweist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Da im Menschen der Wille zur Besinnung und folglich auf den Punkt kommt,
wo er beim Lichte deutlicher Erkenntniß sich zur Bejahung oder Verneinung
des Willens zum Leben entscheidet; so haben wir keinen Grund anzunehmen,
daß es irgendwo noch zu höher gesteigerten Objectivationen des Willens
komme, da er hier schon an seinem Wendepunkte angekommen ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Würde die asketische Verneinung des Willens zum Leben durch freiwillige
Keuschheit eine allgemeine im Menschengeschlecht, so stürbe dieses aus,
und da alle Willenserscheinungen in der Natur zusammenhängen, so läßt
sich annehmen, daß mit der höchsten Willenserscheinung auch der schwächere
Widerschein derselben, die Thierheit wegfallen würde. Mit gänzlicher
Aufhebung der Erkenntniß schwände dann auch von selbst die übrige Welt
in Nichts, da ohne Subjekt kein Object. Die übrige Natur hat also ihre
Erlösung vom Menschen zu erwarten, welcher Priester und Opfer zugleich
ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Zwar kündigt mehr als Alles die Menschenwelt, als in welcher moralisch
Schlechtigkeit und Niederträchtigkeit, intellectuell Unfähigkeit und
Dummheit in erschreckendem Maaße vorherrschen, das Sansara an. Dennoch
treten in ihr, wiewohl sehr sporadisch, aber doch stets und von Neuem
überraschend, Erscheinungen der Redlichkeit, der Güte, ja des Edelmuthes,
und eben so auch des großen Verstandes, des denkenden Geistes, ja des
Genies auf. Nie gehen diese ganz aus. Wir müssen sie als ein Unterpfand
nehmen, daß ein gutes und erlösendes Princip in diesem Sansara steckt,
welches zum Durchbruch kommen und das Ganze erfüllen und befreien kann.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Allgemeinheit einer Meinung ist kein Beweis, ja nicht einmal ein Wahrscheinlichkeitsgrund
ihrer Richtigkeit. Die, welche das Gegentheil behaupten, müssen annehmen:
1) daß die Entfernung in der Zeit jener Allgemeinheit ihre Beweiskraft
raubt; sonst müßten sie alle alten Irrthümer zurückrufen, die einmal
allgemein für Wahrheit galten, z. B. das Ptolemäische System, oder müßten
in allen protestantischen Ländern den Katholicismus herstellen; 2) daß
die Entfernung im Raum dasselbe leistet; sonst wird sie die Allgemeinheit
der Meinung in den Bekennern des Buddhaismus, des Christenthums und des
Islam in Verlegenheit setzen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Einen sehr edelen Charakter denken wir uns immer mit einem gewissen Anstrich
stiller Trauer, die nichts weniger ist als beständige Verdrießlichkeit
über die täglichen Widerwärtigkeiten; sondern ein aus der Erkenntniß
hervorgegangenes Bewußtsein der Nichtigkeit aller Güter und des Leidens
alles Lebens, nicht des eigenen allein.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Ein Grundfehler des Juden= und Christenthums ist, daß es widernatürlicher
Weise den Menschen losgerissen hat von der Thierwelt, welcher er doch
wesentlich angehört, und ihn nun ganz allein gelten lassen will, die
Thiere geradezu als Sachen betrachtend. Der besagte Grundfehler ist eine
Folge der Weltanschauung des Judenthums. Der biblische Spruch: „Der
Gerechte erbarmt sich seines Viehes“ ist unzulänglich. Nicht Erbarmen,
sondern Gerechtigkeit ist man dem Thiere schuldig. Der Schutz der Thiere
fällt in Europa, welches vom foetor judaicus so durchzogen ist, daß
die augenfällige Wahrheit: „das Thier ist im Wesentlichen das Selbe
wie der Mensch“ ein anstößiges Paradoxon ist, den ihn bezweckenden
Gesellschaften und der Polizei anheim, die aber Beide gar wenig vermögen
gegen die Rohheit des Pöbels. Die grausamste Thierquälerei sind die
Vivisektionen, welche jeder Medikaster sich befugt hält, vorzunehmen,
um angebliche Probleme zu entscheiden. Offenbar ist es an der Zeit, daß
der jüdischen Naturauffassung in Europa, wenigstens hinsichtlich der
Thiere, ein Ende werde und das ewige Wesen, welches, wie in uns, auch
in allen Thieren lebt, als solches erkannt, geschont und geachtet werde.
Es ist leider wahr, daß der nach Norden gedrängte Mensch des Fleisches
der Thiere bedarf; man sollte aber den Tod solcher Thiere ihnen ganz unfühlbar
machen durch Chloroform und durch rasches Treffen der letalen Stelle.
Erst wenn jene einfache und über allen Zweifel erhabene Wahrheit, daß
die Thiere im Wesentlichen das Selbe sind, was wir, ins Volk gedrungen
sein wird, werden die Thiere nicht mehr als rechtlose Wesen dastehen und
der bösen Laune und Grausamkeit jedes rohen Buben preisgegeben sein;
und wird es nicht jedem Medikaster frei stehen, jede abenteuerliche Grille
seiner Unwissenheit durch die gräßlichste Qual einer Unzahl von Thieren
auf die Probe zu stellen.
Die Thierschutzgesellschaften brauchen in ihren Ermahnungen noch immer
das schlechte Argument, daß Grausamkeit gegen Thiere zur Grausamkeit
gegen Menschen führe; — als ob bloß der Mensch ein unmittelbarer Gegenstand
der moralischen Pflicht wäre, das Thier bloß ein mittelbarer, an sich
eine bloße Sache!
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Ein richtiges Prognostikon über kommende Dinge können wir nur dann haben,
wann sie uns gar nicht angehen, also unser Interesse durchaus unberührt
lassen; denn außerdem sind wir nicht unbestochen, vielmehr ist unser
Intellect vom Willen inficirt und inquinirt, ohne daß wir es merken.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wer könnte auch nur den Gedanken des Todes ertragen, wenn das Leben eine
Freude wäre. So aber hat jener immer noch das Gute, das Ende des Lebens
zu sein, und wir trösten uns über die Leiden des Lebens mit dem Tode,
und über den Tod mit den Leiden des Lebens. Die Wahrheit ist, daß Beide
unzertrennlich zusammengehören, indem sie ein Irrsal ausmachen, von welchem
zurückzukommen so schwer, wie wünschenswerth ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Ein zu jeder Zeit und für Jeden faßlicher Trost ist: Der Tod ist so
natürlich, wie das Leben; und dann wollen wir weiter sehen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Nach dem ritterlichen Ehrenprincip und seinem Duellwesen behauptet der
persönliche Muth sich zu raufen und zu schlagen den Vorrang vor jeder
andern Eigenschaft; während er doch eigentlich eine sehr untergeordnete,
eine bloße Unterofficierstugend ist, ja, eine, in welcher sogar Thiere
uns übertreffen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Nächst der Klugheit ist Muth eine für unser Glück sehr wesentliche
Eigenschaft. Freilich kann man weder die eine, noch die andere sich geben,
sondern ererbt jene von der Mutter und diesen vom Vater; jedoch läßt
sich durch Vorsatz und Uebung dem davon Vorhandenen nachhelfen. — So
lange der Ausgang einer gefährlichen Sache nur noch zweifelhaft ist,
so lange nur noch die Möglichkeit, daß er ein glücklicher werde, vorhanden
ist, darf an kein Zagen gedacht werden, sondern bloß an Widerstand. Und
doch ist auch hier ein Exceß möglich; denn der Muth kann in Verwegenheit
ausarten.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Daß, wie Beccaria gelehrt hat, die Strafe ein richtiges Verhältniß
zum Verbrechen haben soll, beruht nicht darauf, daß sie eine Buße für
dasselbe wäre; sondern darauf, daß das Pfand dem Werthe Dessen, wofür
es haftet, angemessen sein muß. Daher ist Jeder berechtigt, als Garantie
der Sicherheit seines Lebens fremdes Leben zum Pfande zu fordern, nicht
aber eben so für die Sicherheit seines Eigenthums, als für welches fremde
Freiheit u. s. w. Pfand genug ist. Zur Sicherstellung des Lebens der Bürger
ist daher die Todesstrafe schlechterdings nothwendig. Ueberhaupt giebt
der zu verhütende Schaden den richtigen Maßstab für die anzudrohende
Strafe, nicht aber giebt ihn der moralische Unwerth der verbotenen Handlung.
Neben der Größe des zu verhütenden Schadens kommt bei Bestimmung des
Maßes der Strafe die Stärke der zur verbotenen Handlung antreibenden
Motive in Betracht.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Furcht vor dem Tode entspringt keineswegs aus der Erkenntniß, in
welchem Fall sie das Resultat des erkannten Werthes des Lebens sein würde,
sondern sie hat ihre Wurzel unmittelbar im Willen, aus dessen ursprünglichem
Wesen, welches blinder Wille zum Leben ist, sie hervorgeht. Die Todesfurcht
ist von aller Erkenntniß unabhängig; denn das Thier hat sie, obwohl
es den Tod nicht kennt. Alles, was geboren wird, bringt sie schon mit
auf die Welt. Diese Todesfurcht a priori ist aber eben nur die Kehrseite
des Willens zum Leben, welcher wir Alle ja sind. Daher ist jedem Thiere,
wie die Sorge für seine Erhaltung, so die Furcht vor seiner Zerstörung
angeboren. Das Thier flieht, zittert und sucht sich zu verbergen, weil
es lauter Wille zum Leben, als solcher aber dem Tode verfallen ist und
Zeit gewinnen möchte. Eben so ist von Natur der Mensch. Das größte
der Uebel, das Schlimmste, was überall gedroht werden kann, ist der Tod,
die größte Angst Todesangst. Die hierin hervortretende gränzenlose
Anhänglichkeit an das Leben kann nun aber nicht aus Erkenntniß und Ueberlegung
entsprungen sein, vor der sie vielmehr thöricht erscheint, da es um den
objektiven Werth des Lebens sehr mißlich steht, überdies ja das Leben
jedenfalls bald enden muß. Jene mächtige Anhänglichkeit an das Leben
ist mithin eine unvernünftige und blinde, nur daraus erklärlich, daß
unser ganzes Wesen an sich schon Wille zum Leben ist, und daß dieser
Wille an sich und ursprünglich erkenntnißlos und blind ist. Die Erkenntniß
hingegen, weit entfernt, der Ursprung jener Anhänglichkeit an das Leben
zu sein, wirkt ihr sogar entgegen, indem sie die Werthlosigkeit desselben
aufdeckt und hiedurch die Todesfurcht bekämpft.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wenn die Erkenntniß in der Bekämpfung der Todesfurcht über den Willen
zum Leben siegt und demnach der Mensch dem Tode muthig und gelassen entgegengeht;
so wird dies als groß und edel geehrt; wir feiern also dann den Triumph
der Erkenntniß über den blinden Willen zum Leben, der doch der Kern
unsers eigenen Wesens ist. Imgleichen verachten wir Den, in welchem die
Erkenntniß in jenem Kampfe unterliegt, der daher dem Leben unbedingt
anhängt. Wie könnte, läßt sich hier beiläufig fragen, die gränzenlose
Liebe zum Leben und das Bestreben, es auf alle Weise so lange als möglich
zu erhalten, als niedrig und verächtlich betrachtet werden, wenn dasselbe
das mit Dank zu erkennende Geschenk gütiger Götter wäre? Und wie könnte
sodann die Geringschätzung desselben groß und edel erscheinen?
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Obgleich die Ehre einen negativen Charakter hat, so ist doch diese Negativität
nicht mit Passivität zu verwechseln; vielmehr hat die Ehre einen ganz
activen Charakter. Sie geht nämlich allein von dem Subjekt derselben
aus, beruht auf seinem Thun und Lassen, nicht aber auf Dem, was Andere
thun und was ihm wiederfährt. Dies ist ein Unterscheidungsmerkmal der
wahren Ehre von der ritterlichen, oder Afterehre.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Während die ächten Arten der Ehre sich bei allen Völkern und zu allen
Zeiten finden, ist die ritterliche Ehre oder das point d’honneur erst
im Mittelalter entstanden, und bloß im christlichen Europa und zwar bloß
unter den höheren Ständen einheimisch geworden.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Dem entsprechend, daß das Gehirn als der Parasit, oder Pensionair des
ganzen Organismus auftritt, ist die errungene freie Muße eines Jeden,
indem sie ihm den freien Genuß seines Bewußtseins und seiner Individualität
giebt, die Frucht und der Ertrag seines gesammten Daseins, welches im
Uebrigen nur Mühe und Arbeit ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Den meisten Menschen wirft die freie Muße nichts ab als Langeweile und
Dumpfheit, so oft nicht sinnliche Genüsse, oder Albernheiten da sind,
sie auszufüllen. Wie völlig werthlos sie ist, zeigt die Art, wie sie
solche zubringen. Die gewöhnlichen Leute sind bloß darauf bedacht, die
Zeit zuzubringen; wer dagegen ein Talent hat, — sie zu benutzen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die großen Geister aller Zeit sehen wir auf freie Muße den allerhöchsten
Werth legen. Denn die freie Muße eines Jeden ist so viel werth, wie er
selbst werth ist. — Freie Muße zu besitzen ist nicht nur dem gewöhnlichen
Schicksal, sondern auch der gewöhnlichen Natur des Menschen fremd; denn
seine natürliche Bestimmung ist, daß er seine Zeit mit Herbeischaffung
des zu seiner und seiner Familie Existenz Nothwendigen zubringe. Er ist
ein Sohn der Noth, nicht der freien Intelligenz. Dem entsprechend wird
freie Muße dem gewöhnlichen Menschen bald zur Last, ja, endlich zur
Qual, wenn er sie nicht mittelst allerlei erkünstelter und fingirter
Zwecke, durch Spiel, Zeitvertreib und Steckenpferde auszufüllen vermag;
auch bringt sie ihm aus dem selben Grunde Gefahr. Dagegen bedarf der mit
einem außergewöhnlichen Intellect Begabte für sein Glück eben jener,
dem Andern bald lästigen, bald verderblichen freien Muße; da er ohne
diese ein Pegasus im Joch, mithin unglücklich sein wird.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Das deutsche Wort Selbstsucht führt einen falschen Nebenbegriff von Krankheit
mit sich. Das Wort Eigennutz aber bezeichnet den Egoismus, sofern er unter
Leitung der Vernunft steht, welche ihn befähigt, vermöge der Reflexion
seine Zwecke planmäßig zu verfolgen; daher man die Thiere wohl egoistisch,
aber nicht eigennützig nennen kann. Also ist für den allgemeinen Begriff
das Wort Egoismus beizubehalten.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Vielheit von Individuen, in welcher der Wille sich erscheint, trifft
nicht ihn selbst als Ding an sich, sondern nur seine Erscheinungen; er
ist in jeder von diesen ganz und ungetheilt vorhanden und erblickt um
sich herum das zahllos wiederholte Bild seines eigenen Wesens. Dieses
selbst aber, also das wirklich Reale, findet er unmittelbar nur in seinem
Innern. Daher will Jeder Alles für sich, will Alles besitzen, wenigstens
beherrschen, und was sich ihm widersetzt, möchte er vernichten. Hierzu
kommt, bei den erkennenden Wesen, daß das Individuum Träger des erkennenden
Subjects, und dieses Träger der Welt ist, d. h. daß die ganze Natur
außer ihm, also auch alle übrigen Individuen, nur in seiner Vorstellung
existiren, er sich ihrer stets nur als seiner Vorstellung, also bloß
mittelbar bewußt ist. Hieraus also, daß jedes Individuum sich allein
für real hält und die andern gewissermaßen als bloße Phantome betrachtet,
weil Jeder sich selber unmittelbar gegeben ist, die Andern aber nur mittelbar
durch die Vorstellung von ihnen in seinem Kopfe, — entspringt der Egoismus.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Egoismus, d. h. der Drang zum Dasein und Wohlsein, ist die Haupttriebfeder
im Menschen, wie im Thiere. Er nimmt unter den drei Grundtriebfedern der
Handlungen: Egoismus, Bosheit, Mitleid, die erste Stelle ein. Er ist mit
dem innersten Kern und Wesen des Menschen aufs genaueste verknüpft, ja,
eigentlich identisch. Daher entspringen in der Regel alle Handlungen aus
dem Egoismus. Derselbe ist seiner Natur nach gränzenlos. Der Mensch will
unbedingt sein Dasein erhalten, will es von Schmerzen unbedingt frei,
will die größtmögliche Summe von Wohlsein, und will jeden Genuß, zu
dem er fähig ist, ja, sucht, wo möglich, noch neue Fähigkeiten zum
Genuß in sich zu entwickeln. Alles was sich seinem Streben entgegenstellt,
erregt seinen Unwillen, Zorn, Haß; er wird es als seinen Feind zu vernichten
suchen. Er will, wo möglich, Alles genießen, Alles haben; da aber dies
unmöglich ist, wenigstens Alles beherrschen. „Alles für mich, und
nichts für die Andern“ ist sein Wahlspruch. Aus dem egoistischen Individuum,
sei dasselbe auch nur ein Insect, oder ein Wurm, redet die Natur also:
„Ich allein bin Alles in Allem; an meiner Erhaltung ist Alles gelegen,
das Uebrige mag zu Grunde gehen, es ist eigentlich nichts.“ Diese Gesinnung,
die die eigene Existenz und Wohlsein vor Allem Andern berücksichtigt,
bereit, alles Andere dieser aufzuopfern, ist der Egoismus, der jedem Dinge
in der Natur wesentlich ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Egoismus ist es, wodurch der innere Widerstreit des Weltwillens mit
sich selbst zur fürchterlichen Offenbarung gelangt. Dieser Widerstreit
erreicht im Menschengeschlecht seinen Gipfel, wo der Egoismus den höchsten
Grad erreicht und der durch ihn bedingte Widerstreit der Individuen daher
auf das entsetzlichste hervortritt. Dies sehen wir überall vor Augen,
im Kleinen wie im Großen, sehen es bald von der schrecklichen Seite,
im Leben großer Tyrannen und Bösewichter und in weltverheerenden Kriegen,
bald von der lächerlichen Seite, wo es das Thema des Lustspiels ist und
ganz besonders im Eigendünkel und Eitelkeit hervortritt; wir sehen es
in der Weltgeschichte und in der eigenen Erfahrung.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Wurzel und der Ursprung des jedem nicht ganz verdorbenen Menschen
innewohnenden Gefühls für Ehre und Schande liegt in dem Innewerden des
Individuums, daß es nicht in der Isolirung, sondern nur in der Gemeinschaft
etwas ist und vermag. Hieraus entsteht das Bestreben, für ein taugliches
Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu gelten und dadurch der Vortheile
der menschlichen Gemeinschaft theilhaft zu werden. Hiezu kommt es auf
die günstige Meinung der Andern an, und hieraus entspringt demnach das
eifrige Streben nach der günstigen Meinung Anderer und der hohe Werth,
der darauf gelegt wird.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Es ist ganz natürlich, daß wir uns gegen jede neue, unser bisheriges
System umstoßende Wahrheit abwehrend und verneinend verhalten. Eine uns
von Irrthümern zurückbringende Wahrheit ist einer Arznei zu vergleichen,
sowohl durch ihren bitteren und widerlichen Geschmack, als auch dadurch,
daß sie nicht im Augenblick des Einnehmens, sondern erst nach einiger
Zeit ihre Wirkung äußert.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Zwar so lange, als die Wahrheit noch nicht dasteht, kann der Irrthum sein
Spiel treiben, wie Eulen und Fledermäuse in der Nacht; aber eher mag
man erwarten, daß Eulen und Fledermäuse die Sonne zurück in den Osten
scheuchen werden, als daß die erkannte und deutlich und vollständig
ausgesprochene Wahrheit wieder durch den alten Irrthum verdrängt werde.
Das ist die Kraft der Wahrheit, deren Sieg schwer und mühsam, dafür
aber, wenn einmal errungen, ihr nicht mehr zu entreißen ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die, deren Triebfeder persönliche, amtliche, kirchliche, staatliche,
kurz reale, nicht ideale Zwecke sind, werden trotz des Scheines von Streben
nach Wahrheit, den sie sich geben, doch nimmer die Wahrheit fördern.
Denn die Wahrheit ist keine Hure, die sich Denen an den Hals wirft, welche
ihrer nicht begehren; vielmehr ist sie eine so spröde Schöne, daß selbst
wer ihr Alles opfert noch nicht ihrer Gunst gewiß sein darf.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wie sollte der, welcher für sich, nebst Weib und Kind, ein Auskommen
sucht, zugleich sich der Wahrheit weihen? der Wahrheit, die zu allen Zeiten
ein gefährlicher Begleiter, ein unwillkommener Gast gewesen ist, —
die vermuthlich auch deshalb nackt dargestellt wird, weil sie nichts mitbringt,
nichts auszutheilen hat, sondern nur ihrer selbst wegen gesucht sein will.
Zweien so verschiedenen Herren, wie der Welt und der Wahrheit, läßt
sich nicht zugleich dienen. Das Unternehmen führt zur Heuchelei.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die bloß erlernte Wahrheit klebt uns nur an, wie ein angesetztes Glied,
ein falscher Zahn, eine wächserne Nase, die durch eigenes Denken erworbene
aber gleicht dem natürlichen Gliede; sie allein gehört uns wirklich
an. Darauf beruht der Unterschied zwischen dem Denker und dem bloßen
Gelehrten.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Nur theoretisch, durch Vorhersehen ihrer Wirkung, soll man die Zeit anticipiren,
nicht praktisch, nämlich nicht so, daß man ihr vorgreife, indem man
vor der Zeit verlangt, was erst die Zeit bringen kann. Denn dies bringt
Verderben. Man kann z. B. durch ungelöschten Kalk und Hitze einen Baum
dermaßen treiben, daß er binnen wenigen Tagen Blätter, Blüthen und
Früchte trägt; dann aber stirbt er ab. Opfer des Wuchers der Zeit werden
Alle, die nicht warten können. Den Gang der gemessen ablaufenden Zeit
beschleunigen zu wollen, ist das kostspieligste Unternehmen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Weil eingesogene Irrthümer meistens unauslöschlich sind und die Urtheilskraft
am spätesten zur Reife kommt, soll man die Kinder bis zum sechzehnten
Jahre von allen Lehren, worin große Irrthümer sein können, frei erhalten,
also von aller Philosophie, Religion und allgemeinen Ansichten jeder Art.
Man lasse die Urtheilskraft, da sie Reife und Erfahrung voraussetzt, noch
ruhen und lähme sie nicht durch Einprägung von Vorurtheilen. Hingegen
nehme man, da die Jugend die Zeit ist, Data zu sammeln, besonders das
Gedächtniß in Anspruch und fülle es mit dem Wesentlichsten und Richtigsten
in jeder Art an.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Um die Jugend nicht für das praktische Leben zu verderben, hat man ihr
eine genaue und gründliche Kenntniß davon, wie es eigentlich in der
Welt hergeht, beizubringen, folglich zu verhüten, daß sie nicht eine
falsche, chimärische, mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmende Lebensansicht
aufnehme. Deshalb ist das Lesen von Romanen, mit Ausnahme weniger, den
falschen Einbildungen entgegenwirkender Romane, auszuschließen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Auch ist es nachtheilig, die Moralität der Zöglinge dadurch befördern
zu wollen, daß man sie über die wahre moralische Beschaffenheit der
Menschen täuscht und ihnen Rechtlichkeit und Tugend als die in der Welt
allgemein befolgten Maximen darstellt. Wenn dann später die Erfahrung
sie, und oft zu ihrem großen Schaden, eines Andern belehrt; so kann die
Entdeckung, daß ihre Jugendlehrer die Ersten waren, welche sie betrogen,
nachtheiliger auf ihre eigene Moralität wirken, als wenn diese Lehrer
ihnen das erste Beispiel der Offenherzigkeit und Redlichkeit selbst gegeben
und unverhohlen gesagt hätten: „Die Welt liegt im Argen, die Menschen
sind nicht, wie sie sein sollten; aber laß’ es dich nicht irren und
sei Du besser.“
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Wirksamkeit der Erziehung hat sowohl in intellectueller, als in moralischer
Hinsicht, an dem Angeborenen des Zöglings ihre Gränze. Wie unser moralischer,
so auch kommt unser intellectueller Werth nicht von Außen in uns, sondern
geht aus der Tiefe unseres eigenen Wesens hervor, und können keine Pestalozzische
Erziehungskünste aus einem geborenen Tropf einen denkenden Menschen bilden;
nie! er ist als Tropf geboren und muß als Tropf sterben.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Aus der angeborenen Verschiedenheit des individuellen Charakters ist es
zu erklären, daß trotz der allergleichsten Erziehung und Umgebung zwei
Kinder dennoch den grundverschiedensten Charakter an den Tag legen. So
wenig als den angeborenen Geist, eben so wenig vermag die Erziehung den
angeborenen Charakter umzuschaffen. Hatte doch gerade Nero den Seneka
zum Erzieher.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Kein größerer Irrthum, als zu glauben, daß das zuletzt gesprochene
Wort stets das richtigere, jedes später Geschriebene eine Verbesserung
des früher Geschriebenen und jede Veränderung ein Fortschritt sei. Das
litterarische Geschmeiß ist stets bei der Hand und emsig bemüht, das
von denkenden und urtheilsfähigen Köpfen nach reiflicher Ueberlegung
Gesagte auf seine Weise zu verbessern. Daher hüte sich, wer über einen
Gegenstand sich belehren will, sogleich nur nach den neuesten Büchern
darüber zu greifen, in der Voraussetzung, daß die Wissenschaften immer
fortschreiten. Schon oft ist ein älteres, vortreffliches Buch durch neuere,
schlechtere verdrängt worden. Den Neuerern ist es mit nichts in der Welt
Ernst, sie wollen sich nur geltend machen. Daher ist oft der Gang der
Wissenschaften ein retrogader.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Es giebt Handlungen, deren bloße Unterlassung ein Unrecht ist; solche
Handlungen heißen Pflichten. Dieses ist die wahre philosophische Definition
des Begriffs der Pflicht, welcher hingegen alle Eigenthümlichkeit einbüßt
und dadurch verloren geht, wenn man, wie in der bisherigen Moral, jede
lobenswerthe Handlungsweise Pflicht nennen will, wobei man vergißt, daß
was Pflicht ist, auch Schuldigkeit sein muß. Pflicht, το δεον,
le devoir, duty, ist also eine Handlung, durch deren bloße Unterlassung
man einen Andern verletzt, d. h. Unrecht begeht.
Die bloße Unterlassung einer Handlung kann nur dadurch Verletzung eines
Andern, d. h. Unrecht sein, daß der Unterlasser sich zu einer solchen
Handlung anheischig gemacht, d. h. verpflichtet hat. Demnach beruhen alle
Pflichten auf eingegangener Verpflichtung. Diese ist in der Regel eine
ausdrückliche, gegenseitige Uebereinkunft, wie z. B. zwischen Fürst
und Volk, Regierung und Beamten, Herrn und Diener, Advokat und Klienten,
Arzt und Kranken, überhaupt zwischen Jedem, der eine Leistung irgend
einer Art übernommen hat, und seinem Besteller, im weitesten Sinne des
Worts. Darum giebt jede Pflicht ein Recht; weil keiner sich ohne ein Motiv,
d. h. ohne irgend einen Vortheil für sich, verpflichten kann. Nur eine
Verpflichtung läßt sich anführen, die nicht mittelst einer Uebereinkunft,
sondern unmittelbar durch eine bloße Handlung übernommen wird, weil
Der, gegen den man sie hat, noch nicht da war, als man sie übernahm;
es ist der der Eltern gegen ihre Kinder. Allenfalls könnte man als unmittelbar
durch eine Handlung entstehende Verpflichtung den Ersatz für angerichteten
Schaden geltend machen. Jedoch ist dieser, als Aufhebung der Folgen einer
ungerechten Handlung, eine bloße Bemühung sie auszulöschen, etwas rein
Negatives, das darauf beruht, daß die Handlung selbst hätte unterbleiben
sollen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Das zähe Festhalten an gewissen Vorurtheilen, Wahnbegriffen, Sitten,
Gebräuchen und Kleidungen kommt daher, daß der große Haufe gar wenig
denkt, weil ihm Zeit und Uebung hiezu mangelt. So aber bewahrt er zwar
seine Irrthümer sehr lange, ist dagegen aber auch nicht, wie die gelehrte
Welt, eine Wetterfahne der gesammten Windrose täglich wechselnder Meinungen.
Und dies ist sehr glücklich; denn die große schwere Masse sich in so
rascher Bewegung vorzustellen, ist ein schrecklicher Gedanke, zumal wenn
man dabei erwägt, was Alles sie bei ihren Wendungen fortreißen und umstoßen
würde.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Despotismus und Anarchie sind zwei polarisch sich entgegengesetzte Uebel,
zwischen denen die menschliche Gesellschaft hin und her schwebt. So weit
sie von dem einen sich entfernt, nähert sie sich dem andern. Beide Uebel
sind keineswegs gleich schlimm und gefährlich, sondern das erstere, dessen
Schläge bloß in der Möglichkeit vorhanden sind und nicht Jeden treffen,
ist ungleich weniger zu fürchten, als das letztere, dessen Schläge wirkliche
sind und Jeden täglich treffen. — Jede Verfassung soll sich viel mehr
der Despotie, als der Anarchie nähern; ja, sie muß eine kleine Möglichkeit
des Despotismus enthalten.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wir haben gefunden, daß das Unrecht allemal in der Verletzung eines
Andern besteht, sei es an seiner Person, seiner Freiheit, seinem Eigentum,
oder seiner Ehre. Hieraus scheint zu folgen, daß jedes Unrecht ein positiver
Angriff, eine That sein müsse. Allein es gibt Handlungen, deren bloße
Unterlassung ein Unrecht ist: solche Handlungen heißen Pflichten. Dieses
ist die wahre philosophische Definition des Begriffs der Pflicht, welcher
hingegen alle Eigentümlichkeit einbüßt und dadurch verloren geht, wenn
man, wie in der bisherigen Moral, jede lobenswerte Handlungsweise Pflicht
nennen will, wobei man vergißt, daß was Pflicht ist auch Schuldigkeit
sein muß. Pflicht, το δεον, le devoir, duty, ist also eine Handlung,
durch deren bloße Unterlassung man einen Andern verletzt, d. h. Unrecht
begeht. Offenbar kann dies nur dadurch der Fall sein, daß der Unterlasser
sich zu einer solchen Handlung anheischig gemacht, d. h. eben verpflichtet
hat. Demnach beruhen alle Pflichten auf eingegangener Verpflichtung. Diese
ist in der Regel eine ausdrückliche, gegenseitige Uebereinkunft, wie
z. B. zwischen Fürst und Volk, Regierung und Beamten, Herrn und Diener,
Advokat und Klienten, Arzt und Kranken, überhaupt zwischen einem jeden,
der eine Leistung irgend einer Art übernommen hat, und seinem Besteller,
im weitesten Sinne des Worts. Darum gibt jede Pflicht ein Recht: weil
keiner sich ohne ein Motiv, d. h. hier, ohne irgend einen Vorteil für
sich, verpflichten kann. Nur eine Verpflichtung ist mir bekannt, die nicht
mittelst einer Uebereinkunft, sondern unmittelbar durch eine bloße Handlung
übernommen wird; weil der, gegen den man sie hat, noch nicht da war,
als man sie übernahm: es ist die der Eltern gegen ihre Kinder. Wer ein
Kind in die Welt setzt, hat die Pflicht es zu erhalten, bis es sich selbst
zu erhalten fähig ist: und sollte diese Zeit, wie bei einem Blinden,
Krüppel, Kretinen u. dgl. nie eintreten, so hört auch die Pflicht nie
auf. Denn durch das bloße Nichtleisten der Hilfe, also eine Unterlassung,
würde er sein Kind verletzen, ja, dem Untergange zuführen. Die moralische
Pflicht der Kinder gegen die Eltern ist nicht so unmittelbar und entschieden.
Sie beruht darauf, daß, weil jede Pflicht ein Recht gibt, auch die Eltern
eines gegen die Kinder haben müssen, welches bei diesen die Pflicht des
Gehorsams begründet, die aber nachmals, mit dem Recht, aus welchem sie
entstanden ist, auch aufhört. An ihre Stelle wird alsdann Dankbarkeit
treten für das, was die Eltern mehr gethan, als strenge ihre Pflicht
war. Jedoch, ein so häßliches, oft selbst empörendes Laster auch der
Undank ist; so ist Dankbarkeit doch nicht Pflicht zu nennen: weil ihr
Ausbleiben keine Verletzung des Andern, also kein Unrecht ist. Außerdem
müßte der Wohlthäter vermeint haben, stillschweigend einen Handel abzuschließen.
— Allenfalls könnte man als unmittelbar durch eine Handlung entstehende
Verpflichtung den Ersatz für angerichteten Schaden geltend machen. Jedoch
ist dieser, als Aufhebung der Folgen einer ungerechten Handlung, eine
bloße Bemühung sie auszulöschen, etwas rein Negatives, das darauf beruht,
daß die Handlung selbst hätte unterbleiben sollen. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Ueber den praktischen Gebrauch der Vernunft und den Stoicismus.
Im siebenten Kapitel habe ich gezeigt, daß im Theoretischen das Ausgehen
von Begriffen nur zu mittelmäßigen Leistungen hinreicht, die vortrefflichen
hingegen das Schöpfen aus der Anschauung selbst, als der Urquelle aller
Erkenntnis, erfordern. Im Praktischen verhält es sich nun aber umgekehrt:
hier ist das Bestimmtwerden durch das Anschauliche die Weise des Tiers,
des Menschen aber unwürdig, als welcher Begriffe hat, sein Handeln zu
leiten, und dadurch emanzipiert ist von der Macht der anschaulich vorliegenden
Gegenwart, welcher das Tier unbedingt hingegeben ist. In dem Maße, wie
der Mensch dieses Vorrecht geltend macht, ist sein Handeln vernünftig
zu nennen, und nur in diesem Sinne kann von praktischer Vernunft die Rede
sein, nicht im Kantischen, dessen Unstatthaftigkeit ich in der Preisschrift
über das Fundament der Moral ausführlich dargethan habe.
Es ist aber nicht leicht, sich durch Begriffe allein bestimmen zu lassen:
auch auf das stärkste Gemüt dringt die vorliegende nächste Außenwelt,
mit ihrer anschaulichen Realität, gewaltsam ein. Aber eben in der Besiegung
dieses Eindrucks, in der Vernichtung seines Gaukelspiels, zeigt der Menschengeist
seine Würde und Größe. So, wenn die Reizungen zu Lust und Genuß ihn
ungerührt lassen, oder das Drohen und Wüten ergrimmter Feinde ihn nicht
erschüttert, das Flehen irrender Freunde seinen Entschluß nicht wanken
macht, die Truggestalten, mit denen verabredete Intriguen ihn umstellen,
ihn unbewegt lassen, der Hohn der Thoren und des Pöbels ihn nicht aus
der Fassung bringt, noch irre macht an seinem eigenen Wert: dann scheint
er unter dem Einfluß einer ihm allein sichtbaren Geisterwelt (und das
ist die der Begriffe) zu stehen, vor welcher jene Allen offen daliegende,
anschauliche Gegenwart wie ein Phantom zerfließt. — Was hingegen der
Außenwelt und sichtbaren Realität ihre große Gewalt über das Gemüt
erteilt, ist die Nähe und Unmittelbarkeit derselben. Wie die Magnetnadel,
welche durch die vereinte Wirkung weitverteilter, die ganze Erde umfassender
Naturkräfte in ihrer Richtung erhalten wird, dennoch durch ein kleines
Stückchen Eisen, wenn es ihr nur recht nahe kommt, perturbiert und in
heftige Schwankungen versetzt werden kann; so kann bisweilen selbst ein
starker Geist durch geringfügige Begebenheiten und Menschen, wenn sie
nur in großer Nähe auf ihn einwirken, aus der Fassung gebracht und perturbiert
werden, und den überlegtesten Entschluß kann ein unbedeutendes, aber
unmittelbar gegenwärtiges Gegenmotiv in momentanes Wanken versetzen.
Denn der relative Einfluß der Motive steht unter einem Gesetz, welches
dem, nach welchem die Gewichte auf den Wagebalken wirken, gerade entgegengesetzt
ist, und infolgedessen ein sehr kleines, aber sehr nahe liegendes Motiv
ein an sich viel stärkeres, jedoch aus der Ferne wirkendes, überwiegen
kann. Die Beschaffenheit des Gemütes aber, vermöge deren es diesem Gesetze
gemäß sich bestimmen läßt und nicht, kraft der wirklich praktischen
Vernunft, sich ihm entzieht, ist es, was die Alten durch animi impotentia
bezeichneten, welches eigentlich ratio regendae voluntatis impotens bedeutet.
Jeder Affekt (animi perturbatio) entsteht eben dadurch, daß eine auf
unsern Willen wirkende Vorstellung uns so übermäßig nahe tritt, daß
sie uns alles übrige verdeckt, und wir nichts mehr als sie sehen können,
wodurch wir, für den Augenblick, unfähig werden, das Anderweitige zu
berücksichtigen. Ein gutes Mittel dagegen wäre, daß man sich dahin
brächte, die Gegenwart unter der Einbildung anzusehen, sie sei Vergangenheit,
mithin seiner Apperception den Briefstil der Römer angewöhnte. Vermögen
wir doch sehr wohl, umgekehrt, das längst Vergangene so lebhaft als gegenwärtig
anzusehen, daß alte, längst schlafende Affekte dadurch wieder zu vollem
Toben erwachen. — Imgleichen würde niemand sich über einen Unfall,
eine Widerwärtigkeit, entrüsten und aus der Fassung geraten, wenn die
Vernunft ihm stets gegenwärtig erhielte, was eigentlich der Mensch ist:
das großen und kleinen Unfällen, ohne Zahl, täglich und stündlich
preisgegebene, hilfsbedürftigste Wesen, το δειλοτατον ζωον,
welches daher in beständiger Sorge und Furcht zu leben hat. ΚΙ αν
εστι ανϑρωπος συμφορ (homo totus est calamitas) sagt
schon Herodot.
Die Anwendung der Vernunft auf das Praktische leistet zunächst dies,
daß sie das Einseitige und Zerstückelte der bloß anschauenden Erkenntnis
wieder Zusammensetzt und die Gegensätze, welche diese darbietet, als
Korrektionen zu einander gebraucht, wodurch das objektiv richtige Resultat
gewonnen wird. Z. B. fassen wir die schlechte Handlung eines Menschen
ins Auge, so werden wir ihn verdammen; hingegen, bloß die Not, die ihn
dazu bewogen, betrachtend, ihn bemitleiden: die Vernunft, mittelst ihrer
Begriffe, erwägt beides und führt zu dem Resultat, daß er durch angemessene
Strafe gebändigt, eingeschränkt, gelenkt werden müsse.
Ich erinnere hier nochmals an Senecas Ausspruch: Si vis tibi omnia subjicere,
te subjice rationi. Weil nun aber, wie im vierten Buche dargethan wird,
das Leiden positiver, der Genuß negativer Natur ist; so wird der, welcher
die abstrakte oder Vernunfterkenntnis zur Richtschnur seines Thuns nimmt
und demnach dessen Folgen und die Zukunft allezeit bedenkt, das Sustine
et abstine sehr häufig zu üben haben, indem er, um die möglichste Schmerzlosigkeit
des Lebens zu erlangen, die lebhaften Freuden und Genüsse meistens zum
Opfer bringt, eingedenk des Aristotelischen ό φρονιμος το αλυπον
διωκει, ου το ήδυ (quod dolore vacat, non quod suave est,
persequitur vir prudens). Daher borgt bei ihm stets die Zukunft von der
Gegenwart; statt daß beim leichtsinnigen Thoren die Gegenwart von der
Zukunft borgt, welche, dadurch verarmt, nachher bankrott wird. Bei jenem
muß freilich die Vernunft meistens die Rolle eines grämlichen Mentors
spielen und unablässig auf Entsagungen antragen, ohne dafür etwas anderes
versprechen zu können, als eine ziemlich schmerzlose Existenz. Dies beruht
darauf, daß die Vernunft, mittelst ihrer Begriffe, das Ganze des Lebens
überblickt, dessen Ergebnis, im berechenbar glücklichsten Fall, kein
anderes sein kann, als das besagte. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Von den drei Weltmächten Klugheit, Stärke, Glück vermag die zuletzt
genannte am meisten. Denn unser Lebensweg ist dem Lauf eines Schiffes
zu vergleichen. Das Schicksal, die τυχη, die secunda aut adversa fortuna,
spielt die Rolle des Windes, indem sie uns schnell weit fördert, oder
weit zurückwirft; wogegen unser eigenes Mühen und Treiben, welches dabei
die Rolle der Ruder spielt, nur wenig vermag. Diese Macht des Glückes
drückt das spanische Sprüchwort: „Gieb deinem Sohne Glück und wirf
ihn ins Meer“ treffend aus.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
In einem Dasein, wie das unsrige, welches wesentlich die beständige Bewegung
zur Form hat, dessen Typus also Unruhe ist, und in einer Welt, wie die
unsrige, wo keine Stabilität irgend einer Art möglich, sondern Alles
in rastlosem Wirbel und Wechsel begriffen ist, läßt Glücksäligkeit
sich nicht einmal denken. Sie kann nicht wohnen, wo Plato’s „beständiges
Werden und nie Sein“ allein Statt findet. Keiner ist glücklich, sondern
Jeder strebt nur sein Leben lang nach einem vermeintlichen Glück.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Gewissermaßen ist es a priori einzusehen, daß das, was jetzt das Phänomen
der Welt hervorbringt, auch fähig sein müsse, dieses nicht zu thun,
mithin in Ruhe zu verbleiben, — oder, mit andern Worten, daß es zur
gegenwärtigen διαστολη auch eine συστολη geben müsse.
Ist nun die erstere die Erscheinung des Wollens des Lebens; so wird die
andere die Erscheinung des Nichtwollens desselben sein.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wenn auch keine physikalischen Gründe den Nichteintritt einer abermaligen
Weltkatastrophe, wie deren schon mehrere stattgefunden, verbürgen; so
steht einer solchen doch ein moralischer Grund entgegen, nämlich dieser,
daß sie jetzt, nachdem mit dem Menschen als der höchsten Objectivationsstufe
der Natur die Möglichkeit der Verneinung des Willens eingetreten ist,
zwecklos sein würde, indem das innere Wesen der Welt jetzt keiner höhern
Objectivation zur Möglichkeit seiner Erlösung daraus bedarf.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Identität des Subjects des Wollens mit dem erkennenden Subject, vermöge
welcher (und zwar nothwendig) das Wort „Ich“ beide einschließt und
bezeichnet, ist der Weltknoten und daher unerklärlich.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Dilettanten, Dilettanten! — so werden die, welche eine Wissenschaft
oder Kunst, aus Liebe zu ihr und Freude an ihr, per il loro diletto, treiben,
mit Geringschätzung genannt von denen, die sich des Gewinnes halber darauf
gelegt haben; weil sie nur das Geld delektiert, das damit zu verdienen
ist. Diese Geringschätzung beruht auf ihrer niederträchtigen Ueberzeugung,
daß keiner eine Sache ernstlich angreifen werde, wenn ihn nicht Not,
Hunger, oder sonst welche Gier dazu anspornt. Das Publikum ist desselben
Geistes und daher derselben Meinung: hieraus entspringt sein durchgängiger
Respekt vor den „Leuten vom Fach“ und sein Mißtrauen gegen Dilettanten.
In Wahrheit hingegen ist dem Dilettanten die Sache Zweck, dem Manne vom
Fach, als solchem, bloß Mittel; nur der aber wird eine Sache mit ganzem
Ernste treiben, dem unmittelbar an ihr gelegen ist und der sich aus Liebe
zu ihr damit beschäftigt, sie con amore treibt. Von solchen, und nicht
von den Lohndienern, ist stets das Größte ausgegangen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Zum Philosophiren sind die zwei ersten Erfordernisse diese: erstlich,
daß man den Muth habe, keine Frage auf dem Herzen zu behalten, und zweitens,
daß man alles Das, was sich von selbst versteht, sich zum deutlichen
Bewußtsein bringe, um es als Problem aufzufassen. Endlich auch muß,
um eigentlich zu philosophiren, der Geist wahrhaft müßig sein; er muß
keine Zwecke verfolgen und also nicht vom Willen gelenkt werden, sondern
sich ungetheilt der Belehrung hingeben, welche die anschauliche Welt und
das eigene Bewußtsein ihm ertheilt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Platon sagt öfter, daß die Menschen nur im Traume leben, der Philosoph
allein sich zu wachen bestrebe.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Mehr, als jeder Andere, soll der Philosoph aus der Urquelle alles unsers
Erkennens, der Anschauung, schöpfen und daher stets die Dinge selbst,
die Natur, die Welt, das Leben ins Auge fassen, sie, und nicht die Bücher,
zum Texte seiner Gedanken machen, auch stets an ihnen alle fertig überkommenen
Begriffe prüfen und controliren, die Bücher hingegen nur als Beihülfe
benutzen. An der Natur, der Wirklichkeit, die nie lügt, hat der Philosoph
sein Studium zu machen, und zwar an ihren großen, deutlichen Zügen,
ihrem Haupt= und Grundcharakter. Demnach hat er die wesentlichen und allgemeinen
Erscheinungen zum Gegenstande seiner Betrachtung zu machen, hingegen die
seltenen, vorüberfliegenden, speciellen, mikroskopischen den Fachgelehrten
zu überlassen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die wahre Weisheit ist nicht dadurch zu erlangen, daß man die gränzenlose
Welt ausmißt, oder, was noch zweckmäßiger wäre, den endlosen Raum
persönlich durchflöge; sondern vielmehr dadurch, daß man irgend ein
Einzelnes ganz erforscht, indem man das wahre und eigentliche Wesen desselben
vollkommen erkennen und verstehen zu lernen sucht.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die, welche die Philosophie als speculative Theologie betrachten und behandeln,
wissen nichts davon, daß man frei und unbefangen an das Problem des Daseins
gehen und die Welt nebst dem Bewußtsein, darin sie sich darstellt, als
das allein Gegebene, das Problem, das Räthsel der alten Sphinx, vor die
man hier kühn getreten ist, betrachten soll. Sie ignoriren klüglich,
daß Theologie, wenn sie Eingang in die Philosophie verlangt, gleich allen
andern Lehren, erst ihr Creditiv vorzuweisen hat. Die Philosophie ist
keine Kirche und keine Religion. Sie ist das kleine Fleckchen auf der
Welt, wo die stets und überall gehaßte und verfolgte Wahrheit ein Mal
alles Druckes und Zwanges ledig sein, ja sogar die Prärogative und das
große Wort haben, absolut allein herrschen und kein Anderes neben sich
gelten lassen soll.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Philosophie macht den Anspruch und hat daher die Verpflichtung, in
Allem, was sie sagt, sensu stricto et proprio wahr zu sein; denn sie wendet
sich an das Denken und die Ueberzeugung. Die Religion hingegen, für die
Unzähligen bestimmt, welche, der Prüfung und des Denkens unfähig, die
tiefsten und schwierigsten Wahrheiten sensu proprio nimmermehr fassen
würden, hat auch nur die Verpflichtung, sensu allegorico wahr zu sein.
Nackt kann die Wahrheit vor dem Volke nicht erscheinen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wegen der großen intellectuellen Verschiedenheit der Menschen paßt nicht
Eine Philosophie für Alle, sondern eine jede zieht, nach Gesetzen der
Wahlverwandtschaft, dasjenige Publicum an sich, dessen Bildung und Geisteskräften
sie angemessen ist. Daher giebt es allezeit eine niedrige Schulmetaphysik,
für den gelehrten Plebs, und eine höhere, für die Elite. Mußte doch
z. B. auch Kants hohe Lehre erst für die Schulen herabgezogen, und verdorben
werden durch Fries, Krug, Galat und ähnliche Leute.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Daß dieselbe Philosophie für Narren und Weise taugen solle, ist eine
unbillige Forderung, angesehen, daß die intellectuelle Verschiedenheit
der Menschen so groß ist, wie die moralische, und das will viel sagen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Philosophie wird nicht durch den Zeitgeist bestimmt, sondern umgekehrt.
Wäre im Mittelalter die Philosophie eine andere gewesen, so hätte kein
Gregor VII. und keine Kreuzzüge bestehen können. Aber der Zeitgeist
wirkt negativ auf die Philosophie, indem er die zu ihr fähigen Geister
nicht zur Ausbildung und nicht zur Sprache gelangen läßt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die allermeisten Herrlichkeiten sind bloßer Schein, wie die Theaterdecoration,
und das Wesen der Sache fehlt. Z. B. bewimpelte und bekränzte Schiffe,
Kanonenschüsse, Illuminationen, Pauken und Trompeten, Jauchzen und Schreien
u. s. w. — dies Alles ist das Aushängeschild, die Hieroglyphe der Freude;
aber die Freude selbst ist dabei meistens nicht zu finden; sie allein
hat beim Feste abgesagt. Die wirkliche Freude kommt in der Regel ungeladen
und ungemeldet, von selbst und sans façon, ja, still herangeschlichen,
oft bei den unbedeutendsten Anlässen, unter den alltäglichsten Umständen,
ja, bei nichts weniger als glänzenden, oder ruhmvollen Gelegenheiten.
Bei allen oben erwähnten gleißenden Dingen und Festlichkeiten ist auch
der Zweck bloß, Andere glauben zu machen, hier wäre die Freude eingekehrt;
dieser Schein im Kopf Anderer ist die Absicht. Glänzende, rauschende
Feste und Lustbarkeiten tragen stets eine Leere, wohl gar einen Mißton
im Innern, schon weil sie dem Elend und der Dürftigkeit unsers Daseins
laut widersprechen, und der Contrast erhöht die Wahrheit.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Durch das Gehirn ist der thierische Organismus gewissermaßen monarchisch
construirt: das Gehirn allein ist der Lenker und Regierer, das Hegemonikon.
Wenngleich Herz, Lunge und Magen zum Bestande des Ganzen viel mehr beitragen;
so können diese Spießbürger darum doch nicht lenken und leiten. Dies
ist Sache des Gehirns allein und muß von Einem Punkte ausgehen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Für die Staatsmaschine ist die Preßfreiheit das, was für die Dampfmaschine
die Sicherheitsvalve; denn mittelst derselben macht jede Unzufriedenheit
sich alsbald durch Worte Luft, ja wird sich, wenn sie nicht sehr viel
Stoff hat, an ihnen erschöpfen. Hat sie jedoch diesen, so ist es gut,
daß man ihn bei Zeiten erkenne, um abzuhelfen. So geht es sehr viel besser,
als wenn die Unzufriedenheit eingezwängt bleibt, brütet, gährt, kocht
und anwächst, bis sie endlich zur Explosion gelangt. — Andererseits
jedoch ist die Preßfreiheit anzusehen als die Erlaubniß, Gift zu verkaufen,
Gift für Geist und Gemüth. Es ist daher zu befürchten, daß die Gefahren
der Preßfreiheit ihren Nutzen überwiegen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die drei physiologischen Grundkräfte bilden die Quellen dreier Arten
möglicher Genüsse. Es giebt demnach Genüsse der Reproductionskraft,
Genüsse der Irritabilität und Genüsse der Sensibilität. Je nach dem
Vorwalten der einen oder der andern dieser drei Kräfte, strebt der Mensch
überwiegend nach der einen oder der andern dieser Arten des Genusses.
Je edlerer Art die dem Genuß zu Grunde liegende Kraft ist, desto edlerer
Art wird der Genuß sein. Der Vorrang, den in dieser Hinsicht die Sensibilität,
deren entschiedenes Ueberwiegen das Auszeichnende des Menschen vor den
übrigen Thiergeschlechtern ist, vor den beiden andern physiologischen
Grundkräften hat, als welche in gleichem und sogar in höherem Grade
den Thieren einwohnen, ist unleugbar. Der Sensibilität gehören unsere
Erkenntnißkräfte an; daher befähigt das Ueberwiegen derselben zu den
im Erkennen bestehenden, also den geistigen Genüssen, und zwar zu um
so größeren, je entschiedener jenes Ueberwiegen ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wie thöricht, zu bedauern, daß man in vergangener Zeit die Gelegenheit
zu diesem oder jenem Genuß unbenutzt gelassen hat! — Was hätte man
denn jetzt mehr davon, als die dürre Mumie einer Erinnerung? — Die
Form der Zeit ist geradezu das Mittel und wie darauf berechnet, uns die
Nichtigkeit aller irdischen Genüsse beizubringen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Gerechtigkeit ist die erste und wichtigste Cardinaltugend. Sie verhält
sich zur zweiten Cardinaltugend, der Menschenliebe, wie das Negative zum
Positiven, wie das Nichtverletzen zum Helfen. Das Mitleid, diese ächte
und natürliche moralische Triebfeder, hat nämlich zwei deutlich getrennte
Grade seiner Wirksamkeit. Im ersten Grade wirkt es den egoistischen oder
boshaften Motiven bloß negativ entgegen, indem es abhält, dem Andern
ein Leiden zu verursachen, ihn zu verletzen; im zweiten und höhern Grade
dagegen treibt es, positiv wirkend, zu thätiger Hülfe an. Die Gerechtigkeit
ist demnach, als bloße Negation des Bösen, eine negative Tugend. Derjenige,
welcher freiwillig, aus bloßem Mitleid, also auch da, wo kein Staat oder
sonstige Gewalt das Unrecht bedroht, sich des Unrechts enthält, ist gerecht.
Ein solcher verhängt nicht, um sein eigenes Wohlsein zu vermehren, Leiden
über Andere, d. h. er begeht kein Verbrechen, respectirt vielmehr die
Rechte eines Jeden. Das Gemüth des Gerechten ist bis zu dem Grade für
das Mitleid empfänglich, daß dieses ihn zurückhält, wo und wann er,
um seine Zwecke zu erreichen, fremdes Leiden als Mittel gebrauchen möchte;
gleichviel, ob dieses Leiden ein augenblicklich, oder später eintretendes,
ein directes, oder indirectes, durch Zwischenglieder vermitteltes sei.
Der Gerechte wird folglich so wenig das Eigenthum, als die Person des
Andern angreifen, ihm so wenig geistige, als körperliche Leiden verursachen,
also nicht nur jeder physischen Verletzung sich enthalten, sondern auch
eben so wenig auf geistigem Wege dem Andern Schmerz bereiten durch Kränkung,
Aengstigung, Aerger oder Verläumdung.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Obwohl aber die Gerechtigkeit als ächte, freie Tugend ihren Ursprung
im Mitleid hat; so ist doch keineswegs erforderlich, daß in jedem einzelnen
Fall das Mitleid wirklich erregt werde; sondern aus der ein für alle
Mal erlangten Kenntniß von dem Leiden, welches jede ungerechte Handlung
nothwendig über Andere bringt, geht in edlen Gemüthern die Maxime: Verletze
Niemand! (neminem laede!) hervor, und die vernünftige Ueberlegung erhebt
sie zu dem ein für Alle Mal gefaßten festen Vorsatz, die Rechte eines
Jeden zu achten, sich keinen Eingriff in dieselben zu erlauben. In den
einzelnen Handlungen des Gerechten wirkt demnach das Mitleid nur noch
indirect, mittelst des Grundsatzes, und nicht sowohl actu, als potentia.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Das Maaß der ächten, freiwilligen, uneigennützigen und ungeschminkten
Gerechtigkeit ist gering. Dieselbe kommt immer nur als überraschende
Ausnahme vor und verhält sich zu ihrer Afterart, der auf bloßer Klugheit
beruhenden und überall laut angekündigten Gerechtigkeit, der Qualität
und Quantität nach, wie Gold zu Kupfer. Diese letztere läßt sich als
δικαιοσυνη πανδημος, die erste als ούρανια
bezeichnen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Das Wort Atheismus enthält eine Erschleichung, weil es vorweg den Theismus
als sich von selbst verstehend annimmt. Man sollte statt Dessen sagen:
Nichtjudenthum, und statt Atheist: Nichtjude; so wäre es ehrlich geredet.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Aus Ormuzd ist Jehova (so wie aus Ahriman Satan) geworden. Ormuzd selbst
aber stammt aus dem Brahmanismus; er ist nämlich kein anderer, als Indra,
jener untergeordnete, oft mit Menschen rivalisirende Gott des Firmaments
und der Atmosphäre. Dieser Indra= Ormuzd= Jehova mußte nachmals in das
Christenthum, da es in Judäa entstand, übergehen, dessen kosmopolitischem
Charakter zufolge er jedoch seine Eigennamen ablegte, um in der Landessprache
jeder bekehrten Nation durch das Appellativum der durch ihn verdrängten
übermenschlichen Individuen bezeichnet zu werden, als ϑεος, Deus,
welches vom Sanskrit Deva kommt (wovon auch devil, Teufel), oder bei den
Gothisch= Germanischen Völkern durch das von Odin oder Wodan, Guodan,
Godan stammende Wort God, Gott. Eben so nahm er, in dem gleichfalls aus
dem Judenthum stammenden Islam, den in Arabien auch schon früher vorhandenen
Namen Allah an.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Da einerseits durch die Unveränderlichkeit des Charakters, und andererseits
durch die strenge Nothwendigkeit, mit der alle Umstände, in die er successive
versetzt wird, eintreten, der Lebenslauf eines Jeden durchgängig von
A bis Z genau bestimmt ist, dennoch aber der eine Lebenslauf in allen,
sowohl subjektiven wie objektiven Bestimmungen ungleich glücklicher,
edeler und würdiger ausfällt, als der andere; so führt dies, wenn man
nicht alle Gerechtigkeit eliminieren will, zu der im Brahmanismus und
Buddhaismus feststehenden Annahme, daß sowohl die subjectiven Bedingungen,
mit welchen, als die objektiven, unter welchen Jeder geboren wird, die
moralische Folge eines früheren Daseins sind.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Man sehe das starre Entsetzen, mit welchem ein Todesurtheil vernommen
wird, das tiefe Grausen, mit welchem wir die Anstalten zu dessen Vollziehung
erblicken, und das herzzerreißende Mitleid, welches uns bei dieser selbst
ergreift. An solchen Erscheinungen wird sichtbar, daß der Wille zum Leben
das Allerrealste, ja der Kern der Realität selbst ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
In der Philosophie zu lehren, der theologische Grundgedanke (das Dasein
des persönlichen Gottes) verstände sich von selbst und die Vernunft
wäre eben nur die Fähigkeit, denselben unmittelbar zu fassen und als
wahr zu erkennen, ist ein unverschämtes Vorgehen. Nicht nur darf in der
Philosophie ein solcher Gedanke nicht ohne den vollgültigsten Beweis
angenommen werden, sondern sogar der Religion ist er durchaus nicht wesentlich,
wie der atheistische Buddhaismus bezeugt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Ausübung des Unrechts geschieht entweder durch Gewalt, oder durch
List, welches in Hinsicht auf das moralisch Wesentliche einerlei ist.
Gewalt ist Zwang des fremden Individuums durch physische Causalität,
List aber Zwang mittelst der Motivation, d. h. der durch das Erkennen
durchgegangenen Causalität.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Das Recht an sich selbst ist machtlos; von Natur herrscht die Gewalt.
Diese nun zum Rechte hinüber zu ziehn, so daß mittelst der Gewalt das
Recht herrsche, dies ist das Problem der Staatskunst, — ein bei dem
grenzenlosen Egoismus der Menschen schweres Problem. — Unmittelbar kann
immer nur die physische Gewalt wirken, da vor ihr allein die Menschen,
wie sie in der Regel sind, Respect haben. Die Machtlosigkeit bloß moralischer
Gewalten, wie Vernunft, Recht, Billigkeit, würde bei Aufhebung alles
physischen Zwanges sofort augenfällig werden. Nun ist aber die physische
Gewalt ursprünglich bei der Masse, bei welcher Unwissenheit, Dummheit
und Unrechtlichkeit ihr Gesellschaft leisten. Die Aufgabe der Staatskunst
ist demnach zunächst, unter so schwierigen Umständen dennoch die physische
Gewalt der Intelligenz, der geistigen Ueberlegenheit, zu unterwerfen und
dienstbar zu machen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Religion hat, da sie in ihrer mythischen Form die Wahrheit nicht anders,
als mit der Lüge versetzt giebt, zwei Gesichter, eines der Wahrheit und
eines des Truges. Je nachdem man das eine, oder das andere ins Auge faßt,
wird man sie lieben oder anfeinden. Daher muß man sie als ein nothwendiges
Uebel betrachten, dessen Nothwendigkeit auf der erbärmlichen Geistesschwäche
der großen Mehrzahl der Menschen beruht, welche die Wahrheit zu fassen
unfähig ist und daher eines Surrogats derselben bedarf.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Religionen haben sehr häufig einen entschieden demoralisirenden Einfluß.
Im Allgemeinen ließe sich behaupten, daß was den Pflichten gegen Gott
beigelegt wird, den Pflichten gegen die Menschen entzogen wird, indem
es sehr bequem ist, den Mangel des Wohlverhaltens gegen diese durch Adulation
gegen jenen zu ersetzen. Demgemäß sehen wir in allen Zeiten und Ländern
die große Mehrzahl der Menschen es viel leichter finden, den Himmel durch
Gebete zu erbetteln, als durch Handlungen zu verdienen. In jeder Religion
kommt es bald dahin, daß für die nächsten Gegenstände des göttlichen
Willens nicht sowohl moralische Handlungen, als Glaube, Tempelceremonien
und Latreia mancherlei Art ausgegeben werden; ja, allmälig werden die
letzteren, zumal wenn sie mit Emolumenten der Priester verknüpft sind,
auch als Surrogate der ersteren betrachtet. Nimmt man noch dazu die Gräuel
des Fanatismus, der Verfolgungen, Religionskriege, so erscheint der demoralisirende
Einfluß der Religionen weniger problematisch, als der moralisirende.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Religion ist das einzige Mittel, dem rohen Sinn und ungelenken Verstande
der in niedriges Treiben und materielle Arbeit tief eingesenkten Menge
die hohe Bedeutung des Lebens anzukündigen und fühlbar zu machen. Die
Religion ist die Metaphysik des Volkes, die man ihm schlechterdings lassen
und daher sie äußerlich achten muß. Wie es eine Volkspoesie giebt und
in den Sprichwörtern eine Volksweisheit; so muß es auch eine Volksmetaphysik
geben; denn die Menschen bedürfen schlechterdings einer Auslegung des
Lebens, und sie muß ihrer Fassungskraft angemessen sein. Daher ist sie
allemal eine allegorische Einkleidung der Wahrheit, und sie leistet in
praktischer und gemüthlicher Hinsicht, d. h. als Richtschnur für das
Handeln und als Beruhigung und Trost im Leiden und im Tode vielleicht
eben so viel, wie die Wahrheit, wenn wir sie besäßen, selbst leisten
könnte. Die verschiedenen Religionen sind eben nur verschiedene Schemata,
in welchen das Volk die ihm an sich selbst unfaßbare Wahrheit ergreift
und sich vergegenwärtigt, mit welchen sie ihm jedoch unzertrennlich verwächst.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Welt in aller Vielheit ihrer Theile und Gestalten ist die Erscheinung
des einen Willens zum Leben. In jedem Dinge erscheint der Wille gerade
so, wie er sich selbst an sich und außer der Zeit bestimmt. Die Welt
ist nur der Spiegel dieses Wollens, und alle Endlichkeit, alle Leiden,
alle Qualen, welche sie enthält, gehören zum Ausdruck dessen, was er
will, sind so, weil er so will. Mit dem strengsten Rechte trägt sonach
jedes Wesen das Dasein überhaupt, sodann das Dasein seiner Art und seiner
eigenthümlichen Individualität, ganz wie sie ist und unter Umgebungen,
wie sie sind, in einer Welt so wie sie ist, vom Zufall und vom Irrthum
beherrscht, zeitlich, vergänglich, stets leidend; und in Allem, was ihm
widerfährt, geschieht ihm immer Recht. Denn sein ist der Wille; und wie
der Wille ist, so ist die Welt. Jammer und Schuld der Welt halten einander
die Waage.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Geschlechtsliebe spielt nicht bloß in Schauspielen und Romanen, sondern,
wie die Erfahrung bestätigt, auch in der wirklichen Welt eine so bedeutende
Rolle, daß die bei einigen Schriftstellern vorkommende Leugnung der Realität
und Wichtigkeit dieser Leidenschaft ein großer Irrthum ist. Die Erfahrung
zeigt, daß die Geschlechtsliebe unter Umständen zu einer Leidenschaft
anwachsen kann, die an Heftigkeit jede andere übertrifft und dann alle
Rücksichten beseitigt, alle Hindernisse mit unglaublicher Kraft und Ausdauer
überwindet, so daß für ihre Befriedigung unbedenklich das Leben gewagt,
ja, wenn solche schlechterdings versagt bleibt, in den Kauf gegeben wird.
Die Geschlechtsliebe erweist sich, nächst der Liebe zum Leben, als die
stärkste und thätigste aller Triebfedern, nimmt die Hälfte der Kräfte
und Gedanken des jüngern Theiles der Menschheit fortwährend in Anspruch,
ist das letzte Ziel fast jedes menschlichen Bestrebens, erlangt auf die
wichtigsten Angelegenheiten nachtheiligen Einfluß, unterbricht die ernsthaftesten
Beschäftigungen zu jeder Stunde, setzt bisweilen selbst die größten
Köpfe auf eine Weile in Verwirrung, zettelt täglich die verworrensten
und schlimmsten Händel an, löst die werthvollsten Verhältnisse auf,
zerreißt die festesten Bande, nimmt bisweilen Leben, oder Gesundheit,
bisweilen Reichthum, Rang und Glück zu ihrem Opfer, ja macht den sonst
Redlichen gewissenlos, den bisher Treuen zum Verräther, tritt demnach
im Ganzen auf als ein feindseliger Dämon.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Nicht allein die unbefriedigte verliebte Leidenschaft hat bisweilen einen
tragischen Ausgang, sondern auch die befriedigte führt öfter zum Unglück
als zum Glück. Denn ihre Anforderungen collidiren oft so sehr mit der
persönlichen Wohlfahrt des Betheiligten, daß sie solche untergraben,
indem sie mit seinen übrigen Verhältnissen unvereinbar sind und den
darauf gebauten Lebensplan zerstören. Ja, nicht allein mit den äußern
Verhältnissen ist die Liebe oft im Widerspruch, sondern sogar mit der
eigenen Individualität, indem sie sich auf Personen wirft, welche, abgesehen
vom Geschlechtsverhältniß, dem Liebenden verhaßt, ja zum Abscheu sein
würden. Aber so sehr viel mächtiger ist der Wille der Gattung als der
des Individuums, daß der Liebende in seiner Verblendung alle jene ihm
widerlichen Eigenschaften übersieht. — In der That führt der Genius
der Gattung durchweg Krieg mit den schützenden Genien der Individuen,
ist ihr Verfolger und Feind, stets bereit, das persönliche Glück schonungslos
zu zerstören, um seine Zwecke durchzusetzen; ja, das Wohl ganzer Nationen
ist bisweilen das Opfer seiner Laune geworden. Dies Alles beruht darauf,
daß die Gattung, als in welcher die Wurzel unsers Wesens liegt, ein näheres
und früheres Recht auf uns hat, als das Individuum; daher ihre Angelegenheiten
vorgehen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Genitalien sind der eigentliche Brennpunkt des Willens und folglich
der entgegengesetzte Pol des Gehirns, des Repräsentanten der Erkenntniß,
d. i. der andern Seite der Welt, der Welt als Vorstellung. Jene sind das
lebenerhaltende, der Zeit endloses Leben zusichernde Princip; in welcher
Eigenschaft sie bei den Griechen im Phallus, bei den Hindu im Lingam verehrt
wurden, welche also das Symbol der Bejahung des Willens sind. Die Erkenntniß
dagegen giebt die Möglichkeit der Aufhebung des Wollens, der Erlösung
durch Freiheit, der Ueberwindung und Vernichtung der Welt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Im stillen Bewußtsein davon, daß der Stil ein genauer Abdruck der Qualität
des Denkens ist, sucht jeder Mediokre seinen ihm eigenen und natürlichen
Stil zu maskiren. Dies nöthigt ihn zunächst, auf alle Naivetät zu verzichten;
wodurch diese das Vorrecht der überlegenen und sich selbst fühlenden,
daher mit Sicherheit auftretenden Geister bleibt. Jene Alltagsköpfe streben
nach dem Schein, viel mehr und tiefer gedacht zu haben, als der Fall ist.
Sie bringen demnach, was sie zu sagen haben, in gezwungenen, schwierigen
Wendungen, neu geschaffenen Wörtern und weitläuftigen, um den Gedanken
herumgehenden und ihn verhüllenden Perioden vor. Sie schwanken zwischen
dem Bestreben, denselben mitzutheilen, und dem, ihn zu verstecken. Hingegen
sehen wir jeden wirklichen Denker bemüht, seine Gedanken so rein, deutlich,
sicher und kurz, wie nur möglich, auszusprechen. Demgemäß ist Simplicität
stets ein Merkmal nicht allein der Wahrheit, sondern auch des Genies gewesen.
Der Stil erhält die Schönheit vom Gedanken, statt daß bei jenen Scheindenkern
die Gedanken durch den Stil schön werden sollen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Hingegen beweist nichts deutlicher die sekundäre, abhängige, bedingte
Natur des Intellekts, als seine periodische Intermittenz. Im tiefen Schlaf
hört alles Erkennen und Vorstellen gänzlich auf. Allein der Kern unsers
Wesens, das Metaphysische desselben, welches die organischen Funktionen
als ihr primum mobile notwendig voraussetzen, darf nie pausieren, wenn
nicht das Leben aufhören soll, und ist auch, als ein Metaphysisches,
mithin Unkörperliches, keiner Ruhe bedürftig. Daher haben die Philosophen,
welche als diesen metaphysischen Kern eine Seele, d. h. ein ursprünglich
und wesentlich erkennendes Wesen aufstellten, sich zu der Behauptung genötigt
gesehen, daß diese Seele in ihrem Vorstellen und Erkennen ganz unermüdlich
sei, solches mithin auch im tiefsten Schlafe fortsetze; nur daß uns,
nach dem Erwachen, keine Erinnerung davon bliebe. Das Falsche dieser Behauptung
einzusehen wurde aber leicht, sobald man, infolge der Lehre Kants, jene
Seele beiseite gesetzt hatte. Denn Schlaf und Erwachen zeigen dem unbefangenen
Sinn auf das deutlichste daß das Erkennen eine sekundäre und durch den
Organismus bedingte Funktion ist, so gut wie irgend eine andere. Unermüdlich
ist allein das Herz; weil sein Schlag und der Blutumlauf nicht unmittelbar
durch Nerven bedingt, sondern eben die ursprüngliche Aeußerung des Willens
sind. Auch alle andern, bloß durch Gangliennerven, die nur eine sehr
mittelbare und entfernte Verbindung mit dem Gehirn haben, gelenkte, physiologische
Funktionen werden im Schlafe fortgesetzt, wiewohl die Sekretionen langsamer
geschehen: selbst der Herzschlag wird, wegen seiner Abhängigkeit von
der Respiration, als welche durch das Cerebralsystem (medulla oblongata)
bedingt ist, mit dieser ein wenig langsamer. Der Magen ist vielleicht
im Schlaf am thätigsten, welches seinem speziellen, gegenseitige Störungen
veranlassenden Consensus mit dem jetzt feiernden Gehirn zuzuschreiben
ist. Das Gehirn allein, und mit ihm das Erkennen, pausiert im tiefen Schlafe
ganz. Denn es ist bloß das Ministerium des Aeußern, wie das Gangliensystem
das Ministerium des Innern ist. Das Gehirn, mit seiner Funktion des Erkennens,
ist nichts weiter, als eine vom Willen, zu seinen draußen liegenden Zwecken,
aufgestellte Vedette, welche oben, auf der Warte des Kopfes, durch die
Fenster der Sinne umherschaut, aufpaßt, von wo Unheil drohe und wo Nutzen
abzusehen sei, und nach deren Bericht der Wille sich entscheidet. Diese
Vedette ist dabei, wie jeder im aktiven Dienst begriffene, in einem Zustande
der Spannung und Anstrengung, daher sie es gern sieht, wenn sie, nach
verrichteter Wacht, wieder eingezogen wird, wie jede Wache gern wieder
vom Posten abzieht. Dies Abziehen ist das Einschlafen, welches daher so
süß und angenehm ist und zu welchem wir so willfährig sind: hingegen
ist das Aufgerütteltwerden unwillkommen, weil es die Vedette plötzlich
wieder auf den Posten ruft: man fühlt dabei ordentlich die nach der wohlthätigen
Systole wieder eintretende beschwerliche Diastole, das Wiederauseinanderfahren
des Intellekts vom Willen. Einer sogenannten Seele, die ursprünglich
und von Hause aus ein erkennendes Wesen wäre, müßte im Gegenteil beim
Erwachen zu Mute sein, wie dem Fisch, der wieder ins Wasser kommt. Im
Schlafe, wo bloß das vegetative Leben fortgesetzt wird, wirkt der Wille
allein nach seiner ursprünglichen und wesentlichen Natur, ungestört
von außen, ohne Abzug seiner Kraft durch die Thätigkeit des Gehirns
und Anstrengung des Erkennens, welches die schwerste organische Funktion,
für den Organismus aber bloß Mittel, nicht Zweck ist: daher ist im Schlafe
die ganze Kraft des Willens auf Erhaltung und, wo es nötig ist, Ausbesserung
des Organismus gerichtet; weshalb alle Heilung, alle wohlthätigen Krisen,
im Schlaf erfolgen; indem die vis naturae medicatrix erst dann freies
Spiel hat, wann sie von der Last der Erkenntnisfunktion befreiet ist.
Der Embryo, welcher gar erst den Leib noch zu bilden hat, schläft daher
fortwährend und das Neugeborene den größten Teil seiner Zeit. In diesem
Sinne erklärt auch Burdach (Physiologie, Bd. 3, S. 484) ganz richtig
den Schlaf für den ursprünglichen Zustand. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Glänzende Eigenschaften des Geistes erwerben Bewunderung, aber
nicht Zuneigung: diese bleibt den moralischen, den Eigenschaften des Charakters,
vorbehalten. Zu seinem Freunde wird wohl jeder lieber den Redlichen, den
Gutmütigen, ja selbst den Gefälligen, Nachgiebigen und leicht Beistimmenden
wählen, als den bloß Geistreichen. Vor diesem wird sogar durch unbedeutende,
zufällige, äußere Eigenschaften, welche gerade der Neigung eines andern,
entsprechen, mancher den Vorzug gewinnen. Nur wer selbst viel Geist hat,
wird den Geistreichen zu seiner Gesellschaft wünschen; seine Freundschaft
hingegen wird sich nach den moralischen Eigenschaften richten: denn auf
diesen beruht seine eigentliche Hochschätzung eines Menschen, in welcher
ein einziger guter Charakterzug große Mängel des Verstandes bedeckt
und auslischt. Die erkannte Güte eines Charakters macht uns geduldig
und nachgiebig gegen Schwächen des Verstandes, wie auch gegen die Stumpfheit
und das kindische Wesen des Alters. Ein entschieden edler Charakter, bei
gänzlichem Mangel intellektueller Vorzüge und Bildung, steht da, wie
einer, dem nichts abgeht; hingegen wird der größte Geist, wenn mit starken
moralischen Fehlern behaftet, noch immer tadelhaft erscheinen. — Denn
wie Fackeln und Feuerwerk vor der Sonne blaß und unscheinbar werden,
so wird Geist, ja Genie, und ebenfalls die Schönheit, überstrahlt und
verdunkelt von der Güte des Herzens. Wo diese in hohem Grade hervortritt,
kann sie den Mangel jener Eigenschaften so sehr ersetzen, daß man solche
vermißt zu haben sich schämt. Sogar der beschränkteste Verstand, wie
auch die groteske Häßlichkeit, werden, sobald die ungemeine Güte des
Herzens sich in ihrer Begleitung kund gethan, gleichsam verklärt, umstrahlt
von einer Schönheit höherer Art, indem jetzt aus ihnen eine Weisheit
spricht, vor der jede andere verstummen muß. Denn die Güte des Herzens
ist eine transcendente Eigenschaft, gehört einer über dieses Leben hinausreichenden
Ordnung der Dinge an und ist mit jeder andern Vollkommenheit inkommensurabel.
Wo sie in hohem Grade vorhanden ist, macht sie das Herz so groß, daß
es die Welt umfaßt, so daß jetzt alles in ihm, nichts mehr außerhalb
liegt; da sie ja alle Wesen mit dem eigenen identifiziert. Alsdann verleiht
sie auch gegen andere jene grenzenlose Nachsicht, die sonst jeder nur
sich selber widerfahren läßt. Ein solcher Mensch ist nicht fähig, sich
zu erzürnen: sogar wenn etwan seine eigenen, intellektuellen oder körperlichen
Fehler den boshaften Spott und Hohn anderer hervorgerufen haben, wirft
er, in seinem Herzen, nur sich selber vor, zu solchen Aeußerungen der
Anlaß gewesen zu sein, und fährt daher, ohne sich Zwang anzuthun, fort,
jene auf das liebreichste zu behandeln, zuversichtlich hoffend, daß sie
von ihrem Irrtum hinsichtlich seiner zurückkommen und auch in ihm sich
selber wiedererkennen werden. — Was ist dagegen Witz und Genie? was
Baco von Verulam?
Auf dasselbe Ergebnis, welches wir hier aus der Betrachtung unserer Schätzung
anderer erhalten haben, führt auch die der Schätzung des eigenen Selbst.
Wie ist doch die in moralischer Hinsicht eintretende Selbstzufriedenheit
so grundverschieden von der in intellektualer Hinsicht! Die erstere entsteht,
indem wir, beim Rückblick auf unsern Wandel, sehen, daß wir mit schweren
Opfern Treue und Redlichkeit geübt, daß wir manchem geholfen, manchem
verziehen haben, besser gegen andere gewesen sind, als diese gegen uns,
so daß wir mit König Lear sagen dürfen: „Ich bin ein Mann, gegen
den mehr gesündigt worden, als er gesündigt hat“; und vollends wenn
vielleicht gar irgend eine edle That in unserer Rückerinnerung glänzt!
Ein tiefer Ernst wird die stille Freude begleiten, die eine solche Musterung
uns gibt: und wenn wir dabei andere gegen uns zurückstehen sehen; so
wird uns dies in keinen Jubel versetzen, vielmehr werden wir es bedauern
und werden aufrichtig wünschen, sie wären alle wie wir. — Wie ganz
anders wirkt hingegen die Erkenntnis unserer intellektuellen Ueberlegenheit!
Ihr Grundbaß ist ganz eigentlich der oben angeführte Ausspruch des Hobbes:
Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat,
quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso. Uebermütige,
triumphierende Eitelkeit, stolzes, höhnisches Herabsehen auf andere,
wonnevoller Kitzel des Bewußtseins entschiedener und bedeutender Ueberlegenheit,
dem Stolz auf körperliche Vorzüge Verwandt, — das ist hier das Ergebnis.
— Dieser Gegensatz zwischen beiden Arten der Selbstzufriedenheit zeigt
an, daß die eine unser wahres inneres und ewiges Wesen, die andere einen
mehr äußerlichen, nur zeitlichen, ja fast nur körperlichen Vorzug betrifft.
Ist doch in der That der Intellekt die bloße Funktion des Gehirns, der
Wille hingegen das, dessen Funktion der ganze Mensch, seinem Sein und
Wesen nach, ist. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wenn nun von einem Menschen gesagt wird: „er hat ein gutes Herz,
wiewohl einen schlechten Kopf“; von einem andern aber: „er hat einen
sehr guten Kopf, jedoch ein schlechtes Herz;“ so fühlt jeder, daß
beim ersteren das Lob den Tadel weit überwiegt; beim andern umgekehrt.
Dem entsprechend sehen wir, wenn jemand eine schlechte Handlung begangen
hat, seine Freunde und ihn selbst bemüht, die Schuld vom Willen auf den
Intellekt zu wälzen und Fehler des Herzens für Fehler des Kopfes auszugeben;
schlechte Streiche werden sie Verirrungen nennen, werden sagen, es sei
bloßer Unverstand gewesen, Unüberlegtheit, Leichtsinn, Thorheit; ja
sie werden zur Not Paroxysmus, momentane Geistesstörung und, wenn es
ein schweres Verbrechen betrifft, sogar Wahnsinn vorschützen, um nur
den Willen von der Schuld zu befreien. Und ebenso wir selbst, wenn wir
einen Unfall oder Schaden verursacht haben, werden, vor andern und vor
uns selbst, sehr gern unsere stultitia anklagen, um nur dem Vorwurf der
malitia auszuweichen. Dem entsprechend ist, bei gleich ungerechtem Urteil
des Richters, der Unterschied, ob er geirrt habe, oder bestochen gewesen
sei, so himmelweit. Alles dieses bezeugt genugsam, daß der Wille allein
das Wirkliche und das Wesentliche, der Kern des Menschen ist, der Intellekt
aber bloß sein Werkzeug, welches immerhin fehlerhaft sein mag, ohne daß
er dabei beteiligt wäre. Die Anklage des Unverstandes ist, vor dem moralischen
Richterstuhle, ganz und gar keine; vielmehr gibt sie hier sogar Privilegien.
Und ebenso vor den weltlichen Gerichten ist es, um einen Verbrecher von
aller Strafe zu befreien, überall hinreichend, daß man die Schuld von
seinem Willen auf seinen Intellekt wälze, indem man entweder unvermeidlichen
Irrtum, oder Geistesstörung nachweist: denn da hat es nicht mehr auf
sich, als wenn Hand oder Fuß wider Willen ausgeglitten wären. Dies habe
ich ausführlich erörtert in dem meiner Preisschrift über die Freiheit
des Willens beigegebenen Anhang „über die intellektuale Freiheit“,
wohin ich, um mich nicht zu wiederholen, hier verweise.
Ueberall berufen sich die, welche irgend eine Leistung zu Tage fördern,
im Fall solche ungenügend ausfällt, auf ihren guten Willen, an dem es
nicht gefehlt habe. Hiedurch glauben sie das Wesentliche, das, wofür
sie eigentlich verantwortlich sind, und ihr eigentliches Selbst sicher
zu stellen: das Unzureichende der Fähigkeiten hingegen sehen sie an als
den Mangel an einem tauglichen Werkzeug.
Ist einer dumm, so entschuldigt man ihn damit, daß er nicht dafür kann:
aber wollte man den, der schlecht ist, eben damit entschuldigen; so würde
man ausgelacht werden. Und doch ist das eine, wie das andere, angeboren.
Dies beweist, daß der Wille der eigentliche Mensch ist, der Intellekt
bloß sein Werkzeug.
Immer also ist es nur unser Wollen, was als von uns abhängig, d. h. als
Aeußerung unsers eigentlichen Wesens betrachtet wird und wofür man uns
daher verantwortlich macht. Dieserhalb eben ist es absurd und ungerecht,
wenn man uns für unsern Glauben, also für unsere Erkenntnis, zur Rede
stellen will: denn wir sind genötigt diese, obschon sie in uns waltet,
anzusehen als etwas, das so wenig in unserer Gewalt steht, wie die Vorgänge
der Außenwelt. Auch hieran also wird deutlich, daß der Wille allein
das Innere und Eigene des Menschen ist, der Intellekt hingegen, mit seinen,
gesetzmäßig wie die Außenwelt vor sich gehenden Operationen, zu jenem
sich als ein Aeußeres, ein bloßes Werkzeug verhält.
Hohe Geistesgaben hat man allezeit angesehen als ein Geschenk der Natur,
oder der Götter: ebendeshalb hat man sie Gaben, Begabung, ingenii dotes,
gifts (a man highly gifted) genannt, sie betrachtend als etwas vom Menschen
selbst Verschiedenes, ihm durch Begünstigung Zugefallenes. Nie hingegen
hat man es mit den moralischen Vorzügen, obwohl auch sie angeboren sind,
ebenso genommen: vielmehr hat man diese stets angesehen als etwas vom
Menschen selbst Ausgehendes, ihm wesentlich Angehöriges, ja, sein eigenes
Selbst Ausmachendes. Hieraus nun folgt abermals, daß der Wille das eigentliche
Wesen des Menschen ist, der Intellekt hingegen sekundär, ein Werkzeug,
eine Ausstattung.
Diesem entsprechend verheißen alle Religionen für die Vorzüge des Willens,
oder Herzens, einen Lohn jenseit des Lebens, in der Ewigkeit; keine aber
für die Vorzüge des Kopfes, des Verstandes. Die Tugend erwartet ihren
Lohn in jener Welt; die Klugheit hofft ihn in dieser; das Genie weder
in dieser, noch in jener: es ist sein eigener Lohn. Demnach ist der Wille
der ewige Teil, der Intellekt der zeitliche. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die einzige entschiedene, unmittelbare Hemmung und Störung, die
der Wille vom Intellekt als solchem erleiden kann, möchte wohl die ganz
exceptionelle sein, welche die Folge einer abnorm überwiegenden Entwickelung
des Intellekts, also derjenigen hohen Begabung ist, die man als Genie
bezeichnet. Eine solche nämlich ist der Energie des Charakters und folglich
der Thatkraft entschieden hinderlich. Daher eben sind es nicht die eigentlich
großen Geister, welche die historischen Charaktere abgeben, indem sie,
die Masse der Menschheit zu lenken und zu beherrschen fähig, die Welthändel
durchkämpften; sondern hiezu taugen Leute von viel geringerer Kapazität
des Geistes, aber großer Festigkeit, Entschiedenheit und Beharrlichkeit
des Willens, wie sie bei sehr hoher Intelligenz gar nicht bestehen kann;
bei welcher demnach wirklich der Fall eintritt, daß der Intellekt den
Willen direkt hemmt. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Liebe und Haß verfälschen unser Urteil gänzlich: an unsern Feinden
sehen wir nichts, als Fehler, an unsern Lieblingen lauter Vorzüge, und
selbst ihre Fehler scheinen uns liebenswürdig. Eine ähnliche geheime
Macht übt unser Vorteil, welcher Art er auch sei, über unser Urteil
aus: was ihm gemäß ist, erscheint uns alsbald billig, gerecht, vernünftig;
was ihm zuwiderläuft, stellt sich uns, im vollen Ernst, als ungerecht
und abscheulich, oder zweckwidrig und absurd dar. Daher so viele Vorurteile
des Standes, des Gewerbes, der Nation, der Sekte, der Religion. Eine gefaßte
Hypothese gibt uns Luchsaugen für alles sie Bestätigende, und macht
uns blind für alles ihr Widersprechende. Was unserer Partei, unserm Plane,
unserm Wunsche, unsrer Hoffnung entgegensteht, können wir oft gar nicht
fassen und begreifen, während es allen andern klar vorliegt: das jenen
Günstige hingegen springt uns von ferne in die Augen. Was dem Herzen
widerstrebt, läßt der Kopf nicht ein. Manche Irrtümer halten wir unser
Leben hindurch fest, und hüten uns, jemals ihren Grund zu prüfen, bloß
aus einer uns selber unbewußten Furcht, die Entdeckung machen zu können,
daß wir so lange und so oft das Falsche geglaubt und behauptet haben.
— So wird denn täglich unser Intellekt durch die Gaukeleien der Neigung
bethört und bestochen. Sehr schön hat dies Baco von Verulam ausgedrückt
in den Worten: lntellectus luminis sicci non est; sed recipit infusionem
a voluntate et affectibus: id quod generat ad quod vult scientias: quod
enim mavult homo, id potius credit. Innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus,
affectus intellectum imbuit et inficit (Org. nov. l., 14). Offenbar ist
es auch dieses, was allen neuen Grundansichten in den Wissenschaften und
allen Widerlegungen sanktionierter Irrtümer entgegensteht: denn nicht
leicht wird einer die Richtigkeit dessen einsehen; was ihn unglaublicher
Gedankenlosigkeit überführt. Hieraus allein ist es erklärlich, daß
die so klaren und einfachen Wahrheiten der Goetheschen Farbenlehre von
den Physikern noch immer geleugnet werden; wodurch denn selbst Goethe
hat erfahren müssen, einen wie viel schwereren Stand man hat, wenn man
den Menschen Belehrung, als wenn man ihnen Unterhaltung verheißt; daher
es viel glücklicher ist, zum Poeten, als zum Philosophen geboren zu sein.
Je hartnäckiger aber nun andererseits ein Irrtum festgehalten wurde,
desto beschämender wird nachher die Ueberführung. Bei einem umgestoßenen
System wie bei einer geschlagenen Armee, ist der Klügste, wer zuerst
davonläuft.
Von jener geheimen und unmittelbaren Gewalt, welche der Wille über den
Intellekt ausübt, ist ein kleinliches und lächerliches, aber frappantes
Beispiel dieses, daß wir, bei Rechnungen, uns viel öfter zu unserm Vorteil,
als zu unserm Nachteil verrechnen, und zwar ohne die mindeste unredliche
Absicht, bloß durch den unbewußten Hang, unser Debet zu verkleinern
und unser Credit zu vergrößern.
Hieher gehört endlich noch die Thatsache, daß, bei einem zu erteilenden
Rat, die geringste Absicht des Beraters meistens seine auch noch so große
Einsicht überwiegt; daher wir nicht annehmen dürfen, daß er aus dieser
spreche, wo wir jene vermuten. Wie wenig, selbst von sonst redlichen Leuten,
vollkommene Aufrichtigkeit zu erwarten steht, sobald ihr Interesse irgendwie
dabei im Spiel ist, können wir eben daran ermessen, daß wir so oft uns
selbst belügen, wo Hoffnung uns besticht, oder Furcht bethört, oder
Argwohn uns quält, oder Eitelkeit uns schmeichelt, oder eine Hypothese
uns verblendet, oder ein naheliegender kleiner Zweck dem größeren, aber
entfernteren, Abbruch thut: denn daran sehen wir den unmittelbaren und
unbewußten nachteiligen Einfluß des Willens auf die Erkenntnis. Demnach
darf es uns nicht wundern, wenn, bei Fragen um Rat, der Wille des Befragten
unmittelbar die Antwort diktiert, ehe die Frage auch nur bis zum Forum
seines Urteils durchdringen konnte.
Nur mit einem Worte will ich hier auf dasjenige deuten, was im folgenden
Buche ausführlich erörtert wird, daß nämlich die vollkommenste Erkenntnis,
also die rein objektive, d. h. die geniale Auffassung der Welt, bedingt
ist durch ein so tiefes Schweigen des Willens, daß, so lange sie anhält,
sogar die Individualität aus dem Bewußtsein verschwindet und der Mensch
als reines Subjekt des Erkennens, welches das Korrelat der Idee ist, übrig
bleibt.
Der durch alle jene Phänomene belegte, störende Einfluß des Willens
auf den Intellekt, und dagegen die Zartheit und Hinfälligkeit dieses,
vermöge deren er unfähig wird, richtig zu operieren, sobald der Wille
irgendwie in Bewegung gerät, gibt uns also einen abermaligen Beweis davon,
daß der Wille das Radikale unsers Wesens sei und mit ursprünglicher
Gewalt wirke, während der Intellekt, als ein Hinzugekommenes und vielfach
Bedingtes, nur sekundär und bedingterweise wirken kann. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wenn, wie zu hoffen ist, die Menschheit dereinst auf den Punkt der Reife
und Bildung gelangen wird, wo sie die wahre Philosophie einerseits hervorzubringen
und andererseits aufzunehmen vermag, dann wird die Wahrheit in einfacher
und faßlicher Gestalt die Religion von dem Platze herunterstoßen, den
sie so lange vikarirend eingenommen, aber eben dadurch jener offen gehalten
hatte. Dann wird die Religion ihren Beruf erfüllt und ihre Bahn durchlaufen
haben; sie kann dann das bis zur Mündigkeit geleitete Geschlecht entlassen,
selbst aber in Frieden dahinscheiden. Das wird die Euthanasie der Religion
sein.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Gottesglaube (Theismus) wurzelt im Egoismus. Er ist kein Erzeugniß
der Erkenntniß, sondern des Willens. Wenn er ursprünglich theoretisch
wäre, wie könnten denn alle seine Beweise so unhaltbar sein? Die Noth,
das beständige Fürchten und Hoffen, bringt den Menschen dahin, daß
er die Hypostase persönlicher Wesen macht, zu denen er beten könne.
Sind Anfangs der Götter mehrere, so werden sie später durch das Bedürfniß,
Consequenz, Ordnung und Einheit in die Erkenntniß zu bringen, Einem unterworfen,
oder gar auf Einen reducirt. Das Wesentliche jedoch ist der Drang des
geängsteten Menschen, sich niederzuwerfen und Hülfe anzuflehen. Damit
also sein Herz (Wille) die Erleichterung des Betens und den Trost des
Hoffens habe, muß sein Intellect ihm einen Gott schaffen; nicht aber
umgekehrt, weil sein Intellect auf einen Gott logisch richtig geschlossen
hat, betet er.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Alle Beweise für die Fortdauer nach dem Tode lassen sich eben so gut
in partem ante wenden, wo sie dann das Dasein vor dem Leben demonstriren,
in dessen Annahme Hindu und Buddhaisten sich daher sehr consequent beweisen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Hoffnung ist ein Affect, in ihr übt daher, wie in allen Affecten,
der Wille einen verfälschenden Einfluß auf den Intellect. Die Hoffnung
läßt uns Das, was wir wünschen, so wie die Furcht Das, was wir besorgen,
als wahrscheinlich und nahe erblicken, und beide vergrößern ihren Gegenstand.
Plato hat sehr schön die Hoffnung den Traum des Wachenden genannt. Ihr
Wesen liegt darin, daß der Wille seinen Diener, den Intellect, wenn dieser
nicht vermag, das Gewünschte herbeizuschaffen, nöthigt, es ihm wenigstens
vorzumalen, überhaupt die Rolle des Trösters zu übernehmen, seinen
Herrn, wie die Amme das Kind, mit Mährchen zu beschwichtigen und diese
aufzustutzen, daß sie Schein gewinnen; wobei nun der Intellect seiner
eigenen Natur, die auf Wahrheit gerichtet ist, Gewalt anthun muß.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Höflichkeit ist die conventionelle und systematische Verleugnung
des Egoismus in den Kleinigkeiten des täglichen Verkehrs und ist freilich
anerkannte Heuchelei; dennoch wird sie gefordert und gelobt, weil, was
sie verbirgt, der Egoismus so garstig ist, daß man es nicht sehen will,
obschon man weiß, daß es da ist, wie man widerliche Gegenstände wenigstens
durch einen Vorhang bedeckt wissen will.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die Verschiedenheit der ganzen Art des Daseins, welche die Extreme
der Gradation der intellektuellen Fähigkeiten zwischen Mensch und Mensch
feststellen, ist so groß, daß die zwischen König und Tagelöhner dagegen
gering erscheint. Und auch hier ist, wie bei den Tiergeschlechtern, ein
Zusammenhang zwischen der Vehemenz des Willens und der Steigerung des
Intellekts nachweisbar. Genie ist durch ein leidenschaftliches Temperament
bedingt, und ein phlegmatisches Genie ist undenkbar: es scheint, daß
ein überaus heftiger, also gewaltig verlangender Wille da sein mußte,
wenn die Natur einen abnorm erhöhten Intellekt, als jenem angemessen,
dazugeben sollte; während die bloß physische Rechenschaft hierüber
auf die größere Energie, mit der die Arterien des Kopfes das Gehirn
bewegen und die Turgescenz desselben vermehren, hinweist. Freilich aber
ist die Quantität, Qualität und Form des Gehirns selbst die andere und
ungleich seltenere Bedingung des Genies. Andererseits sind die Phlegmatici
in der Regel von sehr mittelmäßigen Geisteskräften; und ebenso stehen
die nördlichen, kaltblütigen und phlegmatischen Völker, im allgemeinen,
den südlichen, lebhaften und leidenschaftlichen an Geist merklich nach;
obgleich, wie Baco*) überaus treffend bemerkt hat, wenn einmal ein Nordländer
von der Natur hochbegabt wird, dies alsdann einen Grad erreichen kann,
bis zu welchem kein Südländer je gelangt. Demnach ist es so verkehrt
als gewöhnlich, zum Maßstab der Vergleichung der Geisteskräfte verschiedener
Nationen die großen Geister derselben zu nehmen: denn das heißt, die
Regel durch die Ausnahmen begründen wollen. Vielmehr ist es die große
Pluralität jeder Nation, die man zu betrachten hat: denn eine Schwalbe
macht keinen Sommer. — Noch ist hier zu bemerken, daß eben die Leidenschaftlichkeit,
welche Bedingung des Genies ist, mit seiner lebhaften Auffassung der Dinge
verbunden, im praktischen Leben, wo der Wille ins Spiel kommt, zumal bei
plötzlichen Ereignissen, eine so große Aufregung der Affekte herbeiführt,
daß sie den Intellekt stört und verwirrt; während der Phlegmatikus
auch dann noch den vollen Gebrauch seiner, wenngleich viel geringern,
Geisteskräfte behält und damit alsdann viel mehr leistet, als das größte
Genie vermag. Sonach begünstigt ein leidenschaftliches Temperament die
ursprüngliche Beschaffenheit des Intellekts, ein Phlegmatisches aber
dessen Gebrauch. Deshalb ist das eigentliche Genie durchaus nur zu theoretischen
Leistungen, als zu welchen es seine Zeit wählen und abwarten kann; welches
gerade die sein wird, wo der Wille gänzlich ruht und keine Welle den
reinen Spiegel der Weltauffassung trübt: hingegen ist zum praktischen
Leben das Genie ungeschickt und unbrauchbar, daher auch meistens unglücklich.
In diesem Sinn ist Goethes Tasso gedichtet. Wie nun das eigentliche Genie
auf der absoluten Stärke des Intellekts beruht, welche durch eine ihr
entsprechende, übermäßige Heftigkeit des Gemüts erkauft werden muß;
so beruht hingegen die große Ueberlegenheit im praktischen Leben, welche
Feldherren und Staatsmänner macht, auf der relativen Stärke des Intellekts,
nämlich auf dem höchsten Grad desselben, der ohne eine zu große Erregbarkeit
der Affekte, nebst zu großer Heftigkeit des Charakters erreicht werden
kann und daher auch im Sturm noch standhält. Viel Festigkeit des Willens
und Unerschütterlichkeit des Gemüts, bei einem tüchtigen und feinen
Verstande, reicht hier aus; und was darüber hinausgeht, wirkt schädlich:
denn die zu große Entwickelung der Intelligenz steht der Festigkeit des
Charakters und Entschlossenheit des Willens geradezu im Wege. Deshalb
ist auch diese Art der Eminenz nicht so abnorm und ist hundertmal weniger
selten, als jene andere: demgemäß sehen wir große Feldherren und große
Minister zu allen Zeiten, sobald nur die äußern Umstände ihrer Wirksamkeit
günstig sind, auftreten. Große Dichter und Philosophen hingegen lassen
Jahrhunderte auf sich warten: doch kann die Menschheit auch an diesem
seltenen Erscheinen derselben sich genügen lassen; da ihre Werke bleiben
und nicht bloß für die Gegenwart da sind, wie die Leistungen jener anderen.
— Dem oben erwähnten Gesetze der Sparsamkeit der Natur ist es auch
völlig gemäß, daß sie die geistige Eminenz überhaupt höchst wenigen,
und das Genie nur als die seltenste aller Ausnahmen erteilt, den großen
Haufen des Menschengeschlechts aber mit nicht mehr Geisteskräften ausstattet,
als die Erhaltung des Einzelnen und der Gattung erfordert. Denn die großen
und, durch ihre Befriedigung selbst, sich beständig vermehrenden Bedürfnisse
des Menschengeschlechts machen es notwendig, daß der bei weitem größte
Teil desselben sein Leben mit grob körperlichen und ganz mechanischen
Arbeiten zubringt: wozu sollte nun diesem ein lebhafter Geist, eine glühende
Phantasie, ein subtiler Verstand, ein tief eindringender Scharfsinn nutzen?
Dergleichen würde die Leute nur untauglich und unglücklich machen. Daher
also ist die Natur mit dem kostbarsten aller ihrer Erzeugnisse am wenigsten
verschwenderisch umgegangen. Von diesem Gesichtspunkt aus sollte man auch,
um nicht unbillig zu urteilen, seine Erwartungen von den geistigen Leistungen
der Menschen überhaupt feststellen und z. B. auch Gelehrte, da in der
Regel bloß äußere Veranlassungen sie zu solchen gemacht haben, zunächst
betrachten als Männer, welche die Natur eigentlich zum Ackerbau bestimmt
hatte: ja, selbst Philosophieprofessoren sollte man nach diesem Maßstabe
abschätzen und wird dann ihre Leistungen allen billigen Erwartungen entsprechend
finden. — Beachtenswert ist es, daß im Süden, wo die Not des Lebens
weniger schwer auf dem Menschengeschlechte lastet und mehr Muße gestattet,
auch die geistigen Fähigkeiten, selbst der Menge, sogleich regsamer und
feiner werden. —
*) De augm. scient., L. Vl, e. 3. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
So wie bei jeder ungerechten Handlung das Unrecht zwar der Qualität nach
dasselbe ist, nämlich Verletzung eines Andern (sei es an seiner Person,
oder Freiheit, oder Eigenthum, oder Ehre), aber der Quantität nach sehr
verschieden sein kann; eben so verhält es sich mit der Gerechtigkeit
der Handlungen. Der Reiche z. B., welcher seinen Tagelöhner bezahlt,
handelt gerecht; aber wie klein ist diese Gerechtigkeit gegen die eines
Armen, der eine gefundene Goldbörse dem Reichen freiwillig zurückbringt.
Das Maaß der so bedeutenden Verschiedenheit in der Quantität der Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit ist kein directes und absolutes, wie das auf dem Maaßstabe,
sondern ein mittelbares und relatives, wie das der Sinus und Tangenten.
Es läßt sich dafür folgende Formel aufstellen: die Größe der Ungerechtigkeit
meiner Handlung ist gleich der Größe des Uebels, welches ich einem Andern
dadurch zufüge, dividirt durch die Größe des Vortheils, den ich selbst
dadurch erlange; — und die Größe der Gerechtigkeit meiner Handlung
ist gleich der Größe des Vortheils, den mir die Verletzung des Andern
bringen würde, dividirt durch die Größe des Schadens, den er dadurch
erleiden würde.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der höchste Grad der Gerechtigkeit der Gesinnung (deren Vorsatz es ist,
in der Bejahung des eigenen Willens nicht so weit zu gehen, daß man die
fremden Willenserscheinungen verneint, indem man sie dem eigenen zu dienen
zwingt), geht so weit, daß man seine Rechte auf ererbtes Eigenthum in
Zweifel zieht, den Leib nur durch die eigenen Kräfte, geistige oder körperliche,
erhalten will, jede fremde Dienstleistung, jeden Luxus als einen Vorwurf
empfindet und zuletzt zur freiwilligen Armuth greift. Pascal z. B. wollte
keine Bedienung mehr leiden, obgleich er Dienerschaft genug hatte. Manche
Hindu, sogar Radschas, verwenden ihren Reichthum nur zum Unterhalt der
Ihrigen, ihres Hofes und ihrer Dienerschaft, und befolgen mit strenger
Scrupulosität die Maxime, nichts zu essen, als was sie selbst eigenhändig
gesäet und geerndtet haben. Ein gewisses Mißverständniß liegt dabei
doch zum Grunde; denn der Einzelne kann, gerade weil er reich und mächtig
ist, dem Ganzen der menschlichen Gesellschaft so beträchtliche Dienste
leisten, daß sie dem ererbten Reichthum gleichwiegen, dessen Sicherung
er der Gesellschaft verdankt. Eigentlich ist jene übermäßige Gerechtigkeit
schon mehr als Gerechtigkeit, nämlich wirklich Entsagung, Verneinung
des Willens zum Leben, Askese.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Dem in der Erkenntniß, welche dem Satz vom Grunde folgt, in dem principio
individuationis befangenen Blick des rohen Individuums, d. h. dem Blick,
der statt in aller Erscheinung das eine Wesen an sich der Dinge zu erfassen,
nur an den einzelnen, in Zeit und Raum (dem principio individuationis)
gesonderten, getrennten, unzählbaren, sehr verschiedenen, ja entgegengesetzten
Erscheinungen kleben bleibt, — diesem, wie die Inder sagen, durch den
Schleier der Maja getrübten Blick entgeht die ewige Gerechtigkeit; er
vermißt sie, wenn er sie nicht etwa durch Fictionen rettet. Er sieht
den Bösen nach Unthaten und Grausamkeiten aller Art in Freuden leben
und unangefochten aus der Welt gehen. Er sieht den Unterdrückten ein
Leben voll Leiden bis ans Ende schleppen, ohne daß sich ein Rächer,
ein Vergelter zeige. Dieser Mensch erscheint ihm als Peiniger und Mörder,
jener als Dulder und Opfer. Den Einen sieht er in Freuden, Ueberfluß
und Wollüsten leben, den Andern vor dessen Thüre durch Mangel und Kälte
qualvoll sterben. Da frägt er: wo bleibt die Vergeltung. Er würde so
nicht fragen, wenn er erkennte: die Person ist bloße Erscheinung, und
ihre Verschiedenheit von andern Individuen und das Freisein von den Leiden,
welche diese tragen, beruht auf der Form der Erscheinung, dem principio
individuationis; dem wahren Wesen der Dinge nach hat Jeder alle Leiden
der Welt als die seinigen zu betrachten. — Die ewige Gerechtigkeit wird
nur Der begreifen und fassen, der über die an die einzelnen Erscheinungen
gebundene Erkenntniß sich erhebt und das principium individuationis durchschaut.
Diesem wird es deutlich, daß, weil der Wille das Ansich aller Erscheinung
ist, die über Andere verhängte und die selbsterfahrene Qual, das Böse
und das Uebel, immer nur jenes Eine und selbe Wesen treffen, wenngleich
die Erscheinungen, in welchen das Eine und das Andere sich darstellt,
als ganz verschiedene Individuen dastehen. Er sieht ein, daß die Verschiedenheit
zwischen Dem, der das Leiden verhängt, und Dem, welcher es dulden muß,
nur Phänomen ist und nicht das Ding an sich trifft, welches der in beiden
lebende Wille ist, der hier, durch die an seinen Dienst gebundene Erkenntniß
getäuscht, sich selbst verkennt, in einer seiner Erscheinungen gesteigertes
Wohlsein suchend, in der andern großes Leiden hervorbringt und so die
Zähne in sein eigenes Fleisch schlägt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Alle Pfuscher sind es, im letzten Grunde, dadurch, daß ihr Intellekt,
dem Willen noch zu fest verbunden, nur unter dessen Anspornung in Thätigkeit
gerät, und daher eben ganz in dessen Dienste bleibt. Sie sind demzufolge
keiner andern, als persönlicher Zwecke fähig. Diesen gemäß schaffen
sie schlechte Gemälde, geistlose Gedichte, seichte, absurde, sehr oft
auch unredliche Philosopheme, wann es nämlich gilt, durch fromme Unredlichkeit,
sich hohen Vorgesetzten zu empfehlen. All ihr Thun und Denken ist also
persönlich. Daher gelingt es ihnen höchstens, sich das Aeußere, Zufällige
und Beliebige fremder, echter Werke als Manier anzueignen, wo sie dann,
statt des Kerns, die Schale fassen, jedoch vermeinen, alles erreicht,
ja, jene übertroffen zu haben. Wird dennoch das Mißlingen offenbar;
so hofft mancher, es durch seinen guten Willen am Ende doch zu erreichen.
Aber gerade dieser gute Wille macht es unmöglich; weil derselbe doch
nur auf persönliche Zwecke hinausläuft: bei solchen aber kann es weder
mit Kunst, noch Poesie, noch Philosophie je Ernst werden. Auf jene paßt
daher ganz eigentlich die Redensart: sie stehen sich selbst im Lichte.
Ihnen ahndet es nicht, daß allein der von der Herrschaft des Willens
und allen seinen Projekten losgerissene und dadurch frei thätige Intellekt,
weil nur er den wahren Ernst verleiht, zu echten Produktionen befähigt:
und das ist gut für sie; sonst sprängen sie ins Wasser. — Der gute
Wille ist in der Moral alles; aber in der Kunst ist er nichts: da gilt,
wie schon das Wort andeutet, allein das Können. — Alles kommt zuletzt
darauf an, wo der eigentliche Ernst des Menschen liegt. Bei fast allen
liegt er ausschließlich im eigenen Wohl und dem der Ihrigen; daher sie
dies und nichts anderes zu fördern im stande sind; weil eben kein Vorsatz,
keine willkürliche und absichtliche Anstrengung, den wahren, tiefen,
eigentlichen Ernst verleiht, oder ersetzt, oder richtiger verlegt. Denn
er bleibt stets da, wo die Natur ihn hingelegt hat: ohne ihn aber kann
alles nur halb betrieben werden. Daher sorgen, aus demselben Grunde, geniale
Individuen oft schlecht für ihre eigene Wohlfahrt. Wie ein bleiernes
Anhängsel einen Körper immer wieder in die Lage zurück bringt, die
sein durch dasselbe determinierter Schwerpunkt erfordert; so zieht der
wahre Ernst des Menschen die Kraft und Aufmerksamkeit seines Intellekts
immer dahin zurück, wo er liegt: alles andere treibt der Mensch ohne
wahren Ernst. Daher sind allein die höchst seltenen, abnormen Menschen,
deren wahrer Ernst nicht im Persönlichen und Praktischen, sondern im
Objektiven und Theoretischen liegt, im stande, das Wesentliche der Dinge
und der Welt, also die höchsten Wahrheiten, aufzufassen und in irgend
einer Art und Weise wiederzugeben. Denn ein solcher außerhalb des Individui,
in das Objektive fallender Ernst desselben ist etwas der menschlichen
Natur Fremdes, etwas Unnatürliches, eigentlich Uebernatürliches: jedoch
allein durch ihn ist ein Mensch groß, und demgemäß wird alsdann sein
Schaffen einem von ihm verschiedenen Genius zugeschrieben, der ihn in
Besitz nehme. Einem solchen Menschen ist sein Bilden, Dichten oder Denken
Zweck, den übrigen ist es Mittel. Diese suchen dabei ihre Sache, und
wissen, in der Regel, sie wohl zu fördern, da sie sich den Zeitgenossen
anschmiegen, bereit, den Bedürfnissen und Launen derselben zu dienen:
daher leben sie meistens in glücklichen Umständen; jener oft in sehr
elenden. Denn sein persönliches Wohl opfert er dem objektiven Zweck:
er kann eben nicht anders; weil dort sein Ernst liegt. Sie halten es umgekehrt:
darum sind sie klein; er aber ist groß. Demgemäß ist sein Werk für
alle Zeiten, aber die Anerkennung desselben fängt meistens erst bei der
Nachwelt an: sie leben und sterben mit ihrer Zeit. Groß überhaupt ist
nur der, welcher bei seinem Wirken, dieses sei nun ein praktisches, oder
ein theoretisches, nicht seine Sache sucht; sondern allein einen objektiven
Zweck verfolgt: er ist es aber selbst dann noch, wann, im Praktischen,
dieser Zweck ein mißverstandener, und sogar wenn er, infolge davon, ein
Verbrechen sein sollte. Daß er nicht sich und seine Sache sucht, dies
macht ihn, unter allen Umständen, groß. Klein hingegen ist alles auf
persönliche Zwecke gerichtete Treiben; weil der dadurch in Thätigkeit
Versetzte sich nur in seiner eigenen, verschwindend kleinen Person erkennt
und findet. Hingegen wer groß ist, erkennt sich in Allem und daher im
Ganzen: er lebt nicht, wie jener, allein im Mikrokosmos, sondern noch
mehr im Makrokosmos. Darum eben ist das Ganze ihm angelegen, und er sucht
es zu erfassen, um es darzustellen, oder um es zu erklären, oder um praktisch
darauf zu wirken. Denn ihm ist es nicht fremd; er fühlt, daß es ihn
angeht. Wegen dieser Ausdehnung seiner Sphäre nennt man ihn groß. Demnach
gebührt nur dem wahren Helden, in irgend einem Sinn, und dem Genie jenes
erhabene Prädikat: es besagt, daß sie, der menschlichen Natur entgegen,
nicht ihre eigene Sache gesucht, nicht für sich, sondern für alle gelebt
haben. — Wie nun offenbar die allermeisten stets klein sein müssen
und niemals groß sein können; so ist doch das Umgekehrte nicht möglich,
daß nämlich einer durchaus, d. h. stets und jeden Augenblick, groß
sei:
Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht,
Und die Gewohnheit nennt er seine Amme.
Jeder große Mann nämlich muß dennoch oft nur das Individuum sein, nur
sich im Auge haben, und das heißt klein sein. Hierauf beruht die sehr
richtige Bemerkung, daß kein Held es vor seinem Kammerdiener bleibt;
nicht aber darauf, daß der Kammerdiener den Helden nicht zu schätzen
verstehe; — welches Goethe, in den „Wahlverwandtschaften“ (Bd. 2,
Kap. 5), als Einfall der Ottilie auftischt. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Der Stempel der Gewöhnlichkeit, der Ausdruck von Vulgarität, welcher
den allermeisten Gesichtern aufgedrückt ist, besteht eigentlich darin,
daß die strenge Unterordnung ihres Erkennens unter ihr Wollen, die feste
Kette, welche beide zusammenschließt, und die daraus folgende Unmöglichkeit,
die Dinge anders als in Beziehung auf den Willen und seine Zwecke aufzufassen,
darin sichtbar ist. Hingegen liegt der Ausdruck des Genies, welcher die
augenfällige Familienähnlichkeit aller Hochbegabten ausmacht, darin,
daß man das Losgesprochensein, die Manumission des Intellekts vom Dienste
des Willens, das Vorherrschen des Erkennens über das Wollen, deutlich
darauf liest: und weil alle Pein aus dem Wollen hervorgeht, das Erkennen
hingegen an und für sich schmerzlos und heiter ist; so gibt dies ihren
hohen Stirnen und ihrem klaren, schauenden Blick, als welche dem Dienste
des Willens und seiner Not nicht unterthan sind, jenen Anstrich großer,
gleichsam überirdischer Heiterkeit, welcher zu Zeiten durchbricht und
sehr wohl mit der Melancholie der übrigen Gesichtszüge, besonders des
Mundes, zusammenbesteht, in dieser Beziehung aber treffend bezeichnet
werden kann durch das Motto des Jordanus Brunus: In tristitia hilaris,
in hilaritate tristis.
Der Wille, welcher die Wurzel des Intellekts ist, widersetzt sich jeder
auf irgend etwas anderes als seine Zwecke gerichteten Thätigkeit desselben.
Daher ist der Intellekt einer rein objektiven und tiefen Auffassung der
Außenwelt nur dann fähig, wann er sich von dieser seiner Wurzel wenigstens
einstweilen abgelöst hat. So lange er derselben noch verbunden bleibt,
ist er aus eigenen Mitteln gar keiner Thätigkeit fähig, sondern schläft
in Dumpfheit, so oft der Wille (das Interesse) ihn nicht weckt und in
Bewegung setzt. Geschieht dies jedoch, so ist er zwar sehr tauglich, dem
Interesse des Willens gemäß, die Relationen der Dinge zu erkennen, wie
dies der kluge Kopf thut, der immer auch ein aufgeweckter, d. h. vom Wollen
lebhaft erregter Kopf sein muß; aber er ist eben deshalb nicht fähig,
das rein objektive Wesen der Dinge zu erfassen. Denn das Wollen und die
Zwecke machen ihn so einseitig, daß er an den Dingen nur das sieht, was
sich darauf bezieht, das übrige aber teils verschwindet, teils verfälscht
ins Bewußtsein tritt. So wird z. B. ein in Angst und Eile Reisender den
Rhein mit seinen Ufern nur als einen Querstrich, die Brücke darüber
nur als einen diesen schneidenden Strich sehen. Im Kopfe des von seinen
Zwecken erfüllten Menschen sieht die Welt aus, wie eine schöne Gegend
auf einem Schlachtfeldplan aussieht. Freilich sind dies Extreme, der Deutlichkeit
wegen genommen: allein auch jede nur geringe Erregung des Willens wird
eine geringe, jedoch stets jenen analoge Verfälschung der Erkenntnis
zur Folge haben. In ihrer wahren Farbe und Gestalt, in ihrer ganzen und
richtigen Bedeutung kann die Welt erst dann hervortreten, wann der Intellekt,
des Wollens ledig, frei über den Objekten schwebt und ohne vom Willen
angetrieben zu sein, dennoch energisch thätig ist. Allerdings ist dies
der Natur und Bestimmung des Intellekts entgegen, also gewissermaßen
widernatürlich, daher eben überaus selten: aber gerade hierin liegt
das Wesen des Genies, als bei welchem allein jener Zustand in hohem Grade
und anhaltend stattfindet, während er bei den übrigen nur annäherungs-
und ausnahmsweise eintritt. — In dem hier dargelegten Sinne nehme ich
es, wenn Jean Paul („Vorschule der Aesthetik“, § 12) das Wesen des
Genies in die Besonnenheit setzt. Nämlich der Normalmensch ist in den
Strudel und Tumult des Lebens, dem er durch seinen Willen angehört, eingesenkt:
sein Intellekt ist erfüllt von den Dingen und den Vorgängen des Lebens:
aber diese Dinge und das Leben selbst, in objektiver Bedeutung, wird er
gar nicht gewahr; wie der Kaufmann auf der Amsterdamer Börse vollkommen
vernimmt, was sein Nachbar sagt, aber das dem Rauschen des Meeres ähnliche
Gesumme der ganzen Börse, darüber der entfernte Beobachter erstaunt,
gar nicht hört. Dem Genie hingegen, dessen Intellekt vom Willen, also
von der Person, abgelöst ist, bedeckt das diese Betreffende nicht die
Welt und die Dinge selbst; sondern es wird ihrer deutlich inne, es nimmt
sie, an und für sich selbst, in objektiver Anschauung, wahr: in diesem
Sinne ist es besonnen. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Was endlich das, besonders durch die überall so geistesverderbliche
und verdummende Hegelsche Afterphilosophie aufgekommene Bestreben, die
Weltgeschichte als ein planmäßiges Ganzes zu fassen, oder, wie sie es
nennen, „sie organisch zu konstruieren“, betrifft; so liegt demselben
eigentlich ein roher und platter Realismus zum Grunde, der die Erscheinung
für das Wesen an sich der Welt hält und vermeint, auf sie, auf ihre
Gestalten und Vorgänge käme es an; wobei er noch im stillen von gewissen
mythologischen Grundansichten unterstützt wird, die er stillschweigend
voraussetzt: sonst ließe sich fragen, für welchen Zuschauer denn eine
dergleichen Komödie eigentlich aufgeführt würde? — Denn, da nur das
Individuum, nicht aber das Menschengeschlecht wirkliche, unmittelbare
Einheit des Bewußtseins hat; so ist die Einheit des Lebenslaufes dieses
eine bloße Fiktion. Zudem, wie in der Natur nur die Spezies real, die
Genera bloße Abstraktionen sind, so sind im Menschengeschlecht nur die
Individuen und ihr Lebenslauf real, die Völker und ihr Leben bloße Abstraktionen.
Endlich laufen die Konstruktionsgeschichten, von plattem Optimismus geleitet,
zuletzt immer auf einen behaglichen, nahrhaften, fetten Staat, mit wohlgeregelter
Konstitution, guter Justiz und Polizei, Technik und Industrie und höchstens
auf intellektuelle Vervollkommnung hinaus; weil diese in der That die
allein mögliche ist, da das Moralische im wesentlichen unverändert bleibt.
Das Moralische aber ist es, worauf, nach dem Zeugnis unsers innersten
Bewußtseins, alles ankommt: und dieses liegt allein im Individuo, als
die Richtung seines Willens. In Wahrheit hat nur der Lebenslauf jedes
einzelnen Einheit, Zusammenhang und wahre Bedeutsamkeit: er ist als eine
Belehrung anzusehen, und der Sinn derselben ist ein moralischer. Nur die
innern Vorgänge, sofern sie den Willen betreffen, haben wahre Realität
und sind wirkliche Begebenheiten, weil der Wille allein das Ding an sich
ist. In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält
nichts mehr als jener. Die Vielheit ist Erscheinung, und die äußern
Vorgänge sind bloße Konfigurationen der Erscheinungswelt, haben daher
unmittelbar weder Realität noch Bedeutung, sondern erst mittelbar, durch
ihre Beziehung auf den Willen der Einzelnen. Das Bestreben, sie unmittelbar
deuten und auslegen zu wollen, gleicht sonach dem, in den Gebilden der
Wolken Gruppen von Menschen und Tieren zu sehen. — Was die Geschichte
erzählt, ist in der That nur der lange, schwere und verworrene Traum
der Menschheit.
Die Hegelianer, welche die Philosophie der Geschichte sogar als den Hauptzweck
aller Philosophie ansehen, sind auf Plato zu verweisen, der unermüdlich
wiederholt, daß der Gegenstand der Philosophie das Unveränderliche und
immerdar Bleibende sei, nicht aber das, was bald so, bald anders ist.
Alle die, welche solche Konstruktionen des Weltverlaufs, oder, wie sie
es nennen, der Geschichte, aufstellen, haben die Hauptwahrheit aller Philosophie
nicht begriffen, daß nämlich zu aller Zeit dasselbe ist, alles Werden
und Entstehen nur scheinbar, die Ideen allein bleibend, die Zeit ideal.
Dies will der Plato, dies will der Kant. Man soll demnach zu verstehen
suchen, was da ist, wirklich ist, heute und immerdar — d. h. die Ideen
(in Platos Sinn) erkennen. Die Thoren hingegen meinen, es solle erst etwas
werden und kommen. Daher räumen sie der Geschichte eine Hauptstelle in
ihrer Philosophie ein und konstruieren dieselbe nach einem vorausgesetzten
Weltplane, welchem gemäß alles zum besten gelenkt wird, welches dann
finaliter eintreten soll und eine große Herrlichkeit sein wird. Demnach
nehmen sie die Welt als vollkommen real und setzen den Zweck derselben
in das armselige Erdenglück, welches, selbst wenn noch so sehr vom Menschen
gepflegt und vom Schicksal begünstigt, doch ein hohles, täuschendes,
hinfälliges und trauriges Ding ist, aus welchem weder Konstitutionen
und Gesetzgebungen, noch Dampfmaschinen und Telegraphen jemals etwas wesentlich
Besseres machen können. Besagte Geschichts=Philosophen und =Verherrlicher
sind demnach einfältige Realisten, dazu Optimisten und Eudämonisten,
mithin platte Gesellen und eingefleischte Philister, zudem auch eigentlich
schlechte Christen; da der wahre Geist und Kern des Christentums, ebenso
wie des Brahmanismus und Buddhaismus, die Erkenntnis der Nichtigkeit des
Erdenglücks, die völlige Verachtung desselben und Hinwendung zu einem
ganz anderartigen, ja, entgegengesetzten Dasein ist: dies, sage ich, ist
der Geist und Zweck des Christentums, der wahre „Humor der Sache“;
nicht aber ist es, wie sie meinen, der Monotheismus; daher eben der atheistische
Buddhaismus dem Christentum viel näher verwandt ist, als das optimistische
Judentum und seine Varietät, der Islam. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Was es übrigens mit dem gerühmten Pragmatismus der Geschichte
auf sich habe, wird der am besten ermessen können, welcher sich erinnert,
daß er bisweilen die Begebenheiten seines eigenen Lebens, ihrem wahren
Zusammenhange nach, erst zwanzig Jahre hinterher verstanden hat, obwohl
die Data dazu ihm vollständig vorlagen: so schwierig ist die Kombination
des Wirkens der Motive, unter den beständigen Eingriffen des Zufalls
und dem Verhehlen der Absichten. — Sofern nun die Geschichte eigentlich
immer nur das Einzelne, die individuelle Thatsache, zum Gegenstande hat
und dieses als das ausschließlich Reale ansieht, ist sie das gerade Gegenteil
und Widerspiel der Philosophie, als welche die Dinge vom allgemeinsten
Gesichtspunkt aus betrachtet und ausdrücklich das Allgemeine zum Gegenstande
hat, welches in allem Einzelnen identisch bleibt; daher sie in diesem
stets nur jenes sieht und den Wechsel an der Erscheinung desselben als
unwesentlich erkennt: φιλοκαϑολου γαρ ό φιλοσοφος
(generalium amator philosophus). Während die Geschichte uns lehrt, daß
zu jeder Zeit etwas anderes gewesen, ist die Philosophie bemüht, uns
zu der Einsicht zu verhelfen, daß zu allen Zeiten ganz dasselbe war,
ist und sein wird. In Wahrheit ist das Wesen des Menschenlebens, wie der
Natur überall, in jeder Gegenwart ganz vorhanden, und bedarf daher, um
erschöpfend erkannt zu werden, nur der Tiefe der Auffassung. Die Geschichte
aber hofft die Tiefe durch die Länge und Breite zu ersetzen: ihr ist
jede Gegenwart nur ein Bruchstück, welches ergänzt werden muß durch
die Vergangenheit, deren Länge aber unendlich ist und an die sich wieder
eine unendliche Zukunft schließt. Hierauf beruht das Widerspiel zwischen
den philosophischen und den historischen Köpfen: jene wollen ergründen,
diese wollen zu Ende zählen. Die Geschichte zeigt auf jeder Seite nur
dasselbe, unter verschiedenen Formen: wer aber solches nicht in einer
oder wenigen erkennt, wird auch durch das Durchlaufen aller Formen schwerlich
zur Erkenntnis davon gelangen. Die Kapitel der Völkergeschichte sind
im Grunde nur durch die Namen und Jahreszahlen verschieden: der eigentlich
wesentliche Inhalt ist überall derselbe. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Eine wirkliche Philosophie der Geschichte soll also nicht, wie jene
alle thun, das betrachten, was (in Platos Sprache zu reden) immer wird
und nie ist, und dieses für das eigentliche Wesen der Dinge halten; sondern
sie soll das, was immer ist und nie wird, noch vergeht, im Auge behalten.
Sie besteht also nicht darin, daß man die zeitlichen Zwecke der Menschen
zu ewigen und absoluten erhebt, und nun ihren Fortschritt dazu, durch
alle Verwickelungen, künstlich und imaginär konstruiert; sondern in
der Einsicht, daß die Geschichte nicht nur in der Ausführung, sondern
schon in ihrem Wesen lügenhaft ist, indem sie, von lauter Individuen
und einzelnen Vorgängen redend, vorgibt, allemal etwas anderes zu erzählen;
während sie, vom Anfang bis zum Ende, stets nur dasselbe wiederholt,
unter andern Namen und in anderm Gewande. Die wahre Philosophie der Geschichte
besteht nämlich in der Einsicht, daß man, bei allen diesen endlosen
Veränderungen und ihrem Wirrwarr, doch stets nur dasselbe, gleiche und
unwandelbare Wesen vor sich hat, welches heute dasselbe treibt, wie gestern
und immerdar: sie soll also das Identische in allen Vorgängen, der alten
wie der neuen Zeit, des Orients wie des Occidents, erkennen, und, trotz
aller Verschiedenheit der speziellen Umstände, des Kostümes und der
Sitten, überall dieselbe Menschheit erblicken. Dies Identische und unter
allem Wechsel Beharrende besteht in den Grundeigenschaften des menschlichen
Herzens und Kopfes — vielen schlechten, wenigen guten. Die Devise der
Geschichte überhaupt müßte lauten: Eadem, sed aliter. Hat einer den
Herodot gelesen, so hat er, in philosophischer Absicht, schon genug Geschichte
studiert. Denn da steht schon alles, was die folgende Weltgeschichte ausmacht:
das Treiben, Thun, Leiden und Schicksal des Menschengeschlechts, wie es
aus den besagten Eigenschaften und dem physischen Erdenlose hervorgeht.
— [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In jeder Art und Gattung von Dingen sind die Thatsachen unzählig,
der einzelnen Wesen unendlich viele, die Mannigfaltigkeit ihrer Verschiedenheiten
unerreichbar. Bei einem Blicke darauf schwindelt dem wißbegierigen Geiste:
er sieht sich, wie weit er auch forsche, zur Unwissenheit verdammt. —
Aber da kommt die Wissenschaft: sie sondert das unzählbar Viele aus,
sammelt es unter Artbegriffe, und diese wieder unter Gattungsbegriffe,
wodurch sie den Weg zu einer Erkenntnis des Allgemeinen und des Besondern
eröffnet, welche auch das unzählbare Einzelne befaßt, indem sie von
allem gilt, ohne daß man jegliches für sich zu betrachten habe. Dadurch
verspricht sie dem forschenden Geiste Beruhigung. Dann stellen alle Wissenschaften
sich nebeneinander und über die reale Welt der einzelnen Dinge, als welche
sie unter sich verteilt haben. Ueber ihnen allen aber schwebt die Philosophie,
als das allgemeinste und deshalb wichtigste Wissen, welches die Aufschlüsse
verheißt, zu denen die andern nur vorbereiten. — Bloß die Geschichte
darf eigentlich nicht in jene Reihe treten; da sie sich nicht desselben
Vorteils wie die andern rühmen kann: denn ihr fehlt der Grundcharakter
der Wissenschaft, die Subordination des Gewußten, statt deren sie bloße
Koordination desselben aufzuweisen hat. Daher gibt es kein System der
Geschichte, wie doch jeder andern Wissenschaft. Sie ist demnach zwar ein
Wissen, jedoch keine Wissenschaft. Denn nirgends erkennt sie das Einzelne
mittelst des Allgemeinen, sondern muß das Einzelne unmittelbar fassen
und so gleichsam auf dem Boden der Erfahrung fortkriechen; während die
wirklichen Wissenschaften darüber schweben, indem sie umfassende Begriffe
gewonnen haben, mittelst deren sie das Einzelne beherrschen und, wenigstens
innerhalb gewisser Grenzen, die Möglichkeit der Dinge ihres Bereiches
absehen, so daß sie auch über das etwan noch Hinzukommende beruhigt
sein können. Die Wissenschaften, da sie Systeme von Begriffen sind, reden
stets von Gattungen; die Geschichte von Individuen. Sie wäre demnach
eine Wissenschaft von Individuen, welches einen Widerspruch besagt. Auch
folgt aus ersterem, daß die Wissenschaften sämtlich von dem reden, was
immer ist; die Geschichte hingegen von dem, was nur einmal und dann nicht
mehr ist. Da ferner die Geschichte es mit dem schlechthin Einzelnen und
Individuellen zu thun hat, welches, seiner Natur nach, unerschöpflich
ist; so weiß sie alles nur unvollkommen und halb. Dabei muß sie zugleich
noch von jedem neuen Tage, in seiner Alltäglichkeit, sich das lehren
lassen, was sie noch gar nicht wußte. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] — Zur Philosophie verhält sich die Poesie, wie die Erfahrung
sich zur empirischen Wissenschaft verhält. Die Erfahrung nämlich macht
uns mit der Erscheinung im Einzelnen und beispielsweise bekannt: die Wissenschaft
umfaßt das Ganze derselben, mittelst allgemeiner Begriffe. So will die
Poesie uns mit den (platonischen) Ideen der Wesen mittelst des Einzelnen
und beispielsweise bekannt machen: die Philosophie will das darin sich
aussprechende innere Wesen der Dinge im Ganzen und Allgemeinen erkennen
lehren. — Man sieht schon hieran, daß die Poesie mehr den Charakter
der Jugend, die Philosophie den des Alters trägt. In der That blüht
die Dichtergabe eigentlich nur in der Jugend: auch die Empfänglichkeit
für Poesie ist in der Jugend oft leidenschaftlich: der Jüngling hat
Freude an Versen als solchen und nimmt oft mit geringer Ware vorlieb.
Mit den Jahren nimmt diese Neigung allmählich ab, und im Alter zieht
man die Prosa vor. Durch jene poetische Tendenz der Jugend wird dann leicht
der Sinn für die Wirklichkeit verdorben. Denn von dieser unterscheidet
die Poesie sich dadurch, daß in ihr das Leben interessant und doch schmerzlos
an uns vorüberfließt; dasselbe hingegen in der Wirklichkeit, so lange
es schmerzlos ist, uninteressant ist, sobald es aber interessant wird,
nicht ohne Schmerzen bleibt. Der früher in die Poesie als in die Wirklichkeit
eingeweihte Jüngling verlangt nun von dieser, was nur jene leisten kann:
dies ist eine Hauptquelle des Unbehagens, welches die vorzüglichsten
Jünglinge drückt. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Tod ist der eigentliche inspirierende Genius oder der Musaget der
Philosophie, weshalb Sokrates diese auch ϑανατου μελετη definiert
hat. Schwerlich sogar würde, auch ohne den Tod, philosophiert werden.
Daher wird es ganz in der Ordnung sein, daß eine spezielle Betrachtung
desselben hier an der Spitze des letzten, ernstesten und wichtigsten unserer
Bücher ihre Stelle erhalte.
Das Tier lebt ohne eigentliche Kenntnis des Todes: daher genießt das
tierische Individuum unmittelbar die ganze Unvergänglichkeit der Gattung,
indem es sich seiner nur als endlos bewußt ist. Beim Menschen fand sich,
mit der Vernunft, notwendig die erschreckende Gewißheit des Todes ein.
Wie aber durchgängig in der Natur jedem Uebel ein Heilmittel, oder wenigstens
ein Ersatz beigegeben ist; so verhilft dieselbe Reflexion, welche die
Erkenntnis des Todes herbeiführte, auch zu metaphysischen Ansichten,
die darüber trösten, und deren das Tier weder bedürftig noch fähig
ist. Hauptsächlich auf diesen Zweck sind alle Religionen und philosophischen
Systeme gerichtet, sind also zunächst das von der reflektierenden Vernunft
aus eigenen Mitteln hervorgebrachte Gegengift der Gewißheit des Todes.
Der Grad jedoch, in welchem sie diesen Zweck erreichen, ist sehr verschieden,
und allerdings wird eine Religion oder Philosophie viel mehr, als die
andere, den Menschen befähigen, ruhigen Blickes dem Tod ins Angesicht
zu sehen. Brahmanismus und Buddhaismus, die den Menschen lehren, sich
als das Urwesen selbst, das Brahm, zu betrachten, welchem alles Entstehen
und Vergehen wesentlich fremd ist, werden darin viel mehr leisten, als
solche, welche ihn aus Nichts gemacht sein und seine, von einem andern
empfangene Existenz wirklich mit der Geburt anfangen lassen. Dementsprechend
finden wir in Indien eine Zuversicht und eine Verachtung des Todes, von
der man in Europa keinen Begriff hat. Es ist in der That eine bedenkliche
Sache, dem Menschen in dieser wichtigen Hinsicht schwache und unhaltbare
Begriffe durch frühes Einprägen aufzuzwingen, und ihn dadurch zur Aufnahme
der richtigeren und standhaltenden auf immer unfähig zu machen. Z. B.
ihn lehren, daß er erst kürzlich aus Nichts geworden, folglich eine
Ewigkeit hindurch Nichts gewesen sei und dennoch für die Zukunft unvergänglich
sein solle, ist gerade so, wie ihn lehren, daß er, obwohl durch und durch
das Werk eines Andern, dennoch für sein Thun und Lassen in alle Ewigkeit
verantwortlich sein solle. Wenn nämlich dann, bei gereiftem Geiste und
eingetretenem Nachdenken, das Unhaltbare solcher Lehren sich ihm aufdringt;
so hat er nichts Besseres an ihre Stelle zu setzen, ja, ist nicht mehr
fähig es zu verstehen, und geht dadurch des Trostes verlustig, den auch
ihm die Natur, zum Ersatz für die Gewißheit des Todes, bestimmt hatte.
Infolge solcher Entwickelung sehen wir eben jetzt (1844) in England, unter
verdorbenen Fabrikarbeitern, die Socialisten, und in Deutschland, unter
verdorbenen Studenten, die Junghegelianer zur absolut physischen Ansicht
herabsinken, welche zu dem Resultate führt: edite, bibite, post mortem
nulla voluptas, und insofern als Bestialismus bezeichnet werden kann.
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Bis hieher hat sich uns ergeben, daß der Tod, so sehr er auch gefürchtet
wird, doch eigentlich kein Uebel sein könne. Oft aber erscheint er sogar
als ein Gut, ein Erwünschtes, als Freund Hein. Alles, was auf unüberwindliche
Hindernisse seines Daseins, oder seiner Bestrebungen gestoßen ist, was
an unheilbaren Krankheiten, oder an untröstlichem Grame leidet, — hat
zur letzten, meistens sich ihm von selbst öffnenden Zuflucht die Rückkehr
in den Schoß der Natur, aus welchem es, wie alles andere auch, auf eine
kurze Zeit heraufgetaucht war, verlockt durch die Hoffnung auf günstigere
Bedingungen des Daseins, als ihm geworden, und von wo aus ihm derselbe
Weg offen bleibt. Jene Rückkehr ist die cessio bonorum des Lebenden.
Jedoch wird sie auch hier erst nach einem physischen oder moralischen
Kampfe angetreten: so sehr sträubt jedes sich, dahin zurückzugehen,
von wo es so leicht und bereitwillig hervorkam, zu einem Dasein, welches
so viele Leiden und so wenige Freuden zu bieten hat. — Die Hindu geben
dem Todesgotte Yama zwei Gesichter: ein sehr furchtbares und schreckliches,
und ein sehr freudiges und gütiges. Dies erklärt sich zum Teil schon
durch die eben angestellte Betrachtung. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Um so weniger also darf es uns in den Sinn kommen, das Aufhören
des Lebens für die Vernichtung des belebenden Prinzips, mithin den Tod
für den gänzlichen Untergang des Menschen zu halten. Weil der kräftige
Arm, der, vor dreitausend Jahren, den Bogen des Odysseus spannte, nicht
mehr ist, wird kein nachdenkender und wohlgeregelter Verstand die Kraft,
welche in demselben so energisch wirkte, für gänzlich vernichtet halten,
aber daher, bei fernerem Nachdenken, auch nicht annehmen, daß die Kraft,
welche heute den Bogen spannt, erst mit diesem Arm zu existieren angefangen
habe. Viel näher liegt der Gedanke, daß die Kraft, welche früher ein
nunmehr entwichenes Leben aktuierte, dieselbe sei, welche in dem jetzt
blühenden thätig ist: ja, dieser ist fast unabweisbar. Gewiß aber wissen
wir, daß, wie im zweiten Buche dargethan wurde, nur das vergänglich
ist, was in der Kausalkette begriffen ist: dies aber sind bloß die Zustände
und Formen. Unberührt hingegen von dem durch Ursachen herbeigeführten
Wechsel dieser bleibt einerseits die Materie und andererseits die Naturkräfte:
denn beide sind die Voraussetzung aller jener Veränderungen. Das uns
belebende Prinzip aber müssen wir zunächst wenigstens als eine Naturkraft
denken, bis etwan eine tiefere Forschung uns hat erkennen lassen, was
es an sich selbst sei. Also schon als Naturkraft genommen, bleibt die
Lebenskraft ganz unberührt von dem Wechsel der Formen und Zustände,
welche das Band der Ursachen und Wirkungen herbei= und hinwegführt, und
welche allein dem Entstehen und Vergehen, wie es in der Erfahrung vorliegt,
unterworfen sind. Soweit also ließe sich schon die Unvergänglichkeit
unsers eigentlichen Wesens sicher beweisen. Aber freilich wird dies den
Ansprüchen, welche man an Beweise unsers Fortbestehens nach dem Tode
zu machen gewohnt ist, nicht genügen, noch den Trost gewähren, den man
als solchen erwartet. Indessen ist es immer etwas, und wer den Tod als
eine absolute Vernichtung fürchtet, darf die völlige Gewißheit, daß
das innerste Prinzip seines Lebens von demselben unberührt bleibt, nicht
verschmähen. — Ja, es ließe sich das Paradoxon aufstellen, daß auch
jenes Zweite, welches, eben wie die Naturkräfte, von dem am Leitfaden
der Kausalität fortlaufenden Wechsel der Zustände unberührt bleibt,
also die Materie, durch seine absolute Beharrlichkeit uns eine Unzerstörbarkeit
zusichert, vermöge welcher, wer keine andere zu fassen fähig wäre,
sich doch schon einer gewissen Unvergänglichkeit getrösten könnte.
„Wie?“ wird man sagen, „das Beharren des bloßen Staubes, der rohen
Materie, sollte als eine Fortdauer unsers Wesens angesehen werden?“
— Oho! kennt ihr denn diesen Staub? Wißt ihr, was er ist und was er
vermag? Lernt ihn kennen, ehe ihr ihn verachtet. Diese Materie, die jetzt
als Staub und Asche daliegt, wird bald, im Wasser aufgelöst, als Krystall
anschießen, wird als Metall glänzen, wird dann elektrische Funken sprühen,
wird mittelst ihrer galvanischen Spannung eine Kraft äußern, welche,
die festesten Verbindungen zersetzend, Erden zu Metallen reduziert: ja,
sie wird von selbst sich zu Pflanze und Tier gestalten und aus ihrem geheimnisvollen
Schoß jenes Leben entwickeln, vor dessen Verlust ihr in eurer Beschränktheit
so ängstlich besorgt seid. Ist nun, als eine solche Materie fortzudauern,
so ganz und gar nichts? Ja, ich behaupte im Ernst, daß selbst diese Beharrlichkeit
der Materie von der Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens Zeugnis ablegt,
wenn auch nur wie im Bilde und Gleichnis, oder vielmehr nur wie im Schattenriß.
Dies einzusehen, dürfen wir uns nur an die Kapitel 24 gegebene Erörterung
der Materie erinnern, aus der sich ergab, daß die lautere, formlose Materie,
— diese für sich allein nie wahrgenommene, aber als stets bleibend
vorausgesetzte Basis der Erfahrungswelt, — der unmittelbare Widerschein,
die Sichtbarkeit überhaupt, des Dinges an sich, also des Willens, ist;
daher von ihr, unter den Bedingungen der Erfahrung, das gilt, was dem
Willen an sich schlechthin zukommt und sie seine wahre Ewigkeit unter
dem Bilde der zeitlichen Unvergänglichkeit wiedergibt. Weil, wie schon
gesagt, die Natur nicht lügt; so kann keine aus einer rein objektiven
Auffassung derselben entsprungene und in folgerechtem Denken durchgeführte
Ansicht ganz und gar falsch sein, sondern sie ist, im schlimmsten Fall,
nur sehr einseitig und unvollständig. Eine solche aber ist unstreitig
auch der konsequente Materialismus, etwan der des Epikuros, ebensogut,
wie der ihm entgegengesetzte absolute Idealismus, etwan der des Berkeley,
und überhaupt jede aus einem richtigen Apercu hervorgegangene und redlich
ausgeführte philosophische Grundansicht. Nur sind sie alle höchst einseitige
Auffassungen, und daher, trotz ihrer Gegensätze, zugleich wahr, nämlich
jede von einem bestimmten Standpunkt aus; sobald man aber sich über diesen
erhebt, erscheinen sie nur noch als relativ und bedingt wahr. Der höchste
Standpunkt allein, von welchem aus man sie alle übersieht und in ihrer
bloß relativen Wahrheit, über diese hinaus aber in ihrer Falschheit
erkennt, kann der der absoluten Wahrheit, soweit eine solche überhaupt
erreichbar ist, sein. Dementsprechend sehen wir, wie soeben nachgewiesen
wurde, selbst in der eigentlich sehr rohen und daher sehr alten Grundansicht
des Materialismus die Unzerstörbarkeit unsers wahren Wesens an sich noch
wie durch einen bloßen Schatten derselben repräsentiert, nämlich durch
die Unvergänglichkeit der Materie; wie, in dem schon höher stehenden
Naturalismus einer absoluten Physik, durch die Ubiquität und Aeternität
der Naturkräfte, welchen die Lebenskraft doch wenigstens beizuzählen
ist. Also selbst diese rohen Grundansichten enthalten die Aussage, daß
das lebende Wesen durch den Tod keine absolute Vernichtung erleidet, sondern
in und mit dem Ganzen der Natur fortbesteht. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] — Wenn ich ein Tier, sei es ein Hund, ein Vogel, ein Frosch, ja
sei es auch nur ein Insekt, töte, so ist es eigentlich doch undenkbar,
daß dieses Wesen, oder vielmehr die Urkraft, vermöge welcher eine so
bewunderungswürdige Erscheinung, noch den Augenblick vorher, sich in
ihrer vollen Energie und Lebenslust darstellte, durch meinen boshaften
oder leichtsinnigen Akt zu nichts geworden sein sollte. — Und wieder
andererseits, die Millionen Tiere jeglicher Art, welche jeden Augenblick,
in unendlicher Mannigfaltigkeit, voll Kraft und Strebsamkeit ins Dasein
treten, können nimmermehr vor dem Akt ihrer Zeugung gar nichts gewesen
und von nichts zu einem absoluten Anfang gelangt sein. — Sehe ich nun
auf diese Weise eines sich meinem Blicke entziehen, ohne daß ich je erfahre,
wohin es gehe; und ein anderes hervortreten, ohne daß ich je erfahre,
woher es komme; haben dazu noch beide dieselbe Gestalt, dasselbe Wesen,
denselben Charakter, nur allein nicht dieselbe Materie, welche jedoch
sie auch während ihres Daseins fortwährend abwerfen und erneuern; —
so liegt doch wahrlich die Annahme, daß das, was verschwindet, und das,
was an seine Stelle tritt, eines und dasselbe Wesen sei, welches nur eine
kleine Veränderung, eine Erneuerung der Form seines Daseins, erfahren
hat, und daß mithin was der Schlaf für das Individuum ist, der Tod für
die Gattung sei; — diese Annahme, sage ich, liegt so nahe, daß es unmöglich
ist, nicht auf sie zu geraten, wenn nicht der Kopf, in früher Jugend,
durch Einprägung falscher Grundansichten verschroben, ihr, mit abergläubischer
Furcht, schon von weitem aus dem Wege eilt. Die entgegengesetzte Annahme
aber, daß die Geburt eines Tieres eine Entstehung aus nichts, und dementsprechend
sein Tod seine absolute Vernichtung sei, und dies noch mit der Zugabe,
daß der Mensch, ebenso aus nichts geworden, dennoch eine individuelle,
endlose Fortdauer und zwar mit Bewußtsein habe, während der Hund, der
Affe, der Elefant durch den Tod vernichtet würden, — ist denn doch
wohl etwas, wogegen der gesunde Sinn sich empören und es für absurd
erklären muß. — Wenn, wie zur Genüge wiederholt wird, die Vergleichung
der Resultate eines Systems mit den Aussprüchen des gesunden Menschenverstandes
ein Probierstein seiner Wahrheit sein soll; so wünsche ich, daß die
Anhänger jener von Cartesius bis auf die vorkantischen Eklektiker herabgeerbten,
ja wohl auch jetzt noch bei einer großen Anzahl der Gebildeten in Europa
herrschenden Grundansicht, einmal hier diesen Probierstein anlegen mögen.
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] — Im Grunde aber sind wir mit der Welt viel mehr eins, als wir
gewöhnlich denken: ihr inneres Wesen ist unser Wille; ihre Erscheinung
ist unsere Vorstellung. Wer dieses Einssein sich zum deutlichen Bewußtsein
bringen könnte, dem würde der Unterschied zwischen der Fortdauer der
Außenwelt, nachdem er gestorben, und seiner eigenen Fortdauer nach dem
Tode verschwinden: beides würde sich ihm als eines und dasselbe darstellen,
ja, er würde über den Wahn lachen, der sie trennen konnte. Denn das
Verständnis der Unzerstörbarkeit unsers Wesens fällt mit dem der Identität
des Makrokosmos und Mikrokosmos zusammen. Einstweilen kann man das hier
Gesagte sich durch ein eigentümliches, mittelst der Phantasie vorzunehmendes
Experiment, welches ein metaphysisches genannt werden könnte, erläutern.
Man versuche nämlich, sich die keinesfalls gar ferne Zeit, die man gestorben
sein wird, lebhaft zu vergegenwärtigen. Da denkt man sich weg und läßt
die Welt fortbestehen: aber bald wird man, zu eigener Verwunderung, entdecken,
daß man dabei doch noch da war. Denn man hat vermeint, die Welt ohne
sich vorzustellen: allein im Bewußtsein ist das Ich das Unmittelbare,
durch welches die Welt erst vermittelt, für welches allein sie vorhanden
ist. Dieses Centrum alles Daseins, diesen Kern aller Realität soll man
aufheben und dabei dennoch die Welt fortbestehen lassen: es ist ein Gedanke,
der sich wohl in abstracto denken, aber nicht realisieren läßt. Das
Bemühen, dieses zu leisten, der Versuch, das Sekundäre ohne das Primäre,
das Bedingte ohne die Bedingung, das Getragene ohne den Träger zu denken,
mißlingt jedesmal, ungefähr so, wie der, sich einen gleichseitigen rechtwinklichten
Triangel, oder ein Vergehen oder Entstehen von Materie und ähnliche Unmöglichkeiten
mehr zu denken. Statt des Beabsichtigten dringt sich uns dabei das Gefühl
auf, daß die Welt nicht weniger in uns ist, als wir in ihr, und daß
die Quelle aller Realität in unserm Innern liegt. Das Resultat ist eigentlich
dieses: die Zeit, da ich nicht sein werde, wird objektiv kommen: aber
subjektiv kann sie nie kommen. — Es ließe daher sich sogar fragen,
wie weit denn jeder, in seinem Herzen, wirklich an eine Sache glaube,
die er sich eigentlich gar nicht denken kann; oder ob nicht vielleicht
gar, da sich zu jenem bloß intellektuellen, aber mehr oder minder deutlich
von jedem schon gemachten Experiment, noch das tiefinnere Bewußtsein
der Unzerstörbarkeit unsers Wesens an sich gesellt, der eigene Tod uns
im Grunde die fabelhafteste Sache von der Welt sei. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die strenge Unterscheidung des Willens von der Erkenntnis, nebst
dem Primat des erstern, welche den Grundcharakter meiner Philosophie ausmacht,
ist daher der alleinige Schlüssel zu dem sich auf mannigfaltige Weise
kundgebenden und in jedem, sogar dem ganz rohen Bewußtsein stets von
neuem aufsteigenden Widerspruch, daß der Tod unser Ende ist, und wir
dennoch ewig und unzerstörbar sein müssen, also dem sentimus, experimurque
nos aeternos esse des Spinoza. Alle Philosophen haben darin geirrt, daß
sie das Metaphysische, das Unzerstörbare, das Ewige im Menschen in den
Intellekt setzten: es liegt ausschließlich im Willen, der von jenem gänzlich
verschieden und allein ursprünglich ist. Der Intellekt ist, wie im zweiten
Buche auf das gründlichste dargethan worden, ein sekundäres Phänomen
und durch das Gehirn bedingt, daher mit diesem anfangend und endend. Der
Wille allein ist das Bedingende, der Kern der ganzen Erscheinung, von
den Formen dieser, zu welchen die Zeit gehört, somit frei, also auch
unzerstörbar. Mit dem Tode geht demnach zwar das Bewußtsein verloren,
nicht aber das, was das Bewußtsein hervorbrachte und erhielt: das Leben
erlischt, nicht aber mit ihm das Prinzip des Lebens, welches in ihm sich
manifestierte. Daher also sagt jedem ein sicheres Gefühl, daß in ihm
etwas schlechthin Unvergängliches und Unzerstörbares sei. Sogar das
Frische und Lebhafte der Erinnerungen aus der fernsten Zeit, aus der ersten
Kindheit, zeugt davon, daß irgend etwas in uns nicht mit der Zeit sich
fortbewegt, nicht altert, sondern unverändert beharrt. Aber was dieses
Unvergängliche sei, konnte man sich nicht deutlich machen. Es ist nicht
das Bewußtsein, so wenig wie der Leib, auf welchem offenbar das Bewußtsein
beruht. Es ist vielmehr das, worauf der Leib, mit samt dem Bewußtsein
beruht. Dieses aber ist eben das, was, indem es ins Bewußtsein fällt,
sich als Wille darstellt. Ueber diese unmittelbarste Erscheinung desselben
hinaus können wir freilich nicht; weil wir nicht über das Bewußtsein
hinaus können: daher bleibt die Frage, was denn jenes sein möge, sofern
es nicht ins Bewußtsein fällt, d. h. was es schlechthin an sich selbst
sei, unbeantwortbar.
In der Erscheinung und mittelst deren Formen, Zeit und Raum, als principium
individuationis, stellt es sich so dar, daß das menschliche Individuum
untergeht, hingegen das Menschengeschlecht immerfort bleibt und lebt.
Allein im Wesen an sich der Dinge, als welches von diesen Formen frei
ist, fällt auch der ganze Unterschied zwischen dem Individuo und dem
Geschlechte weg, und sind beide unmittelbar eins. Der ganze Wille zum
Leben ist im Individuo, wie er im Geschlechte ist, und daher ist die Fortdauer
der Gattung bloß das Bild der Unzerstörbarkeit des Individui. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Da nun also das so unendlich wichtige Verständnis der Unzerstörbarkeit
unsers wahren Wesens durch den Tod gänzlich auf dem Unterschiede zwischen
Erscheinung und Ding an sich beruht, will ich eben diesen jetzt dadurch
in das hellste Licht stellen, daß ich ihn am Gegenteil des Todes, also
an der Entstehung der animalischen Wesen, d. i. der Zeugung, erläutere.
Denn dieser mit dem Tode gleich geheimnisvolle Vorgang stellt uns den
fundamentalen Gegensatz zwischen Erscheinung und Wesen an sich der Dinge,
d. i. zwischen der Welt als Vorstellung und der Welt als Wille, wie auch
die gänzliche Heterogeneität der Gesetze beider, am unmittelbarsten
vor Augen. Der Zeugungsakt nämlich stellt sich uns auf zweifache Weise
dar: erstlich für das Selbstbewußtsein, dessen alleiniger Gegenstand,
wie ich oft nachgewiesen habe, der Wille mit allen seinen Affektionen
ist; und sodann für das Bewußtsein anderer Dinge, d. i. der Welt der
Vorstellung, oder der empirischen Realität der Dinge. Von der Willensseite
nun, also innerlich, subjektiv, für das Selbstbewußtsein, stellt jener
Akt sich dar als die unmittelbarste und vollkommenste Befriedigung des
Willens, d. i. als Wollust. Von der Vorstellungsseite hingegen, also äußerlich,
objektiv, für das Bewußtsein von andern Dingen, ist eben dieser Akt
der Einschlag zum allerkünstlichsten Gewebe, die Grundlage des unaussprechlich
komplizierten animalischen Organismus, der dann nur noch der Entwickelung
bedarf, um unsern erstaunten Augen sichtbar zu werden. Dieser Organismus,
dessen ins Unendliche gehende Komplikation und Vollendung nur der kennt,
welcher Anatomie studiert hat, ist, von der Vorstellungsseite aus, nicht
anders zu begreifen und zu denken, als ein mit der planvollsten Kombination
ausgedachtes und mit überschwenglicher Kunst und Genauigkeit ausgeführtes
System, als das mühseligste Werk der tiefsten Ueberlegung: — nun aber
von der Willensseite kennen wir, durch das Selbstbewußtsein, seine Hervorbringung
als das Werk eines Aktes, der das gerade Gegenteil aller Ueberlegung ist,
eines ungestümen blinden Dranges, einer überschwenglich wollüstigen
Empfindung. Dieser Gegensatz ist genau verwandt mit dem oben nachgewiesenen
unendlichen Kontrast zwischen der absoluten Leichtigkeit, mit der die
Natur ihre Werke hervorbringt, nebst der dieser entsprechenden grenzenlosen
Sorglosigkeit, mit welcher sie solche der Vernichtung preisgibt, — und
der unberechenbar künstlichen und durchdachten Konstruktion eben dieser
Werke, nach welcher zu urteilen sie unendlich schwer zu machen und daher
über ihre Erhaltung mit aller ersinnlichen Sorgfalt zu wachen sein müßte;
während wir das Gegenteil vor Augen haben. — Haben wir nun, durch diese,
freilich sehr ungewöhnliche Betrachtung die beiden heterogenen Seiten
der Welt aufs schroffeste aneinander gebracht und sie gleichsam mit einer
Faust umspannt; so müssen wir sie jetzt festhalten, um uns von der gänzlichen
Ungültigkeit der Gesetze der Erscheinung, oder Welt als Vorstellung,
für die des Willens, oder der Dinge an sich, zu überzeugen: dann wird
es uns faßlicher werden, daß, während auf der Seite der Vorstellung,
d. i. in der Erscheinungswelt, sich uns bald ein Entstehen aus Nichts,
bald eine gänzliche Vernichtung des Entstandenen darstellt, von jener
andern Seite aus, oder an sich, ein Wesen vorliegt, auf welches angewandt
die Begriffe von Entstehen und Vergehen gar keinen Sinn haben. Denn wir
haben soeben, indem wir auf den Wurzelpunkt zurückgingen, wo, mittelst
des Selbstbewußtseins, die Erscheinung und das Wesen an sich zusammenstoßen,
es gleichsam mit Händen gegriffen, daß beide schlechthin inkommensurabel
sind, und die ganze Weise des Seins des einen, nebst allen Grundgesetzen
dieses Seins, im andern nichts und weniger als nichts bedeutet. — Ich
glaube, daß diese letzte Betrachtung nur von wenigen recht verstanden
werden, und daß sie allen, die sie nicht verstehen, mißfällig und selbst
anstößig sein wird: jedoch werde ich deshalb nie etwas weglassen, was
dienen kann, meinen Grundgedanken zu erläutern. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Am Anfange dieses Kapitels habe ich auseinandergesetzt, daß die
große Anhänglichkeit an das Leben, oder vielmehr die Furcht vor dem
Tode, keineswegs aus der Erkenntnis entspringt, in welchem Fall sie das
Resultat des erkannten Wertes des Lebens sein würde; sondern daß jene
Todesfurcht ihre Wurzel unmittelbar im Willen hat, aus dessen ursprünglichem
Wesen, in welchem er ohne alle Erkenntnis, und daher blinder Wille zum
Leben ist, sie hervorgeht. Wie wir in das Leben hineingelockt werden durch
den ganz illusorischen Trieb zur Wollust; so werden wir darin festgehalten
durch die gewiß ebenso illusorische Furcht vor dem Tode. Beides entspringt
unmittelbar aus dem Willen, der an sich erkenntnislos ist. Wäre, umgekehrt,
der Mensch ein bloß erkennendes Wesen; so müßte der Tod ihm nicht nur
gleichgültig, sondern sogar willkommen sein. Jetzt lehrt die Betrachtung,
zu der wir hier gelangt sind, daß was vom Tode getroffen wird, bloß
das erkennende Bewußtsein ist, hingegen der Wille, sofern er das Ding
an sich ist, welches jeder individuellen Erscheinung zum Grunde liegt,
von allem auf Zeitbestimmungen Beruhenden frei, also auch unvergänglich
ist. Sein Streben nach Dasein und Manifestation, woraus die Welt hervorgeht,
wird stets erfüllt: denn diese begleitet ihn wie den Körper sein Schatten,
indem sie bloß die Sichtbarkeit seines Wesens ist. Daß er in uns dennoch
den Tod fürchtet, kommt daher, daß hier die Erkenntnis ihm sein Wesen
bloß in der individuellen Erscheinung vorhält, woraus ihm die Täuschung
entsteht, daß er mit dieser untergehe, etwan wie mein Bild im Spiegel,
wenn man diesen zerschlägt, mit vernichtet zu werden scheint: Dieses
also, als seinem ursprünglichen Wesen, welches blinder Drang nach Dasein
ist, zuwider, erfüllt ihn mit Abscheu. Hieraus nun folgt, daß dasjenige
in uns, was allein den Tod zu fürchten fähig ist und ihn auch allein
fürchtet, der Wille, von ihm nicht getroffen wird; und daß hingegen
was von ihm getroffen wird und wirklich untergeht, das ist, was seiner
Natur nach keiner Furcht, wie überhaupt keines Wollens oder Affektes,
fähig, daher gegen Sein und Nichtsein gleichgültig ist, nämlich das
bloße Subjekt der Erkenntnis, der Intellekt, dessen Dasein in seiner
Beziehung zur Welt der Vorstellung, d. h. der objektiven Welt besteht,
deren Korrelat er ist und mit deren Dasein das seinige im Grunde eins
ist. Wenngleich also nicht das individuelle Bewußtsein den Tod überlebt;
so überlebt ihn doch das, was allein sich gegen ihn sträubt: der Wille.
Hieraus erklärt sich auch der Widerspruch, daß die Philosophen, vom
Standpunkt der Erkenntnis aus, allezeit mit treffenden Gründen bewiesen
haben, der Tod sei kein Uebel; die Todesfurcht jedoch dem Allen unzugänglich
bleibt: weil sie eben nicht in der Erkenntniß, sondern allein im Willen
wurzelt. Eben daher, daß nur der Wille, nicht aber der Intellekt das
Unzerstörbare ist, kommt es auch, daß alle Religionen und Philosophien
allein den Tugenden des Willens, oder Herzens, einen Lohn in der Ewigkeit
zuerkennen, nicht denen des Intellekts, oder Kopfes. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Der Wille, welcher unser Wesen an sich ausmacht, ist einfacher Natur:
er will bloß und erkennt nicht. Das Subjekt des Erkennens hingegen ist
eine sekundäre, aus der Objektivation des Willens hervorgehende Erscheinung:
es ist der Einheitspunkt der Sensibilität des Nervensystems, gleichsam
der Fokus, in welchem die Strahlen der Thätigkeit aller Teile des Gehirns
zusammenlaufen. Mit diesem muß es daher untergehen. Im Selbstbewußtsein
steht es, als das allein Erkennende, dem Willen als sein Zuschauer gegenüber
und erkennt, obgleich aus ihm entsprossen, ihn doch als ein von sich Verschiedenes,
ein Fremdes, deshalb auch nur empirisch, in der Zeit, stückweise, in
seinen successiven Erregungen und Akten, erfährt auch seine Entschließungen
erst a posteriori und oft sehr mittelbar. Hieraus erklärt sich, daß
unser eigenes Wesen uns, d. h. eben unserm Intellekt, ein Rätsel ist,
und daß das Individuum sich als neu entstanden und vergänglich erblickt;
obschon sein Wesen an sich ein zeitloses, also ewiges ist. Wie nun der
Wille nicht erkennt, so ist umgekehrt der Intellekt, oder das Subjekt
der Erkenntnis, einzig und allein erkennend, ohne irgend zu wollen. Dies
ist selbst physisch daran nachweisbar, daß, wie schon im zweiten Buch
erwähnt, nach Bichat, die verschiedenen Affekte alle Teile des Organismus
unmittelbar erschüttern und ihre Funktionen stören, mit Ausnahme des
Gehirns, als welches höchstens mittelbar, d. h. infolge eben jener Störungen,
davon affiziert werden kann (De la vie et de la mort, art. 6, § 2). Daraus
aber folgt, daß das Subjekt des Erkennens, für sich und als solches,
an nichts Anteil oder Interesse nehmen kann, sondern ihm das Sein oder
Nichtsein jedes Dinges, ja sogar seiner selbst, gleichgültig ist. Warum
nun sollte dieses anteilslose Wesen unsterblich sein? Es endet mit der
zeitlichen Erscheinung des Willens, d. i. dem Individuo, wie es mit diesem
entstanden war. Es ist die Laterne, welche ausgelöscht wird, nachdem
sie ihren Dienst geleistet hat. Der Intellekt, wie die in ihm allein vorhandene
anschauliche Welt, ist bloße Erscheinung: aber die Endlichkeit beider
ficht nicht das an, davon sie die Erscheinung sind. Der Intellekt ist
Funktion des cerebralen Nervensystems: aber dieses, wie der übrige Leib,
ist die Objektität des Willens. Daher beruht der Intellekt auf dem somatischen
Leben des Organismus: dieser selbst aber beruht auf dem Willen. Der organische
Leib kann also, in gewissem Sinne, angesehen werden als Mittelglied zwischen
dem Willen und dem Intellekt; wiewohl er eigentlich nur der in der Anschauung
des Intellekts sich räumlich darstellende Wille selbst ist. Tod und Geburt
sind die stete Auffrischung des Bewußtseins des an sich end= und anfangslosen
Willens, der allein gleichsam die Substanz des Daseins ist (jede solche
Auffrischung aber bringt eine neue Möglichkeit der Verneinung des Willens
zum Leben). Das Bewußtsein ist das Leben des Subjekts des Erkennens,
oder des Gehirns, und der Tod dessen Ende. Daher ist das Bewußtsein endlich,
stets neu, jedesmal von vorne anfangend. Der Wille allein beharrt; aber
auch ihm allein ist am Beharren gelegen: denn er ist der Wille zum Leben.
Dem erkennenden Subjekt für sich ist an nichts gelegen. Im Ich sind jedoch
beide verbunden. — In jedem animalischen Wesen hat der Wille einen Intellekt
errungen, welcher das Licht ist, bei dem er hier seine Zwecke verfolgt.
Beiläufig gesagt, mag die Todesfurcht zum Teil auch darauf beruhen, daß
der individuelle Wille so ungern sich von seinem, durch den Naturlauf
ihm zugefallenen Intellekt trennt, von seinem Führer und Wächter, ohne
den er sich hilflos und blind weiß.
Zu dieser Auseinandersetzung stimmt endlich auch noch jene tägliche moralische
Erfahrung, die uns belehrt, daß der Wille allein real ist, hingegen die
Objekte desselben als durch die Erkenntnis bedingt, nur Erscheinungen,
nur Schaum und Dunst sind, gleich dem Weine, welchen Mephistopheles in
Auerbachs Keller kredenzt: nämlich nach jedem sinnlichen Genuß sagen
auch wir: „Mir deuchte doch als tränk` ich Wein.“ [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die Schrecken des Todes beruhen großenteils auf dem falschen Schein,
daß jetzt das Ich verschwinde, und die Welt bleibe. Vielmehr aber ist
das Gegenteil wahr: die Welt verschwindet; hingegen der innerste Kern
des Ich, der Träger und Hervorbringer jenes Subjekts, in dessen Vorstellung
allein die Welt ihr Dasein hatte, beharrt. Mit dem Gehirn geht der Intellekt,
und mit diesem die objektive Welt, seine bloße Vorstellung, unter. Daß
in andern Gehirnen, nach wie vor, eine ähnliche Welt lebt und schwebt,
ist in Beziehung auf den untergehenden Intellekt gleichgültig. — Wenn
daher nicht im Willen die eigentliche Realität läge und nicht das moralische
Dasein das sich über den Tod hinaus erstreckende wäre; so würde, da
der Intellekt und mit ihm seine Welt erlischt, das Wesen der Dinge überhaupt
nichts weiter sein, als eine endlose Folge kurzer und trüber Träume,
ohne Zusammenhang untereinander: denn das Beharren der erkenntnislosen
Natur besteht bloß in der Zeitvorstellung der erkennenden. Also ein,
ohne Ziel und Zweck, meistens sehr trübe und schwere Träume träumender
Weltgeist wäre dann alles in allem.
Wann nun ein Individuum Todesangst empfindet; so hat man eigentlich das
seltsame, ja, zu belächelnde Schauspiel, daß der Herr der Welten, welcher
alles mit seinem Wesen erfüllt, und durch welchen allein alles was ist
sein Dasein hat, verzagt und unterzugehen befürchtet, zu versinken in
den Abgrund des ewigen Nichts; — während, in Wahrheit, alles von ihm
voll ist und es keinen Ort gibt, wo er nicht wäre, kein Wesen, in welchem
er nicht lebte; da das Dasein nicht ihn trägt, sondern er das Dasein.
Dennoch ist er es, der im Todesangst leidenden Individuo verzagt, indem
er der, durch das principium individuationis hervorgebrachten Täuschung
unterliegt, daß seine Existenz auf die des jetzt sterbenden Wesens beschränkt
sei: diese Täuschung gehört zu dem schweren Traum, in welchen er als
Wille zum Leben verfallen ist. Aber man könnte zu dem Sterbenden sagen:
„Du hörst auf, etwas zu sein, welches du besser gethan hättest, nie
zu werden.“
Solange keine Verneinung jenes Willens eingetreten, ist was der Tod von
uns übrig läßt der Keim und Kern eines ganz andern Daseins, in welchem
ein neues Individuum sich wiederfindet, so frisch und ursprünglich, daß
es über sich selbst verwundert brütet. Daher der schwärmerische und
träumerische Hang edler Jünglinge, zur Zeit wo dieses frische Bewußtsein
sich eben ganz entfaltet hat. Was für das Individuum der Schlaf, das
ist für den Willen als Ding an sich der Tod. Er würde es nicht aushalten,
eine Unendlichkeit hindurch dasselbe Treiben und Leiden, ohne wahren Gewinn,
fortzusetzen, wenn ihm Erinnerung und Individualität bliebe. Er wirft
sie ab, dies ist der Lethe, und tritt, durch diesen Todesschlaf erfrischt
und mit einem andern Intellekt ausgestattet, als ein neues Wesen wieder
auf: „Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag!“ — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Nehmen wir nun gar die, Kapitel 43 zu erörternde Thatsache zur
Hilfe, daß der Charakter, d. i. der Wille, vom Vater erblich ist, der
Intellekt hingegen von der Mutter; so tritt es gar wohl in den Zusammenhang
unserer Ansicht, daß der Wille des Menschen, an sich individuell, im
Tode sich von dem, bei der Zeugung von der Mutter erhaltenen Intellekt
trennte und nun seiner jetzt modifizierten Beschaffenheit gemäß, am
Leitfaden des mit dieser harmonierenden durchweg notwendigen Weltlaufs,
durch eine neue Zeugung, einen neuen Intellekt empfinge, mit welchem er
ein neues Wesen würde, welches keine Erinnerung eines frühern Daseins
hätte, da der Intellekt, welcher allein die Fähigkeit der Erinnerung
hat, der sterbliche Teil, oder die Form ist, der Wille aber der ewige,
die Substanz: demgemäß ist zur Bezeichnung dieser Lehre das Wort Palingenesie
richtiger, als Metempsychose. Diese steten Wiedergeburten machten dann
die Succession der Lebensträume eines an sich unzerstörbaren Willens
aus, bis er, durch so viele und verschiedenartige, successive Erkenntnis,
in stets neuer Form, belehrt und gebessert, sich selbst aufhöbe.
Mit dieser Ansicht stimmt auch die eigentliche, sozusagen esoterische
Lehre des Buddhaismus, wie wir sie durch die neuesten Forschungen kennen
gelernt haben, überein, indem sie nicht Metempsychose, sondern eine eigentümliche,
auf moralischer Basis ruhende Palingenesie lehrt, welche sie mit großem
Tiefsinn ausführt und darlegt; wie dies zu ersehen ist aus der, in Spence
Hardy´s Manual of Buddhism, p. 394—96, gegebenen, höchst lesens= und
beachtungswerten Darstellung der Sache (womit zu vergleichen p. 429, 440
und 445 desselben Buches), deren Bestätigungen man findet in Taylor’s
Prabodh Chandro Daya, London 1812, p. 35; desgleichen in Sangermano`s
Burmese empire, p. 6; wie auch in den Asiat. researches, Vol. 6, p. 179,
und Vol. 9, p. 256. Auch das sehr brauchbare Deutsche Kompendium des Buddhaismus
von Köppen gibt das Richtige über diesen Punkt. Für den großen Haufen
der Buddhaisten jedoch ist diese Lehre zu subtil; daher demselben, als
faßliches Surrogat, eben Metempsychose gepredigt wird. Uebrigens darf
nicht außer acht gelassen werden, daß sogar empirische Gründe für
eine Palingenesie dieser Art sprechen. Thatsächlich ist eine Verbindung
vorhanden zwischen der Geburt der neu auftretenden Wesen und dem Tode
der abgelebten: sie zeigt sich nämlich an der großen Fruchtbarkeit des
Menschengeschlechts, welche als Folge verheerender Seuchen entsteht. Als
im 14. Jahrhundert der schwarze Tod die alte Welt größtenteils entvölkert
hatte, trat eine ganz ungewöhnliche Fruchtbarkeit unter dem Menschengeschlechte
ein, und Zwillingsgeburten waren sehr häufig: höchst seltsam war dabei
der Umstand, daß keines der in dieser Zeit geborenen Kinder seine vollständigen
Zähne bekam; also die sich anstrengende Natur im einzelnen geizte. Dies
erzählt F. Schnurrer, Chronik der Seuchen, 1825. Auch Casper, „Ueber
die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen“, 1835, bestätigt den
Grundsatz, daß den entschiedensten Einfluß auf Lebensdauer und Sterblichkeit,
in einer gegebenen Bevölkerung, die Zahl der Zeugungen in derselben habe,
als welche mit der Sterblichkeit stets gleichen Schritt halte; so daß
die Sterbefälle und die Geburten allemal und allerorten sich in gleichem
Verhältnis vermehren und vermindern, welches er durch aufgehäufte Belege
aus vielen Ländern und ihren verschiedenen Provinzen außer Zweifel setzt.
Und doch kann unmöglich ein physischer Kausalnexus sein zwischen meinem
frühern Tode und der Fruchtbarkeit eines fremden Ehebettes, oder umgekehrt.
Hier also tritt unleugbar und auf eine stupende Weise das Metaphysische
als unmittelbarer Erklärungsgrund des Physischen auf. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] — Der Egoismus ist eine so tief wurzelnde Eigenschaft aller Individualität
überhaupt, daß, um die Thätigkeit eines individuellen Wesens zu erregen,
egoistische Zwecke die einzigen sind, auf welche man mit Sicherheit rechnen
kann. Zwar hat die Gattung auf das Individuum ein früheres, näheres
und größeres Recht, als die hinfällige Individualität selbst: jedoch
kann, wann das Individuum für den Bestand und die Beschaffenheit der
Gattung thätig sein und sogar Opfer bringen soll, seinem Intellekt, als
welcher bloß auf individuelle Zwecke berechnet ist, die Wichtigkeit der
Angelegenheit nicht so faßlich gemacht werden, daß sie derselben gemäß
wirkte. Daher kann, in solchem Fall, die Natur ihren Zweck nur dadurch
erreichen, daß sie dem Individuo einen gewissen Wahn einpflanzt, vermöge
dessen ihm als ein Gut für sich selbst erscheint, was in Wahrheit bloß
eines für die Gattung ist, so daß dasselbe dieser dient, während es
sich selber zu dienen wähnt; bei welchem Hergang eine bloße, gleich
darauf verschwindende Chimäre ihm vorschwebt und als Motiv die Stelle
einer Wirklichkeit vertritt. Dieser Wahn ist der Instinkt. Derselbe ist,
in den allermeisten Fällen, anzusehen als der Sinn der Gattung, welcher
das ihr Frommende dem Willen darstellt. Weil aber der Wille hier individuell
geworden; so muß er dergestalt getäuscht werden, daß er das, was der
Sinn der Gattung ihm vorhält, durch den Sinn des Individui wahrnimmt,
also individuellen Zwecken nachzugehen wähnt, während er in Wahrheit
bloß generelle (dies Wort hier im eigentlichsten Sinn genommen) verfolgt.
Die äußere Erscheinung des Instinkts beobachten wir am besten an den
Tieren, als wo seine Rolle am bedeutendsten ist; aber den innern Hergang
dabei können wir, wie alles Innere, allein an uns selbst kennen lernen.
Nun meint man zwar, der Mensch habe fast gar keinen Instinkt, allenfalls
bloß den, daß das Neugeborene die Mutterbrust sucht und ergreift. Aber
in der That haben wir einen sehr bestimmten, deutlichen, ja komplizierten
Instinkt, nämlich den der so feinen, ernstlichen und eigensinnigen Auswahl
des andern Individuums zur Geschlechtsbefriedigung. Mit dieser Befriedigung
an sich selbst, d. h. sofern sie ein auf dringendem Bedürfnis des Individuums
beruhender sinnlicher Genuß ist, hat die Schönheit oder Häßlichkeit
des andern Individuums gar nichts zu schaffen. Die dennoch so eifrig verfolgte
Rücksicht auf diese, nebst der daraus entspringenden sorgsamen Auswahl,
bezieht sich also offenbar nicht auf den Wählenden selbst, obschon er
es wähnt, sondern auf den wahren Zweck, auf das zu Erzeugende, als in
welchem der Typus der Gattung möglichst rein und richtig erhalten werden
soll. Nämlich durch tausend physische Zufälle und moralische Widerwärtigkeiten
entstehen gar vielerlei Ausartungen der menschlichen Gestalt: dennoch
wird der echte Typus derselben, in allen seinen Teilen, immer wieder hergestellt;
welches geschieht unter der Leitung des Schönheitssinnes, der durchgängig
dem Geschlechtstriebe vorsteht, und ohne welchen dieser zum ekelhaften
Bedürfnis herabsinkt. Demgemäß wird jeder, erstlich, die schönsten
Individuen, d. h. solche, in welchen der Gattungscharakter am reinsten
ausgeprägt ist, entschieden vorziehen und heftig begehren; zweitens aber
wird er am andern Individuo besonders die Vollkommenheiten verlangen,
welche ihm selbst abgehen, ja sogar die Unvollkommenheiten, welche das
Gegenteil seiner eigenen sind, schön finden: daher suchen z. B. kleine
Männer große Frauen, die Blonden lieben die Schwarzen u. s. w. — Das
schwindelnde Entzücken, welches den Mann beim Anblick eines Weibes von
ihm angemessener Schönheit ergreift und ihm die Vereinigung mit ihr als
das höchste Gut vorspiegelt, ist eben der Sinn der Gattung, welcher den
deutlich ausgedrückten Stempel derselben erkennend, sie mit diesem perpetuieren
möchte. Auf diesem entschiedenen Hange zur Schönheit beruht die Erhaltung
des Typus der Gattung: daher wirkt derselbe mit so großer Macht. Wir
werden die Rücksichten, welche er befolgt, weiter unten speziell betrachten.
Was also den Menschen hiebei leitet, ist wirklich ein Instinkt, der auf
das Beste der Gattung gerichtet ist, während der Mensch selbst bloß
den erhöhten eigenen Genuß zu suchen wähnt. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Das Leben eines Menschen, mit seiner endlosen Mühe, Not und Leiden,
ist anzusehen als die Erklärung und Paraphrase des Zeugungsaktes, d.
i. der entschiedenen Bejahung des Willens zum Leben: zu derselben gehört
auch noch, daß er der Natur einen Tod schuldig ist, und er denkt mit
Beklemmung an diese Schuld. — Zeugt dies nicht davon, daß unser Dasein
eine Verschuldung enthält? — Allerdings aber sind wir, gegen den periodisch
zu entrichtenden Zoll, Geburt und Tod, immerwährend da, und genießen
successiv alle Leiden und Freuden des Lebens; so daß uns keine entgehen
kann: dies eben ist die Frucht der Bejahung des Willens zum Leben. Dabei
ist also die Furcht vor dem Tode, welche uns, trotz allen Plagen des Lebens,
darin festhält, eigentlich illusorisch: aber ebenso illusorisch ist der
Trieb, der uns hineingelockt hat. Diese Lockung selbst kann man objektiv
anschauen in den sich sehnsüchtig begegnenden Blicken zweier Liebenden:
sie sind der reinste Ausdruck des Willens zum Leben in seiner Bejahung.
Wie ist er hier so sanft und zärtlich! Wohlsein will er, und ruhigen
Genuß und sanfte Freude, für sich, für andere, für alle. Es ist das
Thema des Anakreon. So lockt und schmeichelt er sich selbst ins Leben
hinein. Ist er aber darin, dann zieht die Qual das Verbrechen, und das
Verbrechen die Qual herbei: Greuel und Verwüstung füllen den Schauplatz.
Es ist das Thema des Aeschylos.
Der Akt nun aber, durch welchen der Wille sich bejaht und der Mensch entsteht,
ist eine Handlung, deren alle sich im Innersten schämen, die sie daher
sorgfältig verbergen, ja, auf welcher betroffen sie erschrecken, als
wären sie bei einem Verbrechen ertappt worden. Es ist eine Handlung,
deren man bei kalter Ueberlegung meistens mit Widerwillen, in erhöhter
Stimmung mit Abscheu gedenkt. Näher auf dieselbe in diesem Sinne eingehende
Betrachtungen liefert Montaigne, im fünften Kapitel des dritten Buches,
unter der Randglosse: ce que c`est que l`amour. Eine eigentümliche Betrübnis
und Reue folgt ihr auf dem Fuße, ist jedoch am fühlbarsten nach der
erstmaligen Vollziehung derselben, überhaupt aber um so deutlicher, je
edler der Charakter ist. Selbst Plinius, der Heide, sagt daher: Homini
tantum primi coitus poenitentia: augurium cilicet vitae, a poenitenda
origine (Hist. nat., X, 83). Und andererseits, was treiben und singen,
in Goethes „Faust“, Teufel und Hexen auf ihrem Sabbath? Unzucht und
Zoten. Was doziert ebendaselbst (in den vortrefflichen Paralipomenis zum
Faust), vor der versammelten Menge, der leibhaftige Satan? — Unzucht
und Zoten; nichts weiter. — Aber einzig und allein mittelst der fortwährenden
Ausübung einer so beschaffenen Handlung besteht das Menschengeschlecht.
— Hätte nun der Optimismus recht, wäre unser Dasein das dankbar zu
erkennende Geschenk höchster, von Weisheit geleiteter Güte, und demnach
an sich selbst preiswürdig, rühmlich und erfreulich; da müßte doch
wahrlich der Akt, welcher es perpetuiert, eine ganz andere Physiognomie
tragen. Ist hingegen dieses Dasein eine Art Fehltritt, oder Irrweg; ist
es das Werk eines ursprünglich blinden Willens, dessen glücklichste
Entwickelung die ist, daß er zu sich selbst komme, um sich selbst aufzuheben;
so muß der jenes Dasein perpetuierende Akt gerade so aussehen, wie er
aussieht.
Hinsichtlich auf die erste Grundwahrheit meiner Lehre verdient hier die
Bemerkung eine Stelle, daß die oben berührte Scham über das Zeugungsgeschäft
sich sogar auf die demselben dienenden Teile erstreckt, obschon diese,
gleich allen übrigen, angeboren sind. Dies ist abermals ein schlagender
Beweis davon, daß nicht bloß die Handlungen, sondern schon der Leib
des Menschen die Erscheinung, Objektivation seines Willens und als das
Werk desselben zu betrachten ist. Denn einer Sache, die ohne seinen Willen
da wäre, könnte er sich nicht schämen.
Der Zeugungsakt verhält sich ferner zur Welt, wie das Wort zum Rätsel.
Nämlich, die Welt ist weit im Raume und alt in der Zeit und von unerschöpflicher
Mannigfaltigkeit der Gestalten. Jedoch ist dies alles nur die Erscheinung
des Willens zum Leben; und die Konzentration, der Brennpunkt dieses Willens,
ist der Generationsakt. In diesem Akt also spricht das innere Wesen der
Welt sich am deutlichsten aus. Es ist, in dieser Hinsicht, sogar beachtenswert,
daß er selbst auch schlechthin „der Wille“ genannt wird, in der sehr
bezeichnenden Redensart: „er verlangte von ihr, sie sollte ihm zu Willen
sein“. Als der deutlichste Ausdruck des Willens also ist jener Akt der
Kern, das Kompendium, die Quintessenz der Welt. Daher geht uns durch ihn
ein Licht auf über ihr Wesen und Treiben: er ist das Wort zum Rätsel.
Demgemäß ist er verstanden unter dem „Baum der Erkenntnis“: denn
nach der Bekanntschaft mit ihm gehen jedem über das Leben die Augen auf,
wie es auch Byron sagt:
The tree of knowledge has been pluck`d, — all`s known *)
D. Juan, I, 128.
Nicht weniger entspricht dieser Eigenschaft, daß er das große αρρητον,
das öffentliche Geheimnis ist, welches nie und nirgends deutlich erwähnt
werden darf, aber immer und überall sich, als die Hauptsache, von selbst
versteht und daher den Gedanken Aller stets gegenwärtig ist, weshalb
auch die leiseste Anspielung darauf augenblicklich verstanden wird. Die
Hauptrolle, die jener Akt und was ihm anhängt in der Welt spielt, indem
überall Liebesintriguen einerseits betrieben und andererseits vorausgesetzt
werden, ist der Wichtigkeit dieses punctum saliens des Welt=Eies ganz
angemessen. Das Belustigende liegt nur in der steten Verheimlichung der
Hauptsache.
Aber nun seht, wie der junge, unschuldige, menschliche Intellekt, wann
ihm jenes große Geheimnis der Welt zuerst bekannt wird, erschrickt über
die Enormität! Der Grund hievon ist, daß auf dem weiten Wege, den der
ursprünglich erkenntnislose Wille zu durchlaufen hatte, ehe er sich zum
Intellekt, zumal zum menschlichen, vernünftigen, Intellekt steigerte,
er sich selber so entfremdet wurde, daß er seinen Ursprung, jene poenitenda
origo, nicht mehr kennt und nun vom Standpunkt des lauteren, daher unschuldigen
Erkennens aus, sich darüber entsetzt.
Da nun also der Brennpunkt des Willens, d. h. die Konzentration und der
höchste Ausdruck desselben, der Geschlechtstrieb und seine Befriedigung
ist; so ist es sehr bezeichnend und in der symbolischen Sprache der Natur
naiv ausgedrückt, daß der individualisierte Wille, also der Mensch und
das Tier, seinen Eintritt in die Welt durch die Pforte der Geschlechtsteile
macht. — [...]
*) Vom Baum der Erkenntnis ist gepflückt worden: — Alles ist bekannt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Aus der Nacht der Bewußtlosigkeit zum Leben erwacht findet der Wille
sich als Individuum, in einer end= und grenzenlosen Welt, unter zahllosen
Individuen, alle strebend, leidend, irrend; und wie durch einen bangen
Traum eilt er zurück zur alten Bewußtlosigkeit. — Bis dahin jedoch
sind seine Wünsche grenzenlos, seine Ansprüche unerschöpflich, und
jeder befriedigte Wunsch gebiert einen neuen. Keine auf der Welt mögliche
Befriedigung könnte hinreichen, sein Verlangen zu stillen, seinem Begehren
ein endliches Ziel zu setzen und den bodenlosen Abgrund seines Herzens
auszufüllen. Daneben nun betrachte man, was dem Menschen, an Befriedigungen
jeder Art, in der Regel, wird: es ist meistens nicht mehr, als die, mit
unablässiger Mühe und steter Sorge, im Kampf mit der Not, täglich errungene,
kärgliche Erhaltung dieses Daseins selbst, den Tod im Prospekt. — Alles
im Leben gibt kund, daß das irdische Glück bestimmt ist, vereitelt oder
als eine Illusion erkannt zu werden. Hiezu liegen tief im Wesen der Dinge
die Anlagen. Demgemäß fällt das Leben der meisten Menschen trübselig
und kurz aus. Die komparativ Glücklichen sind es meistens nur scheinbar,
oder aber sie sind, wie die Langlebenden, seltene Ausnahmen, zu denen
eine Möglichkeit übrig bleiben mußte, — als Lockvogel. Das Leben
stellt sich dar als ein fortgesetzter Betrug, im kleinen, wie im großen.
Hat es versprochen, so hält es nicht; es sei denn, um zu zeigen, wie
wenig wünschenswert das Gewünschte war: so täuscht uns also bald die
Hoffnung, bald das Gehoffte. Hat es gegeben; so war es, um zu nehmen.
Der Zauber der Entfernung zeigt uns Paradiese, welche wie optische Täuschungen
verschwinden, wann wir uns haben hinäffen lassen. Das Glück liegt demgemäß
stets in der Zukunft, oder auch in der Vergangenheit, und die Gegenwart
ist einer kleinen dunkeln Wolke zu vergleichen, welche der Wind über
die besonnte Fläche treibt: vor ihr und hinter ihr ist alles hell, nur
sie selbst wirft stets einen Schatten. Sie ist demnach allezeit ungenügend,
die Zukunft aber ungewiß, die Vergangenheit unwiederbringlich. Das Leben,
mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen, kleinen,
größern und großen Widerwärtigkeiten, mit seinen getäuschten Hoffnungen
und seinen alle Berechnung vereitelnden Unfällen, trägt so deutlich
das Gepräge von etwas, das uns verleidet werden soll, daß es schwer
zu begreifen ist, wie man dies hat verkennen können und sich überreden
lassen, es sei da, um dankbar genossen zu werden, und der Mensch, um glücklich
zu sein. Stellt doch vielmehr jene fortwährende Täuschung und Enttäuschung,
wie auch die durchgängige Beschaffenheit des Lebens, sich dar, als darauf
abgesehen und berechnet, die Ueberzeugung zu erwecken, daß gar nichts
unsers Strebens, Treibens und Ringens wert sei, daß alle Güter nichtig
seien, die Welt an allen Enden bankrott, und das Leben ein Geschäft,
das nicht die Kosten deckt; — auf daß unser Wille sich davon abwende.
Die Art, wie diese Nichtigkeit aller Objekte des Willens sich dem im Individuo
wurzelnden Intellekt kundgibt und faßlich macht, ist zunächst die Zeit.
Sie ist die Form, mittelst derer jene Nichtigkeit der Dinge als Vergänglichkeit
derselben erscheint; indem, vermöge dieser, alle unsere Genüsse und
Freuden unter unsern Händen zu Nichts werden und wir nachher verwundert
fragen, wo sie geblieben seien. Jene Nichtigkeit selbst ist daher das
alleinige Objektive der Zeit, d. h. das ihr im Wesen an sich der Dinge
Entsprechende, also das, dessen Ausdruck sie ist. Deshalb eben ist die
Zeit die a priori notwendige Form aller unserer Anschauungen: in ihr muß
sich alles darstellen, auch wir selbst. Demzufolge gleicht nun zunächst
unser Leben einer Zahlung, die man in lauter Kupferpfennigen zugezählt
erhält und dann doch quittieren muß: es sind die Tage; die Quittung
ist der Tod. Denn zuletzt verkündigt die Zeit den Urteilsspruch der Natur
über den Wert aller in ihr erscheinenden Wesen, indem sie sie vernichtet:
Und das mit Recht: denn alles was entsteht,
Ist wert, daß es zu Grunde geht.
Drum besser wär’s, daß nichts entstünde. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] So sind denn Alter und Tod, zu denen jedes Leben notwendig hineilt,
das aus den Händen der Natur selbst erfolgende Verdammungsurteil über
den Willen zum Leben, welches aussagt, daß dieser Wille ein Streben ist,
das sich selbst vereiteln muß. „Was du gewollt hast,“ spricht es,
„endigt so: wolle etwas Besseres.“ — Also die Belehrung, welche
jedem sein Leben gibt, besteht im ganzen darin, daß die Gegenstände
seiner Wünsche beständig täuschen, wanken und fallen, sonach mehr Qual
als Freude bringen, bis endlich sogar der ganze Grund und Boden, auf dem
sie sämtlich stehen, einstürzt, indem sein Leben selbst vernichtet wird
und er so die letzte Bekräftigung erhält, daß all sein Streben und
Wollen eine Verkehrtheit, ein Irrweg war:
Then old age and experience, hand in hand,
Lead him to death, and make him understand,
After a search so painful and so long.
That all his life he has been in the wrong *).
Wir wollen aber noch auf das Spezielle der Sache eingehen; da diese Ansichten
es sind, in denen ich den meisten Widerspruch erfahren habe. — Zuvörderst
habe ich die im Texte gegebene Nachweisung der Negativität aller Befriedigung,
also alles Genusses und alles Glückes, im Gegensatz der Positivität
des Schmerzes, noch durch folgendes zu bekräftigen.
Wir fühlen den Schmerz, aber nicht die Schmerzlosigkeit; wir fühlen
die Sorge, aber nicht die Sorglosigkeit; die Furcht, aber nicht die Sicherheit.
Wir fühlen den Wunsch, wie wir Hunger und Durst fühlen; sobald er aber
erfüllt worden, ist es damit, wie mit dem genossenen Bissen, der in dem
Augenblick, da er verschluckt wird, für unser Gefühl dazusein aufhört.
Genüsse und Freuden vermissen wir schmerzlich, sobald sie ausbleiben:
aber Schmerzen, selbst wenn sie nach langer Anwesenheit ausbleiben, werden
nicht unmittelbar vermißt, sondern höchstens wird absichtlich, mittelst
der Reflexion, ihrer gedacht. Denn nur Schmerz und Mangel können positiv
empfunden werden und kündigen daher sich selbst an: das Wohlsein hingegen
ist bloß negativ. Daher eben werden wir der drei größten Güter des
Lebens, Gesundheit, Jugend und Freiheit, nicht als solcher inne, solange
wir sie besitzen; sondern erst nachdem wir sie verloren haben: denn auch
sie sind Negationen. Daß Tage unsers Lebens glücklich waren, merken
wir erst, nachdem sie unglücklichen Platz gemacht haben. — In dem Maße,
als die Genüsse zunehmen, nimmt die Empfänglichkeit für sie ab: das
Gewohnte wird nicht mehr als Genuß empfunden. Eben dadurch aber nimmt
die Empfänglichkeit für das Leiden zu: denn das Wegfallen des Gewohnten
wird schmerzlich gefühlt. Also wächst durch den Besitz das Maß des
Notwendigen, und dadurch die Fähigkeit Schmerz zu empfinden. — Die
Stunden gehen desto schneller hin, je angenehmer; desto langsamer, je
peinlicher sie zugebracht werden: weil der Schmerz, nicht der Genuß das
Positive ist, dessen Gegenwart sich fühlbar macht. Ebenso werden wir
bei der Langenweile der Zeit inne, bei der Kurzweil nicht. Beides beweist,
daß unser Dasein dann am glücklichsten ist, wann wir es am wenigsten
spüren: woraus folgt, daß es besser wäre, es nicht zu haben. Große,
lebhafte Freude läßt sich schlechterdings nur denken als Folge großer
vorhergegangener Not: denn zu einem Zustande dauernder Zufriedenheit kann
nichts hinzukommen, als etwas Kurzweil, oder auch Befriedigung der Eitelkeit.
Darum sind alle Dichter genötigt, ihre Helden in ängstliche und peinliche
Lagen zu bringen, um sie daraus wieder befreien zu können: Drama und
Epos schildern demnach durchgängig nur kämpfende, leidende, gequälte
Menschen, und jeder Roman ist ein Guckkasten, darin man die Spasmen und
Konvulsionen des geängstigten menschlichen Herzens betrachtet. Diese
ästhetische Notwendigkeit hat Walter Scott naiv dargelegt in der „Konklusion“
zu seiner Novelle Old mortality. — Ganz in Uebereinstimmung mit der
von mir bewiesenen Wahrheit sagt auch der von Natur und Glück so begünstigte
Voltaire: le bonheur n’est qu’un rève, et la douleur est rèelle;
und setzt hinzu: il y a quatre-vingts ans que je l’èprouve. Je n’y
sais autre chose que me rèsigner, et me dire que les mouches sont nèes
pour ètre mangèes par les araignèes, et les hommes pour ètre dèvorès
par les chagrins.
Ehe man so zuversichtlich ausspricht, daß das Leben ein wünschenswertes
oder dankenswertes Gut sei, vergleiche man einmal gelassen die Summe der
nur irgend möglichen Freuden, welche ein Mensch in seinem Leben genießen
kann, mit der Summe der nur irgend möglichen Leiden, die ihn in seinem
Leben treffen können. Ich glaube, die Bilanz wird nicht schwer zu ziehen
sein. Im Grunde aber ist es ganz überflüssig, zu streiten, ob des Guten
oder des Uebeln mehr auf der Welt sei: denn schon das bloße Dasein des
Uebels entscheidet die Sache; da dasselbe nie durch das daneben oder danach
vorhandene Gut getilgt, mithin auch nicht ausgeglichen werden kann:
Mille piacer` non vagliono un tormento **). Petr.
Denn, daß Tausende in Glück und Wonne gelebt hätten, höbe ja nie die
Angst und Todesmarter eines Einzigen auf: und ebensowenig macht mein gegenwärtiges
Wohlsein meine frühern Leiden ungeschehen. Wenn daher des Uebeln auch
hundertmal weniger auf der Welt wäre, als der Fall ist, so wäre dennoch
das bloße Dasein desselben hinreichend, eine Wahrheit zu begründen,
welche sich auf verschiedene Weise, wiewohl immer nur etwas indirekt ausdrücken
läßt, nämlich, daß wir über das Dasein der Welt uns nicht zu freuen,
vielmehr zu betrüben haben; — daß ihr Nichtsein ihrem Dasein vorzuziehen
wäre; — daß sie etwas ist, das im Grunde nicht sein sollte; u. s.
f. Ueberaus schön ist Byrons Ausdruck der Sache:
Our life is a false nature, — ’tis not in
The harmony of things, this hard decree,
This uneradicable taint of sin,
This boundless Upas, this all-blasting tree
Whose root is earth, whose leaves and branches be
The skies, which rain their plagues on men like dew —
Disease, death, bondage — all the woes we see —
And worse, the woes we see not — which throb through
The immedicable soul, with hearth-aches ever new ***). [...]
*) Bis Alter und Erfahrung, Hand in Hand,
Zum Tod ihn führen und er hat erkannt,
Daß, nach so langem, mühevollen Streben,
Er Unrecht hatte, durch sein ganzes Leben.
**) Tausend Genüsse sind nicht eine Qual wert.
***) Unser Leben ist falscher Art: in der Harmonie der Dinge kann es nicht
liegen, dieses harte Verhängnis, diese unausrottbare Seuche der Sünde,
dieser grenzenlose Upas, dieser alles vergiftende Baum, dessen Wurzel
die Erde ist, dessen Blätter und Zweige die Wolken sind, welche ihre
Plagen auf die Menschen herabregnen, wie Tau, — Krankheit, Tod, Knechtschaft,
— all das Wehe, welches wir sehen, — und, was schlimmer, das Wehe,
welches wir nicht sehen, — und welches die unheilbare Seele durchwallt,
mit immer neuem Gram.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Sogar aber läßt sich den handgreiflich sophistischen Beweisen
Leibnizens, daß diese Welt die beste unter den möglichen sei, ernstlich
und ehrlich der Beweis entgegenstellen, daß sie die schlechteste unter
den möglichen sei. Denn möglich heißt nicht was einer etwan sich vorphantasieren
mag, sondern was wirklich existieren und bestehen kann. Nun ist diese
Welt so eingerichtet, wie sie sein mußte, um mit genauer Not bestehen
zu können: wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon
nicht mehr bestehen. Folglich ist eine schlechtere, da sie nicht bestehen
könnte, gar nicht möglich, sie selbst also unter den möglichen die
schlechteste. Denn nicht bloß wenn die Planeten mit den Köpfen gegeneinander
rennten, sondern auch wenn von den wirklich eintretenden Perturbationen
ihres Laufes irgend eine, statt sich durch andere allmählich wieder auszugleichen,
in der Zunahme beharrte, würde die Welt bald ihr Ende erreichen: die
Astronomen wissen, von wie zufälligen Umständen, nämlich zumeist vom
irrationalen Verhältnis der Umlaufszeiten zu einander, dieses abhängt,
und haben mühsam herausgerechnet, daß es immer noch gut abgehen wird,
mithin die Welt so eben stehen und gehen kann. Wir wollen, wiewohl Newton
entgegengesetzter Meinung war, hoffen, daß sie sich nicht verrechnet
haben, und mithin das in so einem Planetensystem verwirklichte mechanische
perpetuum mobile nicht auch, wie die übrigen, zuletzt in Stillstand geraten
werde. — Unter der festen Rinde des Planeten nun wieder hausen die gewaltigen
Naturkräfte, welche, sobald ein Zufall ihnen Spielraum gestattet, jene,
mit allem Lebenden darauf, zerstören müssen; wie dies auf dem unserigen
wenigstens schon dreimal eingetreten ist und wahrscheinlich noch öfter
eintreten wird. Ein Erdbeben von Lissabon, von Haiti, eine Verschüttung
von Pompeji sind nur kleine, schalkhafte Anspielungen auf die Möglichkeit.
— Eine geringe, chemisch gar nicht einmal nachweisbare Alteration der
Atmosphäre verursacht Cholera, gelbes Fieber, schwarzen Tod u. s. w.,
welche Millionen Menschen wegraffen: eine etwas größere würde alles
Leben auslöschen. Eine sehr mäßige Erhöhung der Wärme würde alle
Flüsse und Quellen austrocknen. — Die Tiere haben an Organen und Kräften
genau und knapp so viel erhalten, wie zur Herbeischaffung ihres Lebensunterhalts
und Auffütterung der Brut, unter äußerster Anstrengung, ausreicht;
daher ein Tier, wenn es ein Glied, oder auch nur den vollkommenen Gebrauch
desselben, verliert, meistens umkommen muß. Selbst vom Menschengeschlecht,
so mächtige Werkzeuge es an Verstand und Vernunft auch hat, leben neun
Zehntel in beständigem Kampfe mit dem Mangel, stets am Rande des Untergangs,
sich mit Not und Anstrengung über demselben balancierend. Also durchweg,
wie zum Bestande des Ganzen, so auch zu dem jedes Einzelwesens sind die
Bedingungen knapp und kärglich gegeben, aber nichts darüber: daher geht
das individuelle Leben in unaufhörlichem Kampfe um die Existenz selbst
hin; während bei jedem Schritt ihm Untergang droht. Eben weil diese Drohung
so oft vollzogen wird, mußte, durch den unglaublich großen Ueberschuß
der Keime, dafür gesorgt sein, daß der Untergang der Individuen nicht
den der Geschlechter herbeiführe, als an welchen allein der Natur ernstlich
gelegen ist. — Die Welt ist folglich so schlecht, wie sie möglicherweise
sein kann, wenn sie überhaupt noch sein soll. W. z. b. w. — Die Versteinerungen
der den Planeten ehemals bewohnenden, ganz anderartigen Tiergeschlechter
liefern uns, als Rechnungsprobe, die Dokumente von Welten, deren Bestand
nicht mehr möglich war, die mithin noch etwas schlechter waren, als die
schlechteste unter den möglichen. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Daß moralische Untersuchungen ungleich wichtiger sind, als physikalische,
und überhaupt als alle andern, folgt daraus, daß sie fast unmittelbar
das Ding an sich betreffen, nämlich diejenige Erscheinung desselben,
an der es, vom Lichte der Erkenntnis unmittelbar getroffen, sein Wesen
offenbart als Wille. Physikalische Wahrheiten hingegen bleiben ganz auf
dem Gebiete der Vorstellung, d. i. der Erscheinung, und zeigen bloß,
wie die niedrigsten Erscheinungen des Willens sich in der Vorstellung
gesetzmäßig darstellen. — Ferner bleibt die Betrachtung der Welt von
der physischen Seite, so weit und so glücklich man sie auch verfolgen
mag, in ihren Resultaten für uns trostlos: auf der moralischen Seite
allein ist Trost zu finden; indem hier die Tiefen unsers eigenen Innern
sich der Betrachtung aufthun.
Meine Philosophie ist aber die einzige, welche der Moral ihr volles und
ganzes Recht angedeihen läßt: denn nur wenn das Wesen des Menschen sein
eigener Wille, mithin er, im strengsten Sinne, sein eigenes Werk ist,
sind seine Thaten wirklich ganz sein und ihm zuzurechnen. Sobald er hingegen
einen andern Ursprung hat, oder das Werk eines von ihm verschiedenen Wesens
ist, fällt alle seine Schuld zurück auf diesen Ursprung, oder Urheber.
Denn operari sequitur esse.
Die Kraft, welche das Phänomen der Welt hervorbringt, mithin die Beschaffenheit
derselben bestimmt, in Verbindung zu setzen mit der Moralität der Gesinnung,
und dadurch eine moralische Weltordnung als Grundlage der physischen nachzuweisen,
— dies ist seit Sokrates das Problem der Philosophie gewesen. Der Theismus
leistete es auf eine kindliche Weise, welche der herangereiften Menschheit
nicht genügen konnte. Daher stellte sich ihm der Pantheismus, sobald
er irgend es wagen durfte, entgegen, und wies nach, daß die Natur die
Kraft, vermöge welcher sie hervortritt, in sich selbst trägt. Dabei
mußte nun aber die Ethik verloren gehen. Spinoza versucht zwar, stellenweise,
sie durch Sophismen zu retten, meistens aber gibt er sie geradezu auf
und erklärt, mit einer Dreistigkeit, die Erstaunen und Unwillen hervorruft,
den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, und überhaupt zwischen Gutem
und Bösem, für bloß konventionell, also an sich selbst nichtig (z.
B. Eth., IV, prop. 37, schol. 2). Ueberhaupt ist Spinoza, nachdem ihn,
über hundert Jahre hindurch, unverdiente Geringschätzung getroffen hatte,
durch die Reaktion im Pendelschwung der Meinung, in diesem Jahrhundert
wieder überschätzt worden. — Aller Pantheismus nämlich muß an den
unabweisbaren Forderungen der Ethik, und nächst dem am Uebel und dem
Leiden der Welt, zuletzt scheitern. Ist die Welt eine Theophanie; so ist
alles, was der Mensch, ja, auch das Tier thut, gleich göttlich und vortrefflich:
nichts kann zu tadeln und nichts vor dem andern zu loben sein: also keine
Ethik. Daher eben ist man infolge des erneuerten Spinozismus unserer Tage,
also des Pantheismus, in der Ethik so tief herabgesunken und so platt
geworden, daß man aus ihr eine bloße Anleitung zu einem gehörigen Staats-
und Familienleben machte, als in welchem, also im methodischen, vollendeten,
genießenden und behaglichen Philistertum, der letzte Zweck des menschlichen
Daseins bestehen sollte. Zu dergleichen Plattheiten hat der Pantheismus
freilich erst dadurch geführt, daß man (das e quovis ligno fit Mercurius
arg mißbrauchend) einen gemeinen Kopf, Hegel, durch die allbekannten
Mittel, zu einem großen Philosophen falschmünzte und eine Schar anfangs
subornierter, dann bloß bornierter Jünger desselben das große Wort
erhielt. Dergleichen Attentate gegen den menschlichen Geist bleiben nicht
ungestraft: die Saat ist aufgegangen. Im gleichen Sinne wurde dann behauptet,
die Ethik solle nicht das Thun der Einzelnen, sondern das der Volksmassen
zum Stoffe haben, nur dieses sei ein Thema ihrer würdig. Nichts kann
verkehrter sein, als diese, auf dem plattesten Realismus beruhende Ansicht.
Denn in jedem Einzelnen erscheint der ganze ungeteilte Wille zum Leben,
das Wesen an sich, und der Mikrokosmos ist dem Makrokosmos gleich. Die
Massen haben nicht mehr Inhalt als jeder Einzelne. Nicht vom Thun und
Erfolg, sondern vom Wollen handelt es sich in der Ethik, und das Wollen
selbst geht stets nur im Individuo vor. Nicht das Schicksal der Völker,
welches nur in der Erscheinung da ist, sondern das des Einzelnen entscheidet
sich moralisch. Die Völker sind eigentlich bloße Abstraktionen: die
Individuen allein existieren wirklich. — So also verhält sich der Pantheismus
zur Ethik. — Die Uebel aber und die Qual der Welt stimmten schon nicht
zum Theismus: daher dieser durch allerlei Ausreden, Theodiceen, sich zu
helfen suchte, welche jedoch den Argumenten Humes oder Voltaires unrettbar
unterlagen. Der Pantheismus nun aber ist jenen schlimmen Seiten der Welt
gegenüber vollends unhaltbar. Nur dann nämlich, wann man die Welt ganz
von außen und allein von der physikalischen Seite betrachtet und nichts
anderes, als die sich immer wiederherstellende Ordnung und dadurch komparative
Unvergänglichkeit des Ganzen im Auge behält, geht es allenfalls, doch
immer nur sinnbildlich an, sie für einen Gott zu erklären. Tritt man
aber ins Innere, nimmt also die subjektive und die moralische Seite hinzu,
mit ihrem Uebergewicht von Not, Leiden und Qual, von Zwiespalt, Bosheit,
Verruchtheit und Verkehrtheit; da wird man bald mit Schrecken inne, daß
man nichts weniger als eine Theophanie vor sich hat. — Ich nun aber
habe gezeigt und habe es zumal in der Schrift „Vom Willen in der Natur“
bewiesen, daß die in der Natur treibende und wirkende Kraft identisch
ist mit dem Willen in uns. Dadurch tritt nun wirklich die moralische Weltordnung
in unmittelbaren Zusammenhang mit der das Phänomen der Welt hervorbringenden
Kraft. Denn der Beschaffenheit des Willens muß seine Erscheinung genau
entsprechen: hierauf beruht die §§ 63, 64 der Welt als Wille und Vorstellung
gegebene Darstellung der ewigen Gerechtigkeit, und die Welt, obgleich
aus eigener Kraft bestehend, erhält durchweg eine moralische Tendenz.
Sonach ist jetzt allererst das seit Sokrates angeregte Problem wirklich
gelöst und die Forderung der denkenden, auf das Moralische gerichteten
Vernunft befriedigt. — Nie jedoch habe ich mich vermessen, eine Philosophie
aufzustellen, die keine Fragen mehr übrig ließe. In diesem Sinne ist
Philosophie wirklich unmöglich: sie wäre Allwissenheitslehre. Aber est
quadam prodire tenus, si non datur ultra: es gibt eine Grenze, bis zu
welcher das Nachdenken vordringen und so weit die Nacht unsers Daseins
erhellen kann, wenngleich der Horizont stets dunkel bleibt. Diese Grenze
erreicht meine Lehre im Willen zum Leben, der, auf seine eigene Erscheinung,
sich bejaht oder verneint. Darüber aber noch hinausgehen wollen ist,
in meinen Augen, wie über die Atmosphäre hinausfliegen wollen. Wir müssen
dabei stehen bleiben; wenngleich aus gelösten Problemen neue hervorgehen.
Zudem ist aber darauf zu verweisen, daß die Gültigkeit des Satzes vom
Grunde sich auf die Erscheinung beschränkt: dies war das Thema meiner
ersten, schon 1813 herausgegebenen Abhandlung über jenen Satz. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Dem Willen, der sich nicht verneint, verleiht jede Geburt einen
neuen und verschiedenen Intellekt, — bis er die wahre Beschaffenheit
des Lebens erkannt hat und infolge hievon es nicht mehr will.
Bei dem naturgemäßen Verlauf kommt im Alter das Absterben des Leibes
dem Absterben des Willens entgegen. Die Sucht nach Genüssen verschwindet
leicht mit der Fähigkeit zu denselben. Der Anlaß des heftigsten Wollens,
der Brennpunkt des Willens, der Geschlechtstrieb, erlischt zuerst, wodurch
der Mensch in einen Stand versetzt wird, der dem der Unschuld, die vor
der Entwickelung des Genitalsystems da war, ähnlich ist. Die Illusionen,
welche Chimären als höchst wünschenswerte Güter darstellten, verschwinden,
und an ihre Stelle tritt die Erkenntnis der Nichtigkeit aller irdischen
Güter. Die Selbstsucht wird durch die Liebe zu den Kindern verdrängt,
wodurch der Mensch schon anfängt mehr im fremden Ich zu leben, als im
eigenen, welches nun bald nicht mehr sein wird. Dieser Verlauf ist wenigstens
der wünschenswerte: es ist die Euthanasie des Willens. In Hoffnung auf
denselben ist dem Brahmanen verordnet, nach Zurücklegung der besten Lebensjahre,
Eigentum und Familie zu verlassen und ein Einsiedlerleben zu führen.
(Menu, B. 6.) Aber wenn, umgekehrt, die Gier die Fähigkeit zum Genießen
überlebt, und man jetzt einzelne, im Leben verfehlte Genüsse bereuet,
statt die Leerheit und Nichtigkeit aller einzusehen; und wenn sodann an
die Stelle der Gegenstände der Lüste, für welche der Sinn abgestorben
ist, der abstrakte Repräsentant aller dieser Gegenstände, das Geld,
tritt, welches nunmehr dieselben heftigen Leidenschaften erregt, die ehemals
von den Gegenständen wirklichen Genusses, verzeihlicher, erweckt wurden,
und also jetzt, bei abgestorbenen Sinnen, ein lebloser, aber unzerstörbarer
Gegenstand mit gleich unzerstörbarer Gier gewollt wird; oder auch wenn,
auf gleiche Weise, das Dasein in der fremden Meinung die Stelle des Daseins
und Wirkens in der wirklichen Welt vertreten soll und nun die gleichen
Leidenschaften entzündet, dann hat sich, im Geiz, oder in der Ehrsucht,
der Wille sublimiert und vergeistigt, dadurch aber sich in die letzte
Festung geworfen, in welcher nur noch der Tod ihn belagert. Der Zweck
des Daseins ist verfehlt.
Alle diese Betrachtungen liefern eine nähere Erklärung der im vorigen
Kapitel durch den Ausdruck δευτερος πλους bezeichneten Läuterung,
Wendung des Willens und Erlösung, welche durch die Leiden des Lebens
herbeigeführt wird und ohne Zweifel die häufigste ist. Denn sie ist
der Weg der Sünder, wie wir alle sind. Der andere Weg, der, mittelst
bloßer Erkenntnis und demnächst Aneignung der Leiden einer ganzen Welt,
eben dahin führt, ist die schmale Straße der Auserwählten, der Heiligen,
mithin als eine seltene Ausnahme zu betrachten. Ohne jenen erstern würde
daher für die meisten kein Heil zu hoffen sein. Inzwischen sträuben
wir uns, denselben zu betreten, und streben vielmehr, mit allen Kräften,
uns ein sicheres und angenehmes Dasein zu bereiten, wodurch wir unsern
Willen immer fester an das Leben ketten. Umgekehrt handeln die Asketen,
welche ihr Leben absichtlich möglichst arm, hart und freudenleer machen,
weil sie ihr wahres und letztes Wohl im Auge haben. Aber für uns sorgt
das Schicksal und der Lauf der Dinge besser, als wir selbst, indem es
unsere Anstalten zu einem Schlaraffenleben, dessen Thörichtes schon an
seiner Kürze, Bestandlosigkeit, Leerheit und Beschließung durch den
bittern Tod erkennbar genug ist, allenthalben vereitelt. Dornen über
Dornen auf unsern Pfad streuet und das heilsame Leiden, das Panakeion
unsers Jammers, uns überall entgegenbringt. Wirklich ist was unserm Leben
seinen wunderlichen und zweideutigen Charakter gibt dieses, daß darin
zwei einander diametral entgegengesetzte Grundzwecke sich beständig kreuzen:
der des individuellen Willens, gerichtet auf chimärisches Glück, in
einem ephemeren, traumartigen, täuschenden Dasein, wo hinsichtlich des
Vergangenen Glück und Unglück gleichgültig sind, das Gegenwärtige
aber jeden Augenblick zum Vergangenen wird; und der des Schicksals, sichtlich
genug gerichtet auf Zerstörung unsers Glücks und dadurch auf Mortifikation
unsers Willens und Aufhebung des Wahnes, der uns in den Banden dieser
Welt gefesselt hält. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Der Begründer des systematischen Optimismus hingegen ist Leibniz,
dessen Verdienste um die Philosophie zu leugnen ich nicht gesonnen bin,
wiewohl mich in die Monadologie, prästabilierte Harmonie und identitas
indiscernibilium eigentlich hineinzudenken, mir nie hat gelingen wollen.
Seine Nouveaux essays sur L`entendement aber sind bloß ein Excerpt, mit
ausführlicher, auf Berichtigung abgesehener, jedoch schwacher Kritik
des mit Recht weltberühmten Werkes Lockes, welchem er hier mit ebensowenig
Glück sich entgegenstellt, wie, durch sein gegen das Gravitationssystem
gerichtetes Tentamen de motuum coelestium causis, dem Newton. Gegen diese
Leibniz=Wolfische Philosophie ist die Kritik der reinen Vernunft ganz
speziell gerichtet und hat zu ihr ein polemisches, ja, vernichtendes Verhältnis;
wie zu Locke und Hume das der Fortsetzung und Weiterbildung. Daß heutzutage
die Philosophieprofessoren allseitig bemüht sind, den Leibniz, mit seinen
Flausen, wieder auf die Beine zu bringen, ja, zu verherrlichen, und andererseits
Kanten möglichst gering zu schätzen und beiseite zu schieben, hat seinen
guten Grund im primum vivere: die Kritik der reinen Vernunft läßt nämlich
nicht zu, daß man jüdische Mythologie für Philosophie ausgebe, noch
auch, daß man, ohne Umstände, von der „Seele“ als einer gegebenen
Realität, einer wohlbekannten und gut akkreditierten Person, rede, ohne
Rechenschaft zu geben, wie man denn zu diesem Begriff gekommen sei und
welche Berechtigung man habe, ihn wissenschaftlich zu gebrauchen. Aber
primum vivere, deinde philosophari! Herunter mit dem Kant, vivat unser
Leibniz! — Auf diesen also zurückzukommen, kann ich der Theodicee,
dieser methodischen und breiten Entfaltung des Optimismus, in solcher
Eigenschaft, kein anderes Verdienst zugestehen, als dieses, daß sie später
Anlaß gegeben hat zum unsterblichen Candide des großen Voltaire; wodurch
freilich Leibnizens so oft wiederholte, lahme Exküse für die Uebel der
Welt, daß nämlich das Schlechte bisweilen das Gute herbeiführt, einen
ihm unerwarteten Beleg erhalten hat. Schon durch den Namen seines Helden
deutete Voltaire an, daß es nur der Aufrichtigkeit bedarf, um das Gegenteil
des Optimismus zu erkennen. Wirklich macht auf diesem Schauplatz der Sünde,
des Leidens und des Todes der Optimismus eine so seltsame Figur, daß
man ihn für Ironie halten müßte, hätte man nicht an der von Hume,
wie oben erwähnt, so ergötzlich aufgedeckten geheimen Quelle desselben
(nämlich heuchelnde Schmeichelei, mit beleidigendem Vertrauen auf ihren
Erfolg) eine hinreichende Erklärung seines Ursprungs. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Der Optimismus ist im Grunde das unberechtigte Selbstlob des eigentlichen
Urhebers der Welt, des Willens zum Leben, der sich wohlgefällig in seinem
Werke spiegelt: und demgemäß ist er nicht nur eine falsche, sondern
auch eine verderbliche Lehre. Denn er stellt uns das Leben als einen wünschenswerten
Zustand, und als Zweck desselben das Glück des Menschen dar. Davon ausgehend
glaubt dann jeder den gerechtesten Anspruch auf Glück und Genuß zu haben:
werden nun diese, wie es zu geschehen pflegt, ihm nicht zu teil; so glaubt
er, ihm geschehe unrecht, ja, er verfehle den Zweck seines Daseins; —
während es viel richtiger ist, Arbeit, Entbehrung, Not und Leiden, gekrönt
durch den Tod, als Zweck unsers Lebens zu betrachten (wie dies Brahmanismus
und Buddhaismus, und auch das echte Christentum thun); weil diese es sind,
die zur Verneinung des Willens zum Leben leiten. Im Neuen Testamente ist
die Welt dargestellt als ein Jammerthal, das Leben als ein Läuterungsprozeß,
und ein Marterinstrument ist das Symbol des Christentums. Daher beruhte,
als Leibniz, Shaftesbury, Bolingbroke und Pope mit dem Optimismus hervortraten,
der Anstoß, den man allgemein daran nahm, hauptsächlich darauf, daß
der Optimismus mit dem Christentum unvereinbar sei; wie dies Voltaire,
in der Vorrede zu seinem vortrefflichen Gedichte Le dèsastre de Lisbonne,
welches ebenfalls ausdrücklich gegen den Optimismus gerichtet ist, berichtet
und erläutert. Was diesen großen Mann, den ich, den Schmähungen feiler
deutscher Tintenkleckser gegenüber, so gern lobe, entschieden höher
als Rousseau stellt, indem es die größere Tiefe seines Denkens bezeugt,
sind drei Einsichten, zu denen er gelangt war: 1. die von der überwiegenden
Größe des Uebels und vom Jammer des Daseins, davon er tief durchdrungen
ist; 2. die von der strengen Recessitation der Willensakte; 3. die von
der Wahrheit des Lockeschen Satzes, daß möglicherweise das Denkende
auch materiell sein könne; während Rousseau alles dieses durch Deklamationen
bestreitet, in seiner Profession de foi du vicaire Savoyard, einer flachen
protestantischen Pastorenphilosophie; wie er denn auch, in eben diesem
Geiste, gegen das soeben erwähnte, schöne Gedicht Voltaires mit einem
schiefen, seichten und logisch falschen Raisonnement, zu Gunsten des Optimismus,
polemisiert, in seinem, bloß diesem Zweck gewidmeten, langen Briefe an
Voltaire, vom 18. August 1756. Ja, der Grundzug und das πρωτον ψευδος
der ganzen Philosophie Rousseaus ist dieses, daß er an die Stelle der
christlichen Lehre von der Erbsünde und der ursprünglichen Verderbtheit
des Menschengeschlechts, eine ursprüngliche Güte und unbegrenzte Perfektibilität
desselben setzt, welche bloß durch die Zivilisation und deren Folgen
auf Abwege geraten wäre, und nun darauf seinen Optimismus und Humanismus
gründet.
Wie gegen den Optimismus Voltaire, im Candide, den Krieg in seiner scherzhaften
Manier führt, so hat es in seiner ernsten und tragischen Byron gethan,
in seinem unsterblichen Meisterwerke Kain, weshalb er auch durch die Invektiven
des Obskuranten Friedrich Schlegel verherrlicht worden ist. — Wollte
ich nun schließlich, zur Bekräftigung meiner Ansicht, die Aussprüche
großer Geister aller Zeiten, in diesem, dem Optimismus entgegengesetzten
Sinne, hersetzen; so würde der Anführungen kein Ende sein; da fast jeder
derselben seine Erkenntnis des Jammers dieser Welt in starken Worten ausgesprochen
hat. Also nicht zur Bestätigung, sondern bloß zur Verzierung dieses
Kapitels mögen am Schlusse desselben einige Aussprüche dieser Art Platz
finden. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In § 14 meiner Preisschrift über die Grundlage der Moral findet
man eine Darstellung des Egoismus, seinem Wesen nach, als deren Ergänzung
folgender Versuch, seine Wurzel aufzudecken, zu betrachten ist. — Die
Natur selbst widerspricht sich geradezu, je nachdem sie vom Einzelnen
oder vom Allgemeinen aus, von innen oder von außen, vom Centro oder von
der Peripherie aus redet. Ihr Centrum nämlich hat sie in jedem Individuo:
denn jedes ist der ganze Wille zum Leben. Daher, sei dasselbe auch nur
ein Insekt, oder ein Wurm, die Natur selbst aus ihm also redet: „Ich
allein bin alles in allem: an meiner Erhaltung ist alles gelegen, das
übrige mag zu Grunde gehen, es ist eigentlich nichts.“ So redet die
Natur vom besondern Standpunkte, also von dem des Selbstbewußtseins aus,
und hierauf beruht der Egoismus jedes Lebenden. Hingegen vom allgemeinen
Standpunkt aus, — welches der des Bewußtseins von andern Dingen, also
der des objektiven Erkennens ist, das für den Augenblick absieht von
dem Individuo, an dem die Erkenntnis haftet, — also von außen, von
der Peripherie aus, redet die Natur so: „Das Individuum ist nichts und
weniger als nichts. Millionen Individuen zerstöre ich tagtäglich, zum
Spiel und Zeitvertreib: ich gebe ihr Geschick dem launigsten und mutwilligsten
meiner Kinder preis, dem Zufall, der nach Belieben auf sie Jagd macht.
Millionen neuer Individuen schaffe ich jeden Tag, ohne alle Verminderung
meiner hervorbringenden Kraft; so wenig wie die Kraft eines Spiegels erschöpft
wird durch die Zahl der Sonnenbilder, die er nacheinander auf die Wand
wirft. Das Individuum ist nichts.“ — Nur wer diesen offenbaren Widerspruch
der Natur wirklich zu vereinen und auszugleichen weiß, hat eine wahre
Antwort auf die Frage nach der Vergänglichkeit oder Unvergänglichkeit
seines eigenen Selbst. Ich glaube in den ersten vier Kapiteln dieses vierten
Buches der Ergänzungen eine förderliche Anleitung zu solcher Erkenntnis
gegeben zu haben. Das Obige läßt übrigens sich auch folgendermaßen
erläutern. Jedes Individuum, indem es nach innen blickt, erkennt in seinem
Wesen, welches sein Wille ist, das Ding an sich, daher das überall allein
Reale. Demnach erfaßt es sich als den Kern und Mittelpunkt der Welt und
findet sich unendlich wichtig. Blickt es hingegen nach außen; so ist
es auf dem Gebiete der Vorstellung, der bloßen Erscheinung, wo es sich
sieht als ein Individuum unter unendlich vielen Individuen, sonach als
ein höchst Unbedeutendes, ja gänzlich Verschwindendes. Folglich ist
jedes, auch das unbedeutendeste Individuum, jedes Ich, von innen gesehen,
alles in allem; von außen gesehen hingegen, ist es nichts, oder doch
so viel wie nichts. Hierauf also beruht der große Unterschied zwischen
dem, was notwendig jeder in seinen eigenen Augen, und dem, was er in den
Augen aller andern ist, mithin der Egoismus, den jeder jedem vorwirft.
—
Infolge dieses Egoismus ist unser Aller Grundirrtum dieser, daß wir einander
gegenseitig Nicht-Ich sind. Hingegen ist gerecht, edel, menschenfreundlich
sein, nichts anderes, als meine Metaphysik in Handlungen übersetzen.
— Sagen, daß Zeit und Raum bloße Formen unserer Erkenntnis, nicht
Bestimmungen der Dinge an sich sind, ist dasselbe, wie sagen, daß die
Metempsychosenlehre, „du wirst einst als der, den du jetzt verletzest,
wiedergeboren werden und die gleiche Verletzung erleiden“, identisch
ist mit der oft erwähnten Brahmanenformel Tat twam asi, „Dies bist
du“. — Aus der unmittelbaren und intuitiven Erkenntnis der metaphysischen
Identität aller Wesen geht, wie ich öfter, besonders § 22 der Preisschrift
über die Grundlage der Moral, gezeigt habe, alle echte Tugend hervor.
Sie ist aber deswegen nicht die Folge einer besondern Ueberlegenheit des
Intellekts; vielmehr ist selbst der schwächste hinreichend, das principium
individuationis zu durchschauen, als worauf es dabei ankommt. Demgemäß
kann man den vortrefflichsten Charakter sogar bei einem schwachen Verstande
finden, und ist ferner die Erregung unsers Mitleids von keiner Anstrengung
unsers Intellekts begleitet. Es scheint vielmehr, daß die erforderte
Durchschauung des principii individuationis in jedem Vorhanden sein würde,
wenn nicht sein Wille sich ihr widersetzte, als welcher, vermöge seines
unmittelbaren, geheimen und despotischen Einflusses auf den Intellekt
sie meistens nicht aufkommen läßt, so daß alle Schuld zuletzt doch
auf den Willen zurückfällt; wie es auch der Sache angemessen ist.
Die oben berührte Lehre von der Metempsychose entfernt sich bloß dadurch
von der Wahrheit, daß sie in die Zukunft verlegt, was schon jetzt ist.
Sie läßt nämlich mein inneres Wesen an sich selbst erst nach meinem
Tode in Andern dasein, während, der Wahrheit nach, es schon jetzt auch
in ihnen lebt, und der Tod bloß die Täuschung, vermöge deren ich dessen
nicht inne werde, aufhebt; gleichwie das zahllose Heer der Sterne allezeit
über unserm Haupte leuchtet, aber uns erst sichtbar wird, wann die eine
nahe Erdensonne untergegangen ist. Von diesem Standpunkt aus erscheint
meine individuelle Existenz, so sehr sie auch, jener Sonne gleich, mir
alles überstrahlt, im Grunde doch nur als ein Hindernis, welches zwischen
mir und der Erkenntnis des wahren Umfangs meines Wesens steht. Und weil
jedes Individuum, in seiner Erkenntnis, diesem Hindernis unterliegt; so
ist es eben die Individuation, welche den Willen zum Leben über sein
eigenes Wesen im Irrtum erhält: sie ist die Maja des Brahmanismus. Der
Tod ist eine Widerlegung dieses Irrtums und hebt ihn auf. Ich glaube,
wir werden im Augenblicke des Sterbens inne, daß eine bloße Täuschung
unser Dasein auf unsere Person beschränkt hatte. Sogar empirische Spuren
hievon lassen sich nachweisen in manchen dem Tode, durch Aufhebung der
Konzentration des Bewußtseins im Gehirn, verwandten Zuständen, unter
denen der magnetische Schlaf der hervorstechendeste ist, als in welchem,
wenn er die höheren Grade erreicht, unser Dasein, über unsere Person
hinaus und in andern Wesen, sich durch mancherlei Symptome kundgibt, am
auffallendesten durch unmittelbare Teilnahme an den Gedanken eines andern
Individuums, zuletzt sogar durch die Fähigkeit, das Abwesende, Entfernte,
ja, das Zukünftige zu erkennen, also durch eine Art von Allgegenwart.
Auf dieser metaphysischen Identität des Willens, als des Dinges an sich,
bei der zahllosen Vielheit seiner Erscheinungen, beruhen überhaupt drei
Phänomene, welche man unter den gemeinsamen Begriff der Sympathie bringen
kann: 1. das Mitleid, welches, wie ich dargethan habe, die Basis der Gerechtigkeit
und Menschenliebe, caritas, ist; 2. die Geschlechtsliebe mit eigensinniger
Auswahl, amor, welche das Leben der Gattung ist, das seinen Vorrang vor
dem der Individuen geltend macht; 3. die Magie, zu welcher auch der animalische
Magnetismus und die sympathetischen Kuren gehören. Demnach ist Sympathie
zu definieren: das empirische Hervortreten der metaphysischen Identität
des Willens, durch die physische Vielheit seiner Erscheinungen hindurch,
wodurch sich ein Zusammenhang kundgibt, der gänzlich verschieden ist
von dem durch die Formen der Erscheinung vermittelten, den wir unter dem
Satze vom Grunde begreifen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Der Mensch hat sein Dasein und Wesen entweder mit seinem Willen, d. h.
seiner Einwilligung, oder ohne diese: im letztern Falle wäre eine solche,
durch vielfache und unausbleibliche Leiden verbitterte Existenz eine schreiende
Ungerechtigkeit. — Die Alten, namentlich die Stoiker, auch die Peripatetiker
und Akademiker, bemühten sich vergeblich, zu beweisen, daß die Tugend
hinreiche, das Leben glücklich zu machen: die Erfahrung schrie laut dagegen.
Was dem Bemühen jener Philosophen, wenngleich ihnen nicht deutlich bewußt,
eigentlich zum Grunde lag, war die vorausgesetzte Gerechtigkeit der Sache:
wer schuldlos war, sollte auch frei von Leiden, also glücklich sein.
Allein die ernstliche und tiefe Lösung des Problems liegt in der christlichen
Lehre, daß die Werke nicht rechtfertigen; demnach ein Mensch, wenn er
auch alle Gerechtigkeit und Menschenliebe, mithin das αγαϑον, honestum,
ausgeübt hat, dennoch nicht, wie Cicero meint, culpa omni carens (Tusc.
V, 1), ist: sondern el delito mayor del hombre es haber nacido (des Menschen
größte Schuld ist, daß er geboren ward), wie es, aus viel tieferer
Erkenntnis, als jene Weisen, der durch das Christentum erleuchtete Dichter
Calderon ausgedrückt hat. Daß demnach der Mensch schon verschuldet auf
die Welt kommt, kann nur dem widersinnig erscheinen, der ihn für erst
soeben aus Nichts geworden und für das Werk eines Andern hält. Infolge
dieser Schuld also, die daher von seinem Willen ausgegangen sein muß,
bleibt der Mensch, mit Recht, auch wenn er alle jene Tugenden geübt hat,
den physischen und geistigen Leiden preisgegeben, ist also nicht glücklich.
Dies folgt aus der ewigen Gerechtigkeit, von der ich § 63 der Welt als
Wille und Vorstellung geredet habe. Daß aber, wie St. Paulus (Röm. 3,
21 ff.), Augustinus und Luther lehren, die Werke nicht rechtfertigen können,
indem wir alle wesentlich Sünder sind und bleiben, — beruht zuletzt
darauf, daß, weil operari sequitur esse, wenn wir handelten, wie wir
sollten, wir auch sein müßten, was wir sollten. Dann aber bedürften
wir keiner Erlösung aus unserm jetzigen Zustande, wie solche nicht nur
das Christentum, sondern auch Brahmanismus und Buddhaismus (unter dem
auf englisch durch final emancipation ausgedrückten Namen) als das höchste
Ziel darstellen: d. h. wir brauchten nicht etwas ganz anderes, ja, dem
was wir sind Entgegengesetztes, zu werden. Weil wir aber sind, was wir
nicht sein sollten, thun wir auch notwendig, was wir nicht thun sollten.
Darum also bedürfen wir einer völligen Umgestaltung unsers Sinnes und
Wesens, d. i. der Wiedergeburt, als deren Folge die Erlösung eintritt.
Wenn auch die Schuld im Handeln, im operari, liegt; so liegt doch die
Wurzel der Schuld in unserer essentia et existentia, da aus dieser das
operari notwendig hervorgeht, wie ich in der Preisschrift über die Freiheit
des Willens dargethan habe. Demnach ist eigentlich unsere einzige wahre
Sünde die Erbsünde. Diese nun läßt der christliche Mythos zwar erst,
nachdem der Mensch schon da war, entstehen, und dichtet ihm dazu, per
impossibile, einen freien Willen an: dies thut er aber eben als Mythos.
Der innerste Kern und Geist des Christentums ist mit dem des Brahmanismus
und Buddhaismus derselbe: sämtlich lehren sie eine schwere Verschuldung
des Menschengeschlechts durch sein Dasein selbst; nur daß das Christentum
hiebei nicht, wie jene älteren Glaubenslehren, direkt und unumwunden
verfährt, also nicht die Schuld geradezu durch das Dasein selbst gesetzt
sein, sondern sie durch eine That des ersten Menschenpaares entstehen
läßt. Dies war nur unter der Fiktion eines liberi arbitrii indifferentiae
möglich, und nur wegen des jüdischen Grunddogmas, dem jene Lehre hier
eingepflanzt werden sollte, nötig. Weil, der Wahrheit nach, eben das
Entstehen des Menschen selbst die That seines freien Willens und demnach
mit dem Sündenfall eins ist, und daher mit der essentia und existentia
des Menschen die Erbsünde, von der alle andern Sünden die Folge sind,
schon eintrat, das jüdische Grunddogma aber eine solche Darstellung nicht
zuließ; so lehrte Augustinus, in seinen Büchern De libero arbitrio,
daß der Mensch nur als Adam vor dem Sündenfalle schuldlos gewesen und
einen freien Willen gehabt habe, von dem an aber in der Notwendigkeit
der Sünde verstrickt sei. — Das Gesetz, ό νομος, im biblischen
Sinn, fordert immerfort, daß wir unser Thun ändern sollen, während
unser Wesen unverändert bliebe. Weil aber dies unmöglich ist; so sagt
Paulus, daß keiner vor dem Gesetz gerechtfertigt sei: die Wiedergeburt
in Jesu Christo allein, infolge der Gnadenwirkung, vermöge welcher ein
neuer Mensch entsteht und der alte aufgehoben wird (d. h. eine fundamentale
Sinnesänderung), könne uns aus dem Zustande der Sündhaftigkeit in den
der Freiheit und Erlösung versetzen. Dies ist der christliche Mythos,
in Hinsicht auf die Ethik. Aber freilich hat der jüdische Theismus, auf
den er gepfropft wurde, gar wundersame Zusätze erhalten müssen, um sich
jenem Mythos anzufügen: dabei bot die Fabel vom Sündenfall die einzige
Stelle dar für das Pfropfreis altindischen Stammes. Jener gewaltsam überwundenen
Schwierigkeit eben ist es zuzuschreiben, daß die christlichen Mysterien
ein so seltsames, dem gemeinen Verstande widerstrebendes Ansehen erhalten
haben, welches den Proselytismus erschwert und wegen dessen, aus Unfähigkeit
den tiefen Sinn derselben zu fassen, der Pelagianismus, oder heutige Rationalismus,
sich gegen sie auflehnt und sie wegzuexegesieren sucht, dadurch aber das
Christentum zum Judentum zurückführt. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens habe ich (S.
81 ff. dieser Ausgabe) die Ursprünglichkeit und Unveränderlichkeit des
angeborenen Charakters, aus welchem der moralische Gehalt des Lebenswandels
hervorgeht, nachgewiesen. Sie steht als Thatsache fest. Aber um die Probleme
in ihrer Größe zu erfassen, ist es nötig, die Gegensätze bisweilen
hart aneinander zu stellen. An diesen also vergegenwärtige man sich,
wie unglaublich groß der angeborene Unterschied zwischen Mensch und Mensch
ausfällt im moralischen und im intellektuellen. Hier Edelmut und Weisheit,
dort Bosheit und Dummheit. Dem einen leuchtet die Güte des Herzens aus
den Augen, oder auch der Stempel des Genies thront auf seinem Antlitz.
Der niederträchtigen Physiognomie eines andern ist das Gepräge moralischer
Nichtswürdigkeit und intellektueller Stumpfheit, von den Händen der
Natur selbst, unverkennbar und unauslöschlich aufgedrückt: er sieht
darein, als müßte er sich seines Daseins schämen. Diesem Aeußern aber
entspricht wirklich das Innere. Unmöglich können wir annehmen, daß
solche Unterschiede, die das ganze Wesen des Menschen umgestalten und
durch nichts aufzuheben sind, welche ferner, im Konflikt mit den Umständen,
seinen Lebenslauf bestimmen, ohne Schuld oder Verdienst der damit Behafteten
vorhanden sein könnten und das bloße Werk des Zufalls wären. Schon
hieraus ist evident, daß der Mensch, in gewissem Sinne, sein eigenes
Werk sein muß. Nun aber können wir andererseits den Ursprung jener Unterschiede
empirisch nachweisen in der Beschaffenheit der Eltern; und noch dazu ist
das Zusammentreffen und die Verbindung dieser Eltern offenbar das Werk
höchst zufälliger Umstände gewesen. — Durch solche Betrachtungen
nun werden wir mächtig hingewiesen auf den Unterschied zwischen der Erscheinung
und dem Wesen an sich der Dinge, als welcher allein die Lösung jenes
Problems enthalten kann. Nur mittelst der Formen der Erscheinung offenbart
sich das Ding an sich: was daher aus diesem selbst hervorgeht, muß dennoch
in jenen Formen, also auch am Bande der Ursächlichkeit auftreten: demzufolge
wird es hier sich uns darstellen als das Werk einer geheimen, uns unbegreiflichen
Leitung der Dinge, deren bloßes Werkzeug der äußere, erfahrungsmäßige
Zusammenhang wäre, in welchem inzwischen alles was geschieht durch Ursachen
herbeigeführt, also notwendig und von außen bestimmt eintritt, während
der wahre Grund davon im Innern des also erscheinenden Wesens liegt. Freilich
können wir hier die Lösung des Problems nur ganz von weitem absehen,
und geraten, indem wir ihm nachdenken, in einen Abgrund von Gedanken,
recht eigentlich, wie Hamlet sagt, thoughts beyond the reaches of our
souls. Ueber diese geheime, ja selbst nur gleichnisweise zu denkende Leitung
der Dinge habe ich meine Gedanken dargelegt in dem Aufsatz „Ueber die
anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen“, im ersten
Theile der Parerga. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Urteilen aus eigenen Mitteln ist das Vorrecht weniger; die übrigen
leitet Autorität und Beispiel. Sie sehen mit fremden Augen und hören
mit fremden Ohren. Daher ist es gar leicht, zu denken, wie jetzt alle
Welt denkt; aber zu denken, wie alle Welt über dreißig Jahre denken
wird, ist nicht jedermanns Sache. Wer nun also, an die Estime sur parole
gewöhnt, die Verehrungswürdigkeit eines Schriftstellers auf Kredit angenommen
hat, solche aber nachher auch bei andern geltend machen will, kann leicht
in die Lage dessen geraten, der einen schlechten Wechsel diskontiert hat,
welchen er, als er ihn honoriert zu sehen erwartet, mit bitterm Protest
zurückerhält, und sich die Lehre geben muß, ein andermal die Firma
des Ausstellers und die der Indossanten besser zu prüfen. Ich müßte
meine aufrichtige Ueberzeugung verleugnen, wenn ich nicht annähme, daß
auf den Ehrentitel eines summi philosophi, welchen die Dänische Akademie
in Bezug auf jenen Papier-, Zeit- und Kopfverderber (Hegel)
gebraucht hat, das in Deutschland über denselben künstlich veranstaltete
Lobgeschrei, nebst der großen Anzahl seiner Parteigänger überwiegenden
Einfluß gehabt hat. Deshalb scheint es mir zweckmäßig, der Königlich
Dänischen Societät die schöne Stelle in Erinnerung zu bringen, mit
welcher ein wirklicher summus philosophus, Locke (dem es zur Ehre gereicht,
von Fichten der schlechteste aller Philosophen genannt zu sein), das vorletzte
Kapitel seines berühmten Meisterwerkes schließt, und die ich hier, zu
Gunsten des deutschen Lesers, deutsch wiedergeben will:
“So groß auch der Lärm ist, der in der Welt über Irrtümer und Meinungen
gemacht wird; so muß ich doch der Menschheit die Gerechtigkeit widerfahren
lassen, zu sagen, daß nicht so Viele, als man gewöhnlich annimmt, in
Irrtümern und falschen Meinungen befangen sind. Nicht daß ich dächte,
sie erkennten die Wahrheit; sondern weil sie hinsichtlich jener Lehren,
mit welchen sie sich und andern so viel zu schaffen machen, in der That
gar keine Meinungen und Gedanken haben. Denn wenn jemand den größten
Teil aller Parteigänger der meisten Sekten auf der Welt ein wenig katechisierte;
so würde er nicht finden, daß sie hinsichtlich der Dinge, für die sie
so gewaltig eifern, irgend eine Meinung selbst hegten, und noch weniger
würde er Ursache finden, zu glauben, daß sie eine solche infolge einer
Prüfung der Gründe und eines Anscheins der Wahrheit angenommen hätten.
Sondern sie sind entschlossen, der Partei, für welche Erziehung oder
Interesse sie geworben haben, fest anzuhängen, und legen, gleich dem
gemeinen Soldaten im Heere, ihren Mut und Eifer an den Tag, der Lenkung
ihrer Führer gemäß, ohne die Sache, für welche sie streiten, jemals
zu prüfen, oder auch selbst nur zu kennen. Wenn der Lebenswandel eines
Menschen anzeigt, daß er auf die Religion keine ernstliche Rücksicht
nimmt; warum sollen wir denn glauben, daß er über die Satzungen der
Kirche sich den Kopf zerbrechen und sich anstrengen werde, die Gründe
dieser oder jener Lehre zu prüfen? Ihm genügt es, daß er, seinen Lenkern
gehorsam, Hand und Zunge stets bereit habe zur Unterstützung der gemeinsamen
Sache, um dadurch sich denen zu bewähren, welche ihm Ansehen, Beförderung
und Protektion, in der Gesellschaft, der er angehört, erteilen können.
So werden Menschen Bekenner und Vorkämpfer von Meinungen, von welchen
sie nie sich überzeugt, deren Proselyten sie nie geworden, ja, die niemals
ihnen auch nur im Kopf herumgegangen sind. Obwohl man also nicht sagen
kann, daß die Zahl der unwahrscheinlichen und irrigen Meinungen in der
Welt kleiner sei, als sie vorliegt; so ist doch gewiß, daß denselben
wenigere wirklich anhängen und sie fälschlich für Wahrheiten halten,
als man sich vorzustellen pflegt.“
Wohl hat Locke recht: wer gute Löhnung gibt, findet jederzeit eine Armee,
und sollte auch seine Sache die schlechteste auf der Welt sein. Durch
tüchtige Subsidien kann man, so gut wie einen schlechten Prätendenten,
auch einen schlechten Philosophen eine Weile obenauf erhalten. Jedoch
hat Locke hier noch eine ganze Klasse der Anhänger irriger Meinungen
und Verbreiter falschen Ruhmes unberücksichtigt gelassen, und zwar die,
welche den rechten Troß, das Gros de l`armèe derselben ausmacht: ich
meine die Zahl derer, welche nicht prätendieren, z. B. Professoren der
Hegelei zu werden, oder sonstige Pfründen zu genießen, sondern als reine
Gimpel (gulls), im Gefühl der völligen Impotenz ihrer Urteilskraft,
denen, die ihnen zu imponieren verstehen, nachschwätzen, wo sie Zulauf
sehen, sich anschließen und mittrollen, und wo sie Lärm hören, mitschreien.
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die Philosophie hat ihren Wert und ihre Würde darin, daß sie alle
nicht zu begründenden Annahmen verschmäht und in ihre Data nur das aufnimmt,
was sich in der anschaulich gegebenen Außenwelt, in den unsern Intellekt
konstituierenden Formen zur Auffassung derselben und in dem Allen gemeinsamen
Bewußtsein des eigenen Selbst sicher nachweisen läßt. Dieserhalb muß
sie Kosmologie bleiben und kann nicht Theologie werden. Ihr Thema muß
sich auf die Welt beschränken: was diese sei, im tiefsten Innern sei,
allseitig auszusprechen, ist alles, was sie redlicherweise leisten kann.
— Diesem nun entspricht es, daß meine Lehre, wann auf ihrem Gipfelpunkte
angelangt, einen negativen Charakter annimmt, also mit einer Negation
endigt. Sie kann hier nämlich nur von dem reden, was verneint, aufgegeben
wird: was dafür aber gewonnen, ergriffen wird, ist sie genötigt (am
Schlusse des vierten Buchs) als Nichts zu bezeichnen, und kann bloß den
Trost hinzufügen, daß es nur ein relatives, kein absolutes Nichts sei.
Denn, wenn etwas nichts ist von allen dem, was wir kennen; so ist es allerdings
für uns überhaupt nichts. Dennoch folgt hieraus noch nicht, daß es
absolut nichts sei, daß es nämlich auch von jedem möglichen Standpunkt
aus und in jedem möglichen Sinne nichts sein müsse; sondern nur, daß
wir auf eine völlig negative Erkenntnis desselben beschränkt sind; welches
sehr wohl an der Beschränkung unsers Standpunkts liegen kann. — Hier
nun gerade ist es, wo der Mystiker positiv verfährt, und von wo an daher
nichts, als Mystik übrig bleibt. Wer inzwischen zu der negativen Erkenntnis,
bis zu welcher allein die Philosophie ihn leiten kann, diese Art von Ergänzung
wünscht, der findet sie am schönsten und reichlichsten im Oupnekhat,
sodann in den Enneaden des Plotinos, im Scotus Erigena, stellenweise im
Jakob Böhm, besonders aber in dem wundervollen Werk der Guion, Les torrens,
und im Angelus Silesius, endlich noch in den Gedichten der Sufi, von denen
Tholuk uns eine Sammlung in lateinischer und eine andere in deutscher
Uebersetzung geliefert hat, auch noch in manchen andern Werken. Die Sufi
sind die Gnostiker des Islams; daher auch Sadi sie mit einem Worte bezeichnet,
welches durch „Einsichtsvoll“ übersetzt wird. Der Theismus, auf die
Kapazität der Menge berechnet, setzt den Urquell des Daseins außer uns,
als ein Objekt: alle Mystik, und so auch der Sufismus, zieht ihn, auf
den verschiedenen Stufen ihrer Weihe, allmählich wieder ein, in uns,
als das Subjekt, und der Adept erkennt zuletzt, mit Verwunderung und Freude,
daß er es selbst ist. Diesen, aller Mystik gemeinsamen Hergang finden
wir von Meister Eckhard, dem Vater der deutschen Mystik, nicht nur in
Form einer Vorschrift für den vollendeten Asketen ausgesprochen, „daß
er Gott außer sich selbst nicht suche“ (Eckhards Werke, herausgegeben
von Pfeiffer, Bd. 1, S. 626); sondern auch höchst naiv dadurch dargestellt,
daß Eckhards geistige Tochter, nachdem sie jene Umwandelung an sich erfahren,
ihn aufsucht, um ihm jubelnd entgegenzurufen: „Herr, freuet Euch mit
mir, ich bin Gott geworden!“ (Ebendas. S. 465). Eben diesem Geiste gemäß
äußert sich durchgängig auch die Mystik der Sufi hauptsächlich als
ein Schwelgen in dem Bewußtsein, daß man selbst der Kern der Welt und
die Quelle alles Daseins ist, zu der alles zurückkehrt. Zwar kommt dabei
die Aufforderung zum Aufgeben alles Wollens, als wodurch allein die Befreiung
von der individuellen Existenz und ihren Leiden möglich ist, auch oft
vor, jedoch untergeordnet und als etwas Leichtes gefordert. In der Mystik
der Hindu hingegen tritt die letztere Seite viel stärker hervor, und
in der christlichen Mystik ist diese ganz vorherrschend, so daß jenes
pantheistische Bewußtsein, welches aller Mystik wesentlich ist, hier
erst sekundär, infolge des Aufgebens alles Wollens, als Vereinigung mit
Gott eintritt. Dieser Verschiedenheit der Auffassung entsprechend hat
die mohammedanische Mystik einen sehr heitern Charakter, die christliche
einen düstern und schmerzlichen, die der Hindu, über beiden stehend,
hält auch in dieser Hinsicht die Mitte.
Quietismus, d. i. Aufgeben alles Wollens, Askesis, d. i. absichtliche
Ertötung des Eigenwillens, und Mystizismus, d. i. Bewußtsein der Identität
seines eigenen Wesens mit dem aller Dinge, oder dem Kern der Welt, stehen
in genauester Verbindung; so daß wer sich zu einem derselben bekennt,
allmählich auch zur Annahme der andern, selbst gegen seinen Vorsatz,
geleitet wird. — Nichts kann überraschender sein, als die Uebereinstimmung
der jene Lehren vortragenden Schriftsteller untereinander, bei der allergrößten
Verschiedenheit ihrer Zeitalter, Länder und Religionen, begleitet von
der felsenfesten Sicherheit und innigen Zuversicht, mit der sie den Bestand
ihrer innern Erfahrung vortragen. Sie bilden nicht etwan eine Sekte, die
ein theoretisch beliebtes und einmal ergriffenes Dogma festhält, verteidigt
und fortpflanzt; vielmehr wissen sie meistenteils nicht voneinander; ja,
die indischen, christlichen, mohammedanischen Mystiker, Quietisten und
Asketen sind sich in allem heterogen, nur nicht im innern Sinn und Geiste
ihrer Lehren. Ein höchst auffallendes Beispiel hievon liefert die Vergleichung
der Torrens der Guion mit der Lehre der Veden, namentlich mit der Stelle
im Oupnekhat, Bd. 1, S. 63, welche den Inhalt jener französischen Schrift
in größter Kürze, aber genau und sogar mit denselben Bildern enthält,
und dennoch der Frau von Guion, um 1680, unmöglich bekannt sein konnte.
In der „Deutschen Theologie“ (alleinige unverstümmelte Ausgabe, Stuttgart
1851) wird Kapitel 2 und 3 gesagt, daß sowohl der Fall des Teufels, als
der Adams, darin bestanden hätte, daß der eine, wie der andere, sich
das ich und mich, das mein und mir beigelegt hätte; und S. 89 heißt
es: „In der wahren Liebe bleibt weder ich, noch mich, mein, mir, du,
dein, und desgleichen.“ Diesem nun entsprechend heißt es im „Kural“,
aus dem Tamulischen von Graul, S. 8: „Die nach außen gehende Leidenschaft
des mein und die nach innen gehende des ich hören auf“ (vgl. Vers 346).
Und im Manual of Buddhism by Spence Hardy, S. 258, spricht Buddha: „Meine
Schüler verwerfen den Gedanken, dies bin ich, oder dies ist mein.“
Ueberhaupt, wenn man von den Formen, welche die äußeren Umstände herbeiführen,
absieht und den Sachen auf den Grund geht, wird man finden, daß Schakia
Muni und Meister Eckhard dasselbe lehren; nur daß jener seine Gedanken
geradezu aussprechen durfte, dieser hingegen genötigt ist, sie in das
Gewand des christlichen Mythos zu kleiden und diesem seine Ausdrücke
anzupassen. Es geht aber hiemit so weit, daß bei ihm der christliche
Mythos fast nur noch eine Bildersprache ist, beinahe wie den Neuplatonikern
der hellenische: er nimmt ihn durchweg allegorisch. In derselben Hinsicht
ist es beachtenswert, daß der Uebertritt des heiligen Franciscus aus
dem Wohlstande zum Bettlerleben ganz ähnlich ist dem noch größern Schritte
des Buddha Schakia Muni vom Prinzen zum Bettler, und daß dementsprechend
das Leben, wie auch die Stiftung des Franciscus eben nur eine Art Saniassitum
war. Ja, es verdient erwähnt zu werden, daß seine Verwandtschaft mit
dem indischen Geiste auch hervortritt in seiner großen Liebe zu den Tieren
und häufigen Umgang mit ihnen, wobei er sie durchgängig seine Schwestern
und Brüder nennt; wie denn auch sein schöner Cantico, durch das Lob
der Sonne, des Mondes, der Gestirne, des Windes, des Wassers, des Feuers,
der Erde, seinen angeborenen indischen Geist bekundet *). [...]
*) S. Bonaventurae vita S. Francisci, c. 8. — K. Hase, Franz von Assisi,
Kap. 10. — I cantici di S. Francesco, editi da Schlosser e Steinle.
Francoforto s. M. 1842.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In Wahrheit ist nicht das Judentum, mit seinem παντα ϰαλα
λιαν, sondern Brahmanismus und Buddhaismus sind, dem Geiste und der
ethischen Tendenz nach, dem Christentum verwandt. Der Geist und die ethische
Tendenz sind aber das Wesentliche einer Religion, nicht die Mythen, in
welche sie solche kleidet. Ich gebe daher den Glauben nicht auf, daß
die Lehren des Christentums irgendwie aus jenen Urreligionen abzuleiten
sind. Auf einige Spuren hievon habe ich schon im zweiten Theile der Parerga,
§. 180, hingewiesen. Ihnen ist hinzuzufügen, daß Epiphanias (Haeretic.
XVIII) berichtet, die ersten Jerusalemitischen Juden=Christen, welche
sich Nazaräer nannten, hätten sich aller tierischen Nahrung enthalten.
Vermöge dieses Ursprungs (oder wenigstens dieser Uebereinstimmung) gehört
das Christentum dem alten, wahren und erhabenen Glauben der Menschheit
an, welcher im Gegensatz steht zu dem falschen, platten und verderblichen
Optimismus, der sich im griechischen Heidentum, im Judentum und im Islam
darstellt. Die Zendreligion hält gewissermaßen das Mittel, indem sie,
dem Ormuzd gegenüber, am Ahriman ein pessimistisches Gegengewicht hat.
Aus dieser Zendreligion ist, wie J. G. Rhode, in seinem Buche „Die heilige
Sage des Zendvolks“, gründlich nachgewiesen hat, die Judenreligion
hervorgegangen: aus Ormuzd ist Jehova und aus Ahriman Satan geworden,
der jedoch im Judentum nur noch eine sehr untergeordnete Rolle spielt,
ja, fast ganz verschwindet, wodurch denn der Optimismus die Oberhand gewinnt
und nur noch der Mythos vom Sündenfall, der ebenfalls (als Fabel von
Meschian und Meschiane) aus dem Zend=Avesta stammt, als pessimistisches
Element übrig bleibt, jedoch in Vergessenheit gerät, bis er, wie auch
der Satan, vom Christentum wieder aufgenommen wird. Inzwischen stammt
Ormuzd selbst aus dem Brahmanismus, wiewohl aus einer niedrigen Region
desselben: er ist nämlich kein anderer, als Indra, jener untergeordnete,
oft mit Menschen rivalisierende Gott des Firmaments und der Atmosphäre;
wie dies sehr richtig nachgewiesen hat der vortreffliche J. J. Schmidt,
in seiner Schrift „Ueber die Verwandtschaft der gnostisch=theosophischen
Lehren mit den Religionen des Orients“. Dieser Indra=Ormuzd=Jehova mußte
nachmals in das Christentum, da es in Judäa entstand, übergehen, dessen
kosmopolitischem Charakter zufolge er jedoch seine Eigennamen ablegte,
um in der Landessprache jeder bekehrten Nation durch das Appellativum
der durch ihn verdrängten übermenschlichen Individuen bezeichnet zu
werden, als ϑεος, Deus, welches vom Sanskrit Deva kommt (wovon auch
devil, Teufel), oder bei den gotisch=germanischen Völkern durch das von
Odin oder Wodan, Guodan, Godan stammende Wort God, Gott. Ebenso nahm er,
in dem gleichfalls aus dem Judentum stammenden Islam, den in Arabien auch
schon früher vorhandenen Namen Allah an. Diesem analog haben auch die
Götter des griechischen Olymps, als sie, in vorhistorischer Zeit, nach
Italien verpflanzt wurden, die Namen der vorher herrschenden Götter angenommen;
daher Zeus bei den Römern Jupiter, Hera Juno, Hermes Merkur heißt u.
s. f. In China erwächst den Missionarien ihre erste Verlegenheit daraus,
daß die chinesische Sprache gar kein Appellativ derart, wie auch kein
Wort für Schaffen hat *); da die drei Religionen Chinas keine Götter
kennen, weder im Plural, noch im Singular. [...]
*) Vgl. „Ueber den Willen in der Natur“, Bd. 6, S. 356 f. dieser Ausgabe.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Inzwischen wird die Erkenntnis jener moralischen Verderbnis dadurch
erschwert, daß die Aeußerungen derselben gehemmt und verdeckt werden
durch die gesetzliche Ordnung, durch die Notwendigkeit der Ehre, ja, auch
noch durch die Höflichkeit. Endlich kommt noch hinzu, daß man bei der
Erziehung die Moralität der Zöglinge dadurch zu befördern vermeint,
daß man ihnen Rechtlichkeit und Tugend als die in der Welt allgemein
befolgten Maximen darstellt: wenn nun später die Erfahrung sie, und oft
zu ihrem großen Schaden, eines andern belehrt; so kann die Entdeckung,
daß ihre Jugendlehrer die ersten waren, welche sie betrogen, nachteiliger
auf ihre eigene Moralität wirken, als wenn diese Lehrer ihnen das erste
Beispiel der Offenherzigkeit und Redlichkeit selbst gegeben und unverhohlen
gesagt hätten: „Die Welt liegt im argen, die Menschen sind nicht, wie
sie sein sollten; aber laß es dich nicht irren und sei du besser.“
— Alles dieses, wie gesagt, erschwert unsere Erkenntnis der wirklichen
Immoralität des Menschengeschlechts. Der Staat, dieses Meisterstück
des sich selbst verstehenden, vernünftigen, aufsummierten Egoismus Aller,
hat den Schutz der Rechte eines jeden in die Hände einer Gewalt gegeben,
welche, der Macht jedes einzelnen unendlich überlegen, ihn zwingt, die
Rechte aller Andern zu achten. Da kann der grenzenlose Egoismus fast Aller,
die Bosheit vieler, die Grausamkeit mancher sich nicht hervorthun: der
Zwang hat Alle gebändigt. Die hieraus entspringende Täuschung ist so
groß, daß, wenn wir in einzelnen Fällen, wo die Staatsgewalt nicht
schützen kann, oder eludiert wird, die unersättliche Habsucht, die niederträchtige
Geldgier, die tief versteckte Falschheit, die tückische Bosheit der Menschen
hervortreten sehen, wir oft zurückschrecken und ein Zetergeschrei erheben,
vermeinend, ein noch nie gesehenes Monstrum sei uns aufgestoßen: allein
ohne den Zwang der Gesetze und die Notwendigkeit der bürgerlichen Ehre
würden dergleichen Vorgänge ganz an der Tagesordnung sein. Kriminalgeschichten
und Beschreibungen anarchischer Zustände muß man lesen, um zu erkennen,
was, in moralischer Hinsicht, der Mensch eigentlich ist. Diese Tausende,
die da, vor unsern Augen, im friedlichen Verkehr sich durcheinander drängen,
sind anzusehen als eben so viele Tiger und Wölfe, deren Gebiß durch
einen starken Maulkorb gesichert ist. Daher, wenn man sich die Staatsgewalt
einmal aufgehoben, d. h. jenen Maulkorb abgeworfen denkt, jeder Einsichtige
zurückbebt vor dem Schauspiele, das dann zu erwarten stände; wodurch
er zu erkennen gibt, wie wenig Wirkung er der Religion, dem Gewissen,
oder dem natürlichen Fundament der Moral, welches es auch immer sein
möge, im Grunde zutraut. Aber gerade alsdann würde, jenen freigelassenen
unmoralischen Potenzen gegenüber, auch die wahre moralische Triebfeder
im Menschen ihre Wirksamkeit unverdeckt zeigen, folglich am leichtesten
erkannt werden können; wobei zugleich die unglaublich große moralische
Verschiedenheit der Charaktere unverschleiert hervortreten und ebensogroß
befunden werden würde, wie die intellektuelle der Köpfe; womit gewiß
viel gesagt ist.
Man wird mir vielleicht entgegensetzen wollen, daß die Ethik es nicht
damit zu thun habe, wie die Menschen wirklich handeln, sondern die Wissenschaft
sei, welche angibt, wie sie handeln sollen. Dies ist aber gerade der Grundsatz,
den ich leugne, nachdem ich im kritischen Teile dieser Abhandlung genugsam
dargethan habe, daß der Begriff des Sollens, die imperative Form der
Ethik, allein in der theologischen Moral gilt, außerhalb derselben aber
allen Sinn und Bedeutung verliert. Ich setze hingegen der Ethik den Zweck,
die in moralischer Hinsicht höchst verschiedene Handlungsweise der Menschen
zu deuten, zu erklären und auf ihren letzten Grund zurückzuführen.
Daher bleibt zur Auffindung des Fundaments der Ethik kein anderer Weg,
als der empirische, nämlich zu untersuchen, ob es überhaupt Handlungen
gibt, denen wir echten moralischen Wert zuerkennen müssen, — welches
die Handlungen freiwilliger Gerechtigkeit, reiner Menschenliebe und wirklichen
Edelmuts sein werden. Diese sind sodann als ein gegebenes Phänomen zu
betrachten, welches wir richtig zu erklären, d. h. auf seine wahren Gründe
zurückzuführen, mithin die jedenfalls eigentümliche Triebfeder nachzuweisen
haben, welche den Menschen zu Handlungen dieser von jeder andern spezifisch
verschiedenen Art bewegt. Diese Triebfeder, nebst der Empfänglichkeit
für sie, wird der letzte Grund der Moralität und die Kenntnis derselben
das Fundament der Moral sein. Dies ist der bescheidene Weg, auf welchen
ich die Ethik hinweise. Wem er, als keine Konstruktion a priori, keine
absolute Gesetzgebung für alle vernünftige Wesen in abstracto enthaltend,
nicht vornehm, kathedralisch und akademisch genug dünkt, der mag zurückkehren
zu den kategorischen Imperativen, zum Schibboleth der „Würde des Menschen“;
zu den hohlen Redensarten, den Hirngespinsten und Seifenblasen der Schulen,
zu Prinzipien, denen die Erfahrung bei jedem Schritte Hohn spricht und
von welchen außerhalb der Hörsäle kein Mensch etwas weiß, noch jemals
empfunden hat. Dem auf meinem Wege sich ergebenden Fundament der Moral
hingegen steht die Erfahrung zur Seite und legt täglich und stündlich
ihr stilles Zeugnis für dasselbe ab. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Haupt= und Grundtriebfeder im Menschen, wie im Tiere, ist der Egoismus,
d. h. der Drang zum Dasein und Wohlsein. — Das deutsche Wort Selbstsucht
führt einen falschen Nebenbegriff von Krankheit mit sich. Das Wort Eigennutz
aber bezeichnet den Egoismus, sofern er unter Leitung der Vernunft steht,
welche ihn befähigt, vermöge der Reflexion, seine Zwecke planmäßig
zu verfolgen; daher man die Tiere wohl egoistisch, aber nicht eigennützig
nennen kann. Ich will also für den allgemeinern Begriff das Wort Egoismus
beibehalten. — Dieser Egoismus ist, im Tiere, wie im Menschen, mit dem
innersten Kern und Wesen desselben aufs genaueste verknüpft, ja, eigentlich
identisch. Daher entspringen, in der Regel, alle seine Handlungen aus
dem Egoismus, und aus diesem zunächst ist allemal die Erklärung einer
gegebenen Handlung zu versuchen; wie denn auch auf denselben die Berechnung
aller Mittel, dadurch man den Menschen nach irgend einem Ziele hinzulenken
sucht, durchgängig gegründet ist. Der Egoismus ist, seiner Natur nach,
grenzenlos: der Mensch will unbedingt sein Dasein erhalten, will es von
Schmerzen, zu denen auch aller Mangel und Entbehrung gehört, unbedingt
frei, will die größtmögliche Summe von Wohlsein, und will jeden Genuß,
zu dem er fähig ist, ja, sucht wo möglich noch neue Fähigkeiten zum
Genusse in sich zu entwickeln. Alles, was sich dem Streben seines Egoismus
entgegenstellt, erregt seinen Unwillen, Zorn, Haß: er wird es als seinen
Feind zu vernichten suchen. Er will wo möglich alles genießen, alles
haben; da aber dies unmöglich ist, wenigstens alles beherrschen: „Alles
für mich, und nichts für die Andern,“ ist sein Wahlspruch. Der Egoismus
ist kolossal: er überragt die Welt. Denn, wenn jedem einzelnen die Wahl
gegeben würde zwischen seiner eigenen und der übrigen Welt Vernichtung:
so brauche ich nicht zu sagen, wohin sie, bei den allermeisten, ausschlagen
würde. Demgemäß macht jeder sich zum Mittelpunkte der Welt, bezieht
alles auf sich und wird was nur vorgeht, z. B. die größten Veränderungen
im Schicksale der Völker, zunächst auch sein Interesse dabei beziehen
und, sei dieses auch noch so klein und mittelbar, vor allem daran denken.
Keinen größern Kontrast gibt es, als den zwischen dem hohen und exklusiven
Anteil, den jeder an seinem eigenen Selbst nimmt, und der Gleichgültigkeit,
mit der in der Regel alle andern eben jenes Selbst betrachten; wie er
ihres. Es hat sogar seine komische Seite, die zahllosen Individuen zu
sehen, deren jedes, wenigstens in praktischer Hinsicht, sich allein für
real hält und die Andern gewissermaßen als bloße Phantome betrachtet.
Dies beruht zuletzt darauf, daß jeder sich selber unmittelbar gegeben
ist, die andern aber ihm nur mittelbar, durch die Vorstellung von ihnen
in seinem Kopfe: und die Unmittelbarkeit behauptet ihr Recht. Nämlich
infolge der jedem Bewußtsein wesentlichen Subjektivität, ist jeder sich
selber die ganze Welt: denn alles Objektive existiert nur mittelbar, als
bloße Vorstellung des Subjekts; so daß stets alles am Selbstbewußtsein
hängt. Die einzige Welt, welche jeder wirklich kennt und von der er weiß,
trägt er in sich, als seine Vorstellung, und ist daher das Centrum derselben.
Deshalb eben ist jeder sich alles in allem: er findet sich als den Inhaber
aller Realität und kann ihm nichts wichtiger sein, als er selbst. Während
nun in seiner subjektiven Ansicht sein Selbst sich in dieser kolossalen
Größe darstellt, schrumpft es in der objektiven beinahe zu nichts ein,
nämlich zu ungefähr 1/1000000000 der jetzt lebenden Menschheit. Dabei
nun weiß er völlig gewiß, daß eben jenes über alles wichtige Selbst,
dieser Mikrokosmos, als dessen bloße Modifikation, oder Accidenz, der
Makrokosmos auftritt, also seine ganze Welt, untergehen muß im Tode,
der daher für ihn gleichbedeutend ist mit dem Weltuntergange. Dieses
also sind die Elemente, woraus, auf der Basis des Willens zum Leben, der
Egoismus erwächst, welcher zwischen Mensch und Mensch stets wie ein breiter
Graben liegt. Springt wirklich einmal einer darüber, dem Andern zu Hilfe,
so ist es wie ein Wunder, welches Staunen erregt und Beifall einerntet.
Oben, § 8, bei Erläuterung des Kantischen Moralprinzips, habe ich Gelegenheit
gehabt, auszuführen, wie der Egoismus sich im Alltagsleben zeigt, wo
er, trotz der Höflichkeit, die man ihm als Feigenblatt vorsteckt, doch
stets aus irgend einer Ecke hervorguckt. Die Höflichkeit nämlich ist
die konventionelle und systematische Verleugnung des Egoismus in den Kleinigkeiten
des täglichen Verkehrs und ist freilich anerkannte Heuchelei: dennoch
wird sie gefordert und gelobt; weil was sie verbirgt, der Egoismus, so
garstig ist, daß man es nicht sehen will, obschon man weiß, daß es
da ist: wie man widerliche Gegenstände wenigstens durch einen Vorhang
bedeckt wissen will. — Da der Egoismus, wo ihm nicht entweder äußere
Gewalt, welcher auch jede Furcht, sei sie vor irdischen oder überirdischen
Mächten, beizuzählen ist, oder aber die echte moralische Triebfeder
entgegenwirkt, seine Zwecke unbedingt verfolgt; so würde, bei der zahllosen
Menge egoistischer Individuen, das Bellum omnium contra omnes an der Tagesordnung
sein, zum Unheil Aller. Daher die reflektierende Vernunft sehr bald die
Staatseinrichtung erfindet, welche, aus gegenseitiger Furcht vor gegenseitiger
Gewalt entspringend, den nachteiligen Folgen des allgemeinen Egoismus
so weit vorbeugt, als es auf dem negativen Wege geschehen kann. Wo hingegen
jene zwei ihm entgegenstehenden Potenzen nicht zur Wirksamkeit gelangen,
wird er sich sofort in seiner ganzen furchtbaren Größe zeigen, und das
Phänomen wird kein schönes sein. Indem ich, um ohne Weitläufigkeit
die Stärke dieser antimoralischen Potenz auszudrücken, darauf bedacht
war, die Größe des Egoismus mit einem Zuge zu bezeichnen und deshalb
nach irgend einer recht emphatischen Hyperbel suchte, bin ich zuletzt
auf diese geraten: mancher Mensch wäre im stande, einen andern totzuschlagen,
bloß um mit dessen Fette sich die Stiefel zu schmieren. Aber dabei blieb
mir doch der Skrupel, ob es auch wirklich eine Hyperbel sei. — Der Egoismus
also ist die erste und hauptsächlichste, wiewohl nicht die einzige Macht,
welche die moralische Triebfeder zu bekämpfen hat. Man sieht schon hier,
daß diese, um wider einen solchen Gegner aufzutreten, etwas Realeres
sein muß, als eine spitzfindige Klügelei, oder eine aprioristische Seifenblase.
— Inzwischen ist im Kriege das erste, daß man den Feind rekognosziert.
In dem bevorstehenden Kampfe wird der Egoismus, als die Hauptmacht seiner
Seite, vorzüglich sich der Tugend der Gerechtigkeit entgegenstellen,
welche, nach meiner Ansicht, die erste und recht eigentliche Kardinaltugend
ist. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Hingegen wird der Tugend der Menschenliebe öfter das Uebelwollen
oder die Gehässigkeit gegenübertreten. Daher wollen wir den Ursprung
und die Gradationen dieser zunächst betrachten. Das Uebelwollen in den
niederen Graden ist sehr häufig, ja, fast gewöhnlich, und es erreicht
leicht die höheren. Goethe hat wohl recht zu sagen, daß in dieser Welt
Gleichgültigkeit und Abneigung recht eigentlich zu Hause sind. (Wahlverwandtschaften,
Teil 1, K. 3.) Es ist sehr glücklich für uns, daß Klugheit und Höflichkeit
ihren Mantel darüber decken und uns nicht sehen lassen, wie allgemein
das gegenseitige Uebelwollen ist und wie das Bellum omnium contra omnes
wenigstens in Gedanken fortgesetzt wird. Aber gelegentlich kommt es doch
zum Vorschein, z. B. bei der so häufigen und so schonungslosen übeln
Nachrede: ganz sichtbar aber wird es bei den Ausbrüchen des Zorns, welche
meistens ihren Anlaß um ein Vielfaches übersteigen und so stark nicht
ausfallen könnten, wenn sie nicht, wie das Schießpulver in der Flinte,
komprimiert gewesen wären, als lange gehegter im Innern brütender Haß.
— Großenteils entsteht das Uebelwollen aus den unvermeidlichen und
bei jedem Schritt eintretenden Kollisionen des Egoismus. Sodann wird es
auch objektiv erregt, durch den Anblick der Laster, Fehler, Schwächen,
Thorheiten, Mängel und Unvollkommenheiten aller Art, welchen, mehr oder
weniger, jeder den andern, wenigstens gelegentlich, darbietet. Es kann
hiemit so weit kommen, daß vielleicht manchem, zumal in Augenblicken
hypochondrischer Verstimmung, die Welt, von der ästhetischen Seite betrachtet
als ein Karikaturenkabinett, von der intellektuellen als ein Narrenhaus,
und von der moralischen als eine Gaunerherberge erscheint. Wird solche
Verstimmung bleibend; so entsteht Misanthropie. — Endlich ist eine Hauptquelle
des Uebelwollens der Neid; oder vielmehr dieser selbst ist schon Uebelwollen,
erregt durch fremdes Glück, Besitz oder Vorzüge. Kein Mensch ist ganz
frei davon, und schon Herodot (lll, 80) hat es gesagt: Φϑονος άρχηϑεν
έμφυεται άνϑρωπῳ (invidia ab origine homini insita est).
Jedoch sind die Grade desselben sehr verschieden. Am unversöhnlichsten
und giftigsten ist er, wann auf persönliche Eigenschaften gerichtet,
weil hier dem Neider keine Hoffnung bleibt, und zugleich am niederträchtigsten;
weil er haßt, was er lieben und verehren sollte; allein es ist so:
Di lor par più, che d`altri, invidia s`abbia,
Che per se stessi son levati a volo,
Uscendo fuor della commune gabbia *).
klagt schon Petrarca. Ausführlichere Betrachtungen über den Neid findet
man im zweiten Bande der Parerga, § 114. — In gewissem Betracht ist
das Gegenteil des Neides die Schadenfreude. Jedoch ist Neid zu fühlen,
menschlich; Schadenfreude zu genießen, teuflisch. Es gibt kein unfehlbareres
Zeichen eines ganz schlechten Herzens und tiefer moralischer Nichtswürdigkeit
als einen Zug reiner, herzlicher Schadenfreude. Man soll den, an welchem
man ihn wahrgenommen, auf immer meiden: Hic niger est, hunc tu, Romane,
caveto. — Neid und Schadenfreude sind an sich bloß theoretisch: praktisch
werden sie Bosheit und Grausamkeit. Der Egoismus kann zu Verbrechen und
Unthaten aller Art führen: aber der dadurch verursachte Schaden und Schmerz
anderer ist ihm bloß Mittel, nicht Zweck, tritt also nur accidentell
dabei ein. Der Bosheit und Grausamkeit hingegen sind die Leiden und Schmerzen
anderer Zweck an sich und dessen Erreichen Genuß. Dieserhalb machen jene
eine höhere Potenz moralischer Schlechtigkeit aus. Die Maxime des äußersten
Egoismus ist: Neminem juva, imo omnes, si forte conducit (also immer noch
bedingt), laede. Die Maxime der Bosheit ist: Omnes, quantum potes, laede.
— Wie Schadenfreude nur theoretische Grausamkeit ist, so Grausamkeit
nur praktische Schadenfreude, und diese wird als jene auftreten, sobald
die Gelegenheit kommt. [...]
*) Man scheinet, mehr als andre, die zu neiden,
Die, durch der eignen Flügel Kraft gehoben,
Aus dem gemeinen Käfig aller scheiden.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ist mein Gemüt bis zu jenem Grade für das Mitleid empfänglich;
so wird dasselbe mich zurückhalten, wo und wann ich, um meine Zwecke
zu erreichen, fremdes Leiden als Mittel gebrauchen möchte; gleichviel
ob dieses Leiden ein augenblicklich oder später eintretendes, ein direktes,
oder indirektes, durch Zwischenglieder vermitteltes sei. Folglich werde
ich dann so wenig das Eigentum, als die Person des Andern angreifen, ihm
so wenig geistige, als körperliche Leiden verursachen, also nicht nur
mich jeder physischen Verletzung enthalten; sondern auch ebensowenig auf
geistigem Wege ihm Schmerz bereiten, durch Kränkung, Aengstigung, Aerger,
oder Verleumdung. Dasselbe Mitleid wird mich abhalten, die Befriedigung
meiner Lüste auf Kosten des Lebensglückes weiblicher Individuen zu suchen,
oder das Weib eines andern zu verführen, oder auch Jünglinge moralisch
und physisch zu verderben, durch Verleitung zur Päderastie. Jedoch ist
keineswegs erforderlich, daß in jedem einzelnen Fall das Mitleid wirklich
erregt werde; wo es auch oft zu spät käme: sondern aus der ein für
allemal erlangten Kenntnis von dem Leiden, welches jede ungerechte Handlung
notwendig über Andere bringt, und welches durch das Gefühl des Unrechterduldens,
d. h. der fremden Uebermacht, geschärft wird, geht in edlen Gemütern
die Maxime neminem laede hervor, und die vernünftige Ueberlegung erhebt
sie zu dem ein für allemal gefaßten festen Vorsatz, die Rechte eines
jeden zu achten, sich keinen Eingriff in dieselben zu erlauben, sich von
dem Selbstvorwurf, die Ursache fremder Leiden zu sein, frei zu erhalten
und demnach nicht die Lasten und Leiden des Lebens, welche die Umstände
jedem zuführen, durch Gewalt oder List auf Andere zu wälzen, sondern
sein beschiedenes Teil selbst zu tragen, um nicht das eines Andern zu
verdoppeln. Denn obwohl Grundsätze und abstrakte Erkenntnis überhaupt
keineswegs die Urquelle, oder erste Grundlage der Moralität sind; so
sind sie doch zu einem moralischen Lebenswandel unentbehrlich, als das
Behältnis, das Reservoir, in welchem die aus der Quelle aller Moralität,
als welche nicht in jedem Augenblicke fließt, entsprungene Gesinnung
aufbewahrt wird, um, wenn der Fall der Anwendung kommt, durch Ableitungskanäle
dahin zu fließen. Es verhält sich also im Moralischen wie im Physiologischen,
wo z. B. die Gallenblase, als Reservoir des Produkts der Leber, notwendig
ist, und in vielen ähnlichen Fällen. Ohne festgefaßte Grundsätze würden
wir den antimoralischen Triebfedern, wenn sie durch äußere Eindrücke
zu Affekten erregt sind, unwiderstehlich preisgegeben sein. Das Festhalten
und Befolgen der Grundsätze, den ihnen entgegenwirkenden Motiven zum
Trotz, ist Selbstbeherrschung. Hier liegt auch die Ursache, warum die
Weiber, als welche, wegen der Schwäche ihrer Vernunft, allgemeine Grundsätze
zu verstehen, festzuhalten und zur Richtschnur zu nehmen, weit weniger
als die Männer fähig sind, in der Tugend der Gerechtigkeit, also auch
Redlichkeit und Gewissenhaftigkeit, diesen in der Regel nachstehen; daher
Ungerechtigkeit und Falschheit ihre häufigsten Laster sind und Lügen
ihr eigentliches Element: hingegen übertreffen sie die Männer in der
Tugend der Menschenliebe: denn zu dieser ist der Anlaß meistens anschaulich
und redet daher unmittelbar zum Mitleid, für welches die Weiber entschieden
leichter empfänglich sind. Aber nur das Anschauliche, Gegenwärtige,
unmittelbar Reale hat wahre Existenz für sie: das nur mittelst der Begriffe
erkennbare Entfernte, Abwesende, Vergangene, Zukünftige ist ihnen nicht
wohl faßlich. Also ist auch hier Kompensation: Gerechtigkeit ist mehr
die männliche, Menschenliebe mehr die weibliche Tugend. Der Gedanke,
Weiber das Richteramt verwalten zu sehen, erregt Lachen; aber die barmherzigen
Schwestern übertreffen sogar die barmherzigen Brüder. Nun aber gar das
Tier ist, da ihm die abstrakte oder Vernunfterkenntnis gänzlich fehlt,
durchaus keiner Vorsätze, geschweige Grundsätze und mithin keiner Selbstbeherrschung
fähig, sondern dem Eindruck und Affekt wehrlos hingegeben. Daher eben
hat es keine bewußte Moralität; wiewohl die Spezies große Unterschiede
der Bosheit und Güte des Charakters zeigen, und in den obersten Geschlechtern
selbst die Individuen. — Dem Gesagten zufolge wirkt, in den einzelnen
Handlungen des Gerechten, das Mitleid nur noch indirekt, mittelst der
Grundsätze, und nicht sowohl actu als potentiâ; etwan so, wie in der
Statik die durch größere Länge des einen Wagebalkens bewirkte größere
Geschwindigkeit, vermöge welcher die kleinere Masse der größeren das
Gleichgewicht hält, im Zustand der Ruhe nur potentiâ und doch völlig
so gut wie actu wirkt. Jedoch bleibt dabei das Mitleid stets bereit, auch
actu hervorzutreten; daher, wenn etwan, in einzelnen Fällen, die erwählte
Maxime der Gerechtigkeit wankt, zur Unterstützung derselben und zur Belebung
der gerechten Vorsätze, kein Motiv (die egoistischen beiseite gesetzt)
wirksamer ist, als das aus der Urquelle selbst, dem Mitleid, geschöpfte.
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Diese Betrachtungen werden es hoffentlich deutlich machen, daß,
so wenig es auf den ersten Blick scheinen mag, allerdings auch die Gerechtigkeit,
als echte, freie Tugend, ihren Ursprung im Mitleid hat. Wem dennoch dieser
Boden zu dürftig scheinen möchte, als daß jene große, recht eigentliche
Kardinaltugend bloß in ihm wurzeln könnte, der erinnere sich aus dem
Obigen, wie gering das Maß der echten, freiwilligen, uneigennützigen
und ungeschminkten Gerechtigkeit ist, die sich unter Menschen findet;
wie diese immer nur als überraschende Ausnahme vorkommt und zu ihrer
Afterart, der auf bloßer Klugheit beruhenden und überall laut angekündigten
Gerechtigkeit, sich, der Qualität und Quantität nach, verhält wie Gold
zu Kupfer. Ich möchte diese letztere δικαιοσυνη πανδημος,
die andere ούρανια nennen; da ja sie es ist, welche, nach Hesiodus,
im eisernen Zeitalter die Erde verläßt, um bei den himmlischen Göttern
zu wohnen. Für diese seltene und auf Erden stets nur exotische Pflanze
ist die nachgewiesene Wurzel stark genug.
Die Ungerechtigkeit, oder das Unrecht, besteht demnach allemal in der
Verletzung eines andern. Daher ist der Begriff des Unrechts ein positiver
und dem des Rechts vorhergängig, als welcher der negative ist und bloß
die Handlungen bezeichnet, welche man ausüben kann, ohne andere zu verletzen,
d. h. ohne Unrecht zu thun. Daß zu diesen auch alle Handlungen gehören,
welche allein den Zweck haben, versuchtes Unrecht abzuwehren, ist leicht
abzusehen. Denn keine Teilnahme am Andern, kein Mitleid mit ihm kann mich
auffordern, mich von ihm verletzen zu lassen, d. h. Unrecht zu leiden.
Daß der Begriff des Rechts der negative sei, im Gegensatz des Unrechts,
als des positiven, gibt sich auch zu erkennen in der ersten Erklärung,
welche der Vater der philosophischen Rechtslehre, Hugo Grotius, am Eingange
seines Werkes, von jenem Begriffe aufstellt: Jus hic nihil aliud, quam
quod justum est significat, idque negante magis sensu, quam ajente, ut
jus sit, quod injustum non est (De jure belli et pacis, L. I, c. 1, §
3). Die Negativität der Gerechtigkeit bewährt sich, dem Anschein entgegen,
selbst in der trivialen Definition: „Jedem das Seinige geben“. Ist
es das Seinige, braucht man es ihm nicht zu geben: bedeutet also: „Keinem
das Seinige nehmen“. — Weil die Forderung der Gerechtigkeit bloß
negativ ist, läßt sie sich erzwingen: denn das Neminem laede kann von
allen zugleich geübt werden. Die Zwangsanstalt hiezu ist der Staat, dessen
alleiniger Zweck ist, die einzelnen voreinander und das Ganze vor äußeren
Feinden zu schützen. Einige deutsche Philosophaster dieses feilen Zeitalters
möchten ihn verdrehen zu einer Moralitäts- Erziehungs- und Erbauungsanstalt:
wobei im Hintergrunde der jesuitische Zweck lauert, die persönliche Freiheit
und individuelle Entwickelung des Einzelnen aufzuheben, um ihn zum bloßen
Rade einer chinesischen Staats- und Religionsmaschine zu machen. Dies
aber ist der Weg, auf welchem man weiland zu Inquisitionen, Autodafès
und Religionskriegen gelangt ist: Friedrichs des Großen Wort: „In meinem
Lande soll jeder seine Seligkeit nach seiner eigenen Facon besorgen können“,
besagte, daß er ihn nie betreten wolle. Hingegen sehen wir auch jetzt
noch überall (mit mehr scheinbarer, als wirklicher Ausnahme Nordamerikas)
den Staat auch die Sorge für das metaphysische Bedürfnis seiner Mitglieder
übernehmen. Die Regierungen scheinen zu ihrem Prinzip den Satz des Quintus
Curtius gewählt zu haben: Nulla res efficacius multitudinem regit, quam
superstitio: alioquin impotens, saeva, mutabilis; ubi vana religione capta
est, melius vatibus, quam ducibus suis paret.
Die Begriffe Unrecht und Recht, als gleichbedeutend mit Verletzung und
Nichtverletzung, zu welcher letztern auch das Abwehren der Verletzung
gehört, sind offenbar unabhängig von aller positiven Gesetzgebung und
dieser vorhergehend: also gibt es ein rein ethisches Recht, oder Naturrecht,
und eine reine, d. h. von aller positiven Satzung unabhängige Rechtslehre.
Die Grundsätze derselben haben zwar insofern einen empirischen Ursprung,
als sie auf Anlaß des Begriffs der Verletzung entstehen, an sich selbst
aber beruhen sie auf dem reinen Verstande, welcher a priori das Prinzip
an die Hand gibt: causa causae est causa effectus; welches hier besagt,
daß von dem, was ich thun muß, um die Verletzung eines Andern von mir
abzuwehren, er selbst die Ursache ist, und nicht ich; also ich mich allen
Beeinträchtigungen von seiner Seite widersetzen kann, ohne ihm Unrecht
zu thun. Es ist gleichsam ein moralisches Reperkussionsgesetz. Also aus
der Verbindung des empirischen Begriffes der Verletzung mit jener Regel,
die der reine Verstand an die Hand gibt, entstehen die Grundbegriffe von
Unrecht und Recht, die jeder a priori faßt und auf Anlaß der Erfahrung
sogleich anwendet. Den dieses leugnenden Empiriker darf man, da bei ihm
allein Erfahrung gilt, nur auf die Wilden hinweisen, die alle ganz richtig,
oft auch fein und genau, Unrecht und Recht unterscheiden; welches sehr
in die Augen fällt bei ihrem Tauschhandel und andern Uebereinkünften
mit der Mannschaft europäischer Schiffe, und bei ihren Besuchen auf diesen.
Sie sind dreist und zuversichtlich, wo sie recht haben, hingegen ängstlich,
wenn das Recht nicht auf ihrer Seite ist. Bei Streitigkeiten lassen sie
sich eine rechtliche Ausgleichung gefallen, hingegen reizt ungerechtes
Verfahren sie zum Kriege. — Die Rechtslehre ist ein Teil der Moral,
welcher die Handlungen feststellt, die man nicht ausüben darf, wenn man
nicht Andere verletzen, d. h. Unrecht begehen will. Die Moral hat also
hiebei den aktiven Teil im Auge. Die Gesetzgebung aber nimmt dieses Kapitel
der Moral, um es in Rücksicht auf die passive Seite, also umgekehrt,
zu gebrauchen und dieselben Handlungen zu betrachten als solche, die keiner,
da ihm kein Unrecht widerfahren soll, zu leiden braucht. Gegen diese Handlungen
errichtet nun der Staat das Bollwerk der Gesetze, als positives Recht.
Seine Absicht ist, daß keiner Unrecht leide: die Absicht der moralischen
Rechtslehre hingegen, daß keiner Unrecht thue *). [...]
*) Die ausgeführte Rechtslehre findet man in der „Welt als Wille und
Vorstellung“, viertes Buch, § 62, 3. Bd., S. 195 ff.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Das Gesetz der Motivation ist ebenso streng, wie das der physischen
Kausalität, führt also einen ebenso unwiderstehlichen Zwang mit sich.
Dem entsprechend gibt es zur Ausübung des Unrechts zwei Wege, den der
Gewalt und den der List. Wie ich durch Gewalt einen Andern töten, oder
berauben, oder mir zu gehorchen zwingen kann; so kann ich alles dieses
auch durch List ausführen, indem ich seinem Intellekt falsche Motive
vorschiebe, infolge welcher er thun muß, was er außerdem nicht thun
würde. Dies geschieht mittelst der Lüge; deren Unrechtmäßigkeit allein
hierauf beruht, ihr also nur anhängt, sofern sie ein Werkzeug der List,
d. h. des Zwanges mittelst der Motivation, ist. Dies aber ist sie in der
Regel. Denn zunächst kann mein Lügen selbst nicht ohne Motiv geschehen:
dies Motiv aber wird, mit den seltensten Ausnahmen, ein ungerechtes, nämlich
die Absicht sein, Andere, über die ich keine Gewalt habe, nach meinem
Willen zu leiten, d. h. sie mittelst der Motivation zu zwingen. Diese
Absicht liegt sogar auch der bloß windbeutelnden Lüge zum Grunde, indem
wer sie braucht sich dadurch bei Andern in höheres Ansehen, als ihm zusteht,
zu setzen sucht. — Die Verbindlichkeit des Versprechens und des Vertrages
beruht darauf, daß sie, wenn nicht erfüllt, die feierlichste Lüge sind,
deren Absicht, moralischen Zwang über Andere auszuüben, hier um so evidenter
ist, als das Motiv der Lüge, die verlangte Leistung des Gegenparts, ausdrück-
lich ausgesprochen ist. Das Verächtliche des Betrugs kommt daher, daß
er durch Gleisnerei seinen Mann entwaffnet, ehe er ihn angreift. Der Verrat
ist sein Gipfel und wird, weil er in die Kategorie der doppelten Ungerechtigkeit
gehört, tief verabscheut. Aber wie ich, ohne Unrecht, also mit Recht,
Gewalt durch Gewalt vertreiben kann; so kann ich, wo mir die Gewalt abgeht,
oder es mir bequemer scheint, es auch durch List. Ich habe also in den
Fällen, wo ich ein Recht zur Gewalt habe, es auch zur Lüge: so z. B.
gegen Räuber und unberechtigte Gewältiger jeder Art, die ich demnach
durch List in eine Falle locke. Darum bindet ein gewaltsam abgezwungenes
Versprechen nicht. — Aber das Recht zur Lüge geht in der That noch
weiter: es tritt ein bei jeder völlig unbefugten Frage, welche meine
persönlichen, oder meine Geschäftsangelegenheiten betrifft, mithin vorwitzig
ist, und deren Beantwortung nicht nur, sondern schon deren bloße Zurückweisung
durch „ich will's nicht sagen“, als Verdacht erweckend, mich in Gefahr
bringen würde. Hier ist die Lüge die Notwehr gegen unbefugte Neugier,
deren Motiv meistens kein wohlwollendes ist. Denn, wie ich das Recht habe,
dem vorausgesetzten bösen Willen Anderer und der demnach präsumierten
physischen Gewalt physischen Widerstand, auf Gefahr des Beeinträchtigers,
zum voraus entgegenzustellen und also, als Präventivmaßregel, meine
Gartenmauer mit scharfen Spitzen zu verwahren, nachts auf meinem Hofe
böse Hunde loszulassen, ja, nach Umständen, selbst Fußangeln und Selbstschüsse
zu stellen, deren schlimme Folgen der Eindringer sich selber zuzuschreiben
hat; so habe ich auch das Recht, dasjenige auf alle Weise geheim zu halten,
dessen Kenntnis mich dem Angriff Anderer bloßstellen würde, und habe
auch Ursache dazu, weil ich auch hier den bösen Willen Anderer als sehr
leicht möglich annehmen und die Vorkehrungen dagegen zum voraus treffen
muß. Daher sagt Ariosto:
Quantunque il simular sia le più volte
Ripreso, e dia di mala mente indici,
Si trova pure in molte cose e molte
Avere fatti evidenti benefici,
E danni e biasmi e morti avere tolte:
Che non conversiam' sempre con gli amici,
In questa assai più oscura che serena
Vita mortal, tutta d`invidia piena *).
(Orl. fur. IV, 1.)
Ich darf also, ohne Unrecht, selbst der bloß präsumierten Beeinträchtigung
durch List, zum voraus List entgegenstellen, und brauche daher nicht dem,
der unbefugt in meine Privatverhältnisse späht, Rede zu stehen, noch
durch Antwort: „Dies will ich geheim halten,“ die Stelle anzuzeigen,
wo ein mir gefährliches, ihm vielleicht vorteilhaftes, jedenfalls ihm
Macht über mich verleihendes Geheimnis liegt:
Scire volunt secreta domus, atque inde timeri.
Sondern ich bin alsdann befugt, ihn mit einer Lüge abzufertigen, auf
seine Gefahr, falls sie ihn in schädlichen Irrtum versetzt. Denn hier
ist die Lüge das einzige Mittel, der vorwitzigen und verdächtigen Neugier
zu begegnen: ich stehe daher im Falle der Notwehr. Ask me no questions,
and I`ll tell you no lies **), ist hier die richtige Maxime. Nämlich
bei den Engländern, denen der Vorwurf der Lüge als die schwerste Beleidigung
gilt, und die eben daher wirklich weniger lügen, als die andern Nationen,
werden dementsprechend alle unbefugten, die Verhältnisse des Andern betreffenden
Fragen als eine Ungezogenheit angesehen, welche der Ausdruck to ask questions
bezeichnet. — Auch verfährt nach dem oben aufgestellten Prinzip jeder
Verständige, selbst wenn er von der strengsten Rechtlichkeit ist. Kehrt
er z. B. von einem entlegenen Orte zurück, wo er Geld erhoben hat, und
ein unbekannter Reisender gesellt sich zu ihm, frägt, wie gewöhnlich,
erst wohin, und dann woher, darauf allmählich auch, was ihn an jenen
Ort geführt haben mag; — so wird jener eine Lüge antworten, um der
Gefahr des Raubes vorzubeugen. Wer in dem Hause, in welchem ein Mann,
um dessen Tochter er wirbt, wohnt, angetroffen, und nach der Ursache seiner
unvermuteten Anwesenheit gefragt wird, gibt, wenn er nicht auf den Kopf
gefallen ist, unbedenklich ein falsche an. Und so kommen gar viele Fälle
vor, in denen jeder Vernünftige, ohne alle Gewissensskrupel, lügt. Diese
Ansicht allein beseitigt den schreienden Widerspruch zwischen der Moral,
die gelehrt, und der, die täglich, ja selbst von den Redlichsten und
Besten, ausgeübt wird. Jedoch muß dabei die angegebene Einschränkung
auf den Fall der Notwehr streng festgehalten werden; da außerdem diese
Lehre abscheulichem Mißbrauche offen stände: denn an sich ist die Lüge
ein sehr gefährliches Werkzeug. Aber wie, trotz dem Landfrieden, das
Gesetz jedem erlaubt, Waffen zu tragen und zu gebrauchen, nämlich im
Fall der Notwehr; so gestatten für denselben Fall, aber ebenso auch nur
für diesen, die Moral den Gebrauch der Lüge. Diesen Fall der Notwehr
gegen Gewalt oder List ausgenommen, ist jede Lüge ein Unrecht; daher
die Gerechtigkeit Wahrhaftigkeit gegen jedermann fordert. Aber gegen die
völlig unbedingte, ausnahmslose und im Wesen der Sache liegende Verwerflichkeit
der Lüge spricht schon dies, daß es Fälle gibt, wo lügen sogar Pflicht
ist, namentlich für Aerzte; ebenfalls, daß es edelmütige Lügen gibt,
z. B. die des Marquis Posa im Don Carlos, die in der Gerusalemme liberata,
II, 22, und überhaupt in allen den Fällen, wo einer die Schuld des Andern
auf sich laden will; endlich daß sogar Jesus Christus einmal absichtlich
die Unwahrheit gesagt hat (Joh. 7, 8). [...]
*) So sehr auch meistens die Verstellung getadelt wird und von schlechter
Absicht zeugt; so hat sie dennoch in gar vielen Dingen augenfällig Gutes
gestiftet, indem sie dem Schaden, der Schande und dem Tode vorbeugte:
denn nicht immer reden wir mit Freunden, in diesem viel mehr finstern,
als heitern, sterblichen Leben, welches von Neide strotzt.
**) Frag du mich nicht aus, will ich dich nicht belügen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Nichts empört so im tiefsten Grunde unser moralisches Gefühl,
wie Grausamkeit. Jedes andere Verbrechen können wir verzeihen, nur Grausamkeit
nicht. Der Grund hievon ist, daß Grausamkeit das gerade Gegenteil des
Mitleids ist. Wenn wir von einer sehr grausamen That Kunde erhalten, wie
z. B. die ist, welche eben jetzt die Zeitungen berichten, von einer Mutter,
die ihren fünfjährigen Knaben dadurch gemordet hat, daß sie ihm siedendes
Oel in den Schlund goß, und ihr jüngeres Kind dadurch, daß sie es lebendig
begrub: — oder die, welche eben aus Algier gemeldet wird, daß nach
einem zufälligen Streit und Kampf zwischen einem Spanier und einem Algerier,
dieser, als der stärkere, jenem die ganze untere Kinnlade rein ausriß
und als Trophäe davontrug, jenen lebend zurücklassend; — dann werden
wir von Entsetzen ergriffen und rufen aus: „Wie ist es möglich, so
etwas zu thun?“ — Was ist der Sinn dieser Frage? Ist er vielleicht:
Wie ist es möglich, die Strafen des künftigen Lebens so wenig zu fürchten?
— Schwerlich. — Oder: Wie ist es möglich, nach einer Maxime zu handeln,
die so gar nicht geeignet ist, ein allgemeines Gesetz für alle vernünftigen
Wesen zu werden? — Gewiß nicht. — Oder: Wie ist es möglich, seine
eigene und die fremde Vollkommenheit so sehr zu vernachlässigen? —
Ebensowenig. — Der Sinn jener Frage ist ganz gewiß bloß dieser: Wie
ist es möglich, so ganz ohne Mitleid zu sein? — Also ist es der größte
Mangel an Mitleid, der einer That den Stempel der tiefsten moralischen
Verworfenheit und Abscheulichkeit aufdrückt. Folglich ist Mitleid die
eigentliche moralische Triebfeder. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ueberhaupt ist die von mir aufgestellte Grundlage der Moral und
Triebfeder der Moralität die einzige, der sich eine reale, ja ausgedehnte
Wirksamkeit nachrühmen läßt. Denn von den übrigen Moralprinzipien
der Philosophen wird dies wohl niemand behaupten wollen; da diese aus
abstrakten, zum Teil selbst spitzfindigen Sätzen bestehen, ohne anderes
Fundament, als eine künstliche Begriffskombination, so daß ihre Anwendung
auf das wirkliche Handeln sogar oft eine lächerliche Seite haben würde.
Eine gute That, bloß aus Rücksicht auf das Kantische Moralprinzip vollbracht,
würde im Grunde das Werk eines philosophischen Pedantismus sein, oder
aber auf Selbsttäuschung hinauslaufen, indem die Vernunft des Handelnden
eine That, welche andere, vielleicht edlere Triebfedern hätte, als das
Produkt des kategorischen Imperativs und des auf nichts gestützten Begriffs
der Pflicht auslegte. Aber nicht nur von den philosophischen, auf bloße
Theorie berechneten, sondern sogar auch von den ganz zum praktischen Behuf
aufgestellten religiösen Moralprinzipien läßt sich selten eine entschiedene
Wirksamkeit nachweisen. Dies sehen wir zuvörderst daran, daß, trotz
der großen Religionsverschiedenheit auf Erden, der Grad der Moralität,
oder vielmehr Immoralität, durchaus keine jener entsprechende Verschiedenheit
aufweist, sondern, im wesentlichen so ziemlich überall derselbe ist.
Nur muß man nicht Roheit und Verfeinerung mit Moralität und Immoralität
verwechseln. Die Religion der Griechen hatte eine äußerst geringe, fast
nur auf den Eid beschränkte moralische Tendenz; es wurde kein Dogma gelehrt
und keine Moral öffentlich gepredigt: wir sehen aber nicht, daß deshalb
die Griechen, alles zusammengenommen, moralisch schlechter gewesen wären,
als die Menschen der christlichen Jahrhunderte. Die Moral des Christentums
ist viel höherer Art, als die der übrigen Religionen, die jemals in
Europa aufgetreten sind: aber wer deshalb glauben wollte, daß die europäische
Moralität sich in eben dem Maße verbessert hätte und jetzt wenigstens
unter den gleichzeitigen excellierte, den würde man nicht nur bald überführen
können, daß unter Mohammedanern, Gebern, Hindu und Buddhaisten mindestens
ebenso viel Redlichkeit, Treue, Toleranz, Sanftmut, Wohlthätigkeit, Edelmut
und Selbstverleugnung gefunden wird, als unter den christlichen Völkern;
sondern sogar würde das lange Verzeichnis unmenschlicher Grausamkeiten,
die das Christentum begleitet haben, in den zahlreichen Religionskriegen,
den unverantwortlichen Kreuzzügen, in der Ausrottung eines großen Teils
der Ureinwohner Amerikas und Bevölkerung dieses Weltteils mit aus Afrika
herangeschleppten, ohne Recht, ohne einen Schein des Rechts, ihren Familien,
ihrem Vaterlande, ihrem Weltteil entrissenen und zu endloser Zuchthausarbeit
verdammten Negersklaven *), in den unermüdlichen Ketzerverfolgungen und
himmelschreienden Inquisitionsgerichten, in der Bartholomäusnacht, in
der Hinrichtung von 18 000 Niederländern durch Alba u. s. w. u. s. w.
— eher einen Ausschlag zu Ungunsten des Christentums besorgen lassen.
Ueberhaupt aber, wenn man die vortreffliche Moral, welche die christliche
und mehr oder weniger jede Religion predigt, vergleicht mit der Praxis
ihrer Bekenner, und sich vorstellt, wohin es mit dieser kommen würde,
wenn nicht der weltliche Arm die Verbrechen verhinderte, ja, was wir zu
befürchten hätten, wenn auch nur auf einen Tag alle Gesetze aufgehoben
würden; so wird man bekennen müssen, daß die Wirkung aller Religionen
auf die Moralität eigentlich sehr geringe ist. Hieran ist freilich die
Glaubensschwäche schuld. Theoretisch und solange es bei der frommen Betrachtung
bleibt, scheint jedem sein Glaube fest. Allein die That ist der harte
Probierstein aller unserer Ueberzeugungen: wenn es zu ihr kommt und nun
der Glaube durch große Entsagungen und schwere Opfer bewährt werden
soll; da zeigt sich die Schwäche desselben. Wenn ein Mensch ein Verbrechen
ernstlich meditiert; so hat er die Schranke der echten reinen Moralität
bereits durchbrochen: danach aber ist das erste, was ihn aufhält, allemal
der Gedanke an Justiz und Polizei. Entschlägt er sich dessen, durch die
Hoffnung diesen zu entgehen; so ist die zweite Schranke, die sich ihm
entgegenstellt, die Rücksicht auf seine Ehre. Kommt er nun aber auch
über diese Schutzwehr hinweg; so ist sehr viel dagegen zu wetten, daß,
nach Ueberwindung dieser zwei mächtigen Widerstände, jetzt noch irgend
ein Religionsdogma Macht genug über ihn haben werde, um ihn von der That
zurückzuhalten. Denn wen nahe und gewisse Gefahren nicht abschrecken,
den werden die entfernten und bloß auf Glauben beruhenden schwerlich
in Zaum halten. Ueberdies läßt sich gegen jede ganz allein aus religiösen
Ueberzeugungen hervorgegangene gute Handlung noch einwenden, daß sie
nicht uneigennützig gewesen, sondern aus Rücksicht auf Lohn und Strafe
geschehen sei, folglich keinen rein moralischen Wert habe. Diese Einsicht
finden wir stark ausgedrückt in einem Briefe des berühmten Großherzogs
Karl August von Weimar, wo es heißt: „Baron Weyhers fand selber, das
müsse ein schlechter Kerl sein, der durch Religion gut, und nicht von
Natur dazu geneigt sei. In vino veritas.” (Briefe an J. H. Merck, Br.
229.) — Nun betrachte man dagegen die von mir aufgestellte moralische
Triebfeder. Wer wagt es, einen Augenblick in Abrede zu stellen, daß sie
zu allen Zeiten, unter allen Völkern, in allen Lagen des Lebens, auch
im gesetzlosen Zustande, auch mitten unter den Greueln der Revolutionen
und Kriege, und im großen wie im kleinen, jeden Tag und jede Stunde,
eine entschiedene und wahrhaft wundersame Wirksamkeit äußert, täglich
vieles Unrecht verhindert, gar manche gute That, ohne alle Hoffnung auf
Lohn und oft ganz unerwartet ins Dasein ruft, und daß wo sie und nur
sie allein wirksam gewesen, wir alle mit Rührung und Hochachtung der
That den echten moralischen Wert unbedingt zugestehen. [...]
*) Noch jetzt wird, nach Buxton, The African slavetrade, 1839, ihre Zahl
jährlich durch ungefähr 150 000 frische Afrikaner vermehrt, bei deren
Einfangung und Reise über 200 000 andere jämmerlich umkommen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die von mir aufgestellte moralische Triebfeder bewährt sich als
die echte ferner dadurch, daß sie auch die Tiere in ihren Schutz nimmt,
für welche in den andern europäischen Moralsystemen so unverantwortlich
schlecht gesorgt ist. Die vermeinte Rechtlosigkeit der Tiere, der Wahn,
daß unser Handeln gegen sie ohne moralische Bedeutung sei, oder, wie
es in der Sprache jener Moral heißt, daß es gegen Tiere keine Pflichten
gebe, ist geradezu eine empörende Roheit und Barbarei des Occidents,
deren Quelle im Judentum liegt. In der Philosophie beruht sie auf der
aller Evidenz zum Trotz angenommenen gänzlichen Verschiedenheit zwischen
Mensch und Tier, welche bekanntlich am entschiedensten und grellsten von
Cartesius ausgesprochen ward, als eine notwendige Konsequenz seiner Irrtümer.
Als nämlich die Cartesisch-Leibniz-Wolfische Philosophie aus abstrakten
Begriffen die rationale Psychologie aufbaute und eine unsterbliche Anima
rationalis konstruierte; da traten die natürlichen Ansprüche der Tierwelt
diesem exklusiven Privilegio und Unsterblichkeitspatent der Menschenspezies
augenscheinlich entgegen, und die Natur legte, wie bei allen solchen Gelegenheiten,
still ihren Protest ein. Nun mußten die von ihrem intellektuellen Gewissen
geängstigten Philosophen suchen, die rationale Psychologie durch die
empirische zu stützen und daher bemüht sein, zwischen Mensch und Tier
eine ungeheure Kluft, einen unermeßlichen Abstand zu eröffnen, um, aller
Evidenz zum Trotz, sie als von Grund aus verschieden darzustellen. Solcher
Bemühungen spottet schon Boileau:
Les animaux ont-ils des universitès ?
Voit-on fleurir chez eux des quatre facultès ?
Da sollten am Ende gar die Tiere sich nicht von der Außenwelt zu unterscheiden
wissen und kein Bewußtsein ihrer selbst, kein Ich haben! Gegen solche
abgeschmackte Behauptungen darf man nur auf den jedem Tiere, selbst dem
kleinsten und letzten, inwohnenden grenzenlosen Egoismus hindeuten, der
hinlänglich bezeugt, wie sehr die Tiere sich ihres Ichs, der Welt oder
dem Nicht-Ich gegenüber bewußt sind. Wenn so ein Cartesianer sich zwischen
den Klauen eines Tigers befände, würde er auf das deutlichste inne werden,
welchen scharfen Unterschied ein solcher zwischen seinem Ich und Nicht-Ich
setzt. Solchen Sophistikationen der Philosophen entsprechend finden wir,
auf dem populären Wege, die Eigenheit mancher Sprachen, namentlich der
deutschen, daß sie für das Essen, Trinken, Schwangersein, Gebären,
Sterben und den Leichnam der Tiere ganz eigene Worte haben, um nicht die
gebrauchen zu müssen, welche jene Akte beim Menschen bezeichnen, und
so unter der Diversität der Worte die vollkommene Identität der Sache
zu verstecken. Da die alten Sprachen eine solche Duplizität der Ausdrücke
nicht kennen, sondern unbefangen dieselbe Sache mit demselben Worte bezeichnen;
so ist jener elende Kunstgriff ohne Zweifel das Werk europäischer Pfaffenschaft,
die, in ihrer Profanität, nicht glaubt weit genug gehen zu können im
Verleugnen und Lästern des ewigen Wesens, welches in allen Tieren lebt;
wodurch sie den Grund gelegt hat zu der in Europa üblichen Härte und
Grausamkeit gegen Tiere, auf welche ein Hochasiate nur mit gerechtem Abscheu
hinsehen kann. In der englischen Sprache begegnen wir jenem nichtswürdigen
Kunstgriff nicht; ohne Zweifel, weil die Sachsen, als sie England eroberten,
noch keine Christen waren. Dagegen findet sich ein Analogon desselben
in der Eigentümlichkeit, daß im Englischen alle Tiere generis neutrius
sind und daher durch das Pronomen it (es) vertreten werden, ganz wie leblose
Dinge; welches, zumal bei den Primaten, wie Hunde, Affen u. s. w., ganz
empörend ausfällt und unverkennbar ein Pfaffenkniff ist, um die Tiere
zu Sachen herabzusetzen. Die alten Aegypter, deren ganzes Leben religiösen
Zwecken geweiht war, setzten in denselben Grüften die Mumien der Menschen
und die der Ibisse, Krokodile u. s. w. bei: aber in Europa ist es ein
Greuel und Verbrechen, wenn der treue Hund neben der Ruhestätte seines
Herrn begraben wird, auf welcher er bisweilen, aus einer Treue und Anhänglichkeit,
wie sie beim Menschengeschlechte nicht gefunden wird, seinen eigenen Tod
abgewartet hat. — Auf die Erkenntnis der Identität des Wesentlichen
in der Erscheinung des Tiers und der des Menschen leitet nichts entschiedener
hin, als die Beschäftigung mit Zoologie und Anatomie: was soll man daher
sagen, wenn heutzutage ein frömmelnder Zootom einen absoluten und radikalen
Unterschied zwischen Mensch und Tier zu urgieren sich erdreistet und hierin
so weit geht, die redlichen Zoologen, welche, fern von aller Pfäfferei,
Augendienerei und Tartüffianismus, an der Hand der Natur und Wahrheit
ihren Weg verfolgen, anzugreifen und zu verunglimpfen?
Man muß wahrlich an allen Sinnen blind, oder vom Foetor Judaicus total
chloroformiert sein, um nicht zu erkennen, daß das Wesentliche und Hauptsächliche
im Tiere und im Menschen dasselbe ist und daß was beide unterscheidet,
nicht im Primären, im Prinzip, im Archäus, im innern Wesen, im Kern
beider Erscheinungen liegt, als welcher in der einen wie in der andern
der Wille des Individuums ist, sondern allein im Sekundären, im Intellekt,
im Grad der Erkenntniskraft, welcher beim Menschen, durch das hinzugekommene
Vermögen abstrakter Erkenntnis, genannt Vernunft, ein ungleich höherer
ist, jedoch erweislich nur vermöge einer größern cerebralen Entwickelung,
also der somatischen Verschiedenheit eines einzigen Teiles, des Gehirns,
und namentlich seiner Quantität nach. Hingegen ist des Gleichartigen
zwischen Tier und Mensch, sowohl psychisch als somatisch, ohne allen Vergleich
mehr. So einem occidentalischen, judaisierten Tierverächter und Vernunftidolater
muß man in Erinnerung bringen, daß, wie er von seiner Mutter, so auch
der Hund von der seinigen gesäugt worden ist. Daß sogar Kant in jenen
Fehler der Zeit- und Landesgenossen gefallen ist, habe ich oben gerügt.
Daß die Moral des Christentums die Tiere nicht berücksichtigt, ist ein
Mangel derselben, den es besser ist einzugestehen, als zu perpetuieren,
und über den man sich um so mehr wundern muß, als diese Moral im übrigen
die größte Uebereinstimmung zeigt mit der des Brahmanismus und Buddhaismus,
bloß weniger stark ausgedrückt und nicht bis zu den Extremen durchgeführt
ist; daher man kaum zweifeln kann, daß sie, wie auch die Idee von einem
Mensch gewordenen Gotte (Avatar), aus Indien stammt und über Aegypten
nach Judäa gekommen sein mag; so daß das Christentum ein Abglanz indischen
Urlichtes von den Ruinen Aegyptens wäre, welcher aber leider auf jüdischen
Boden viel. Als ein artiges Symbol des eben gerügten Mangels in der christlichen
Moral, bei ihrer sonstigen großen Uebereinstimmung mit der indischen,
ließe sich der Umstand auffassen, daß Johannes der Täufer ganz in der
Weise eines indischen Saniassis auftritt, dabei aber — in Tierfelle
gekleidet! welches bekanntlich jedem Hindu ein Greuel sein würde; da
sogar die Königliche Societät zu Kalkutta ihr Exemplar der Veden nur
unter dem Versprechen erhielt, daß sie es nicht, nach europäischer Weise,
in Leder binden lassen würde: daher es sich in ihrer Bibliothek in Seide
gebunden vorfindet. Einen ähnlichen, charakteristischen Kontrast bietet
die evangelische Geschichte vom Fischzuge Petri, den der Heiland, durch
ein Wunder, dermaßen segnet, daß die Böte mit Fischen bis zum Sinken
überfüllt werden (Luk. 5), mit der Geschichte von dem in ägyptische
Weisheit eingeweihten Pythagoras, welcher den Fischern ihren Zug, während
das Netz noch unter dem Wasser liegt, abkauft, um sodann allen gefangenen
Fischen ihre Freiheit zu schenken (Apul. de magia, p. 36. Bip.). — Mitleid
mit Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, daß
man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen Tiere grausam ist, könne
kein guter Mensch sein. Auch zeigt dieses Mitleid sich als aus derselben
Quelle mit der gegen Menschen zu übenden Tugend entsprungen. So z. B.
werden feinfühlende Personen, bei der Erinnerung, daß sie, in übler
Laune, im Zorn, oder vom Wein erhitzt, ihren Hund, ihr Pferd, ihren Affen
unverdienter- oder unnötigerweise, oder über die Gebühr gemißhandelt
haben, dieselbe Reue, dieselbe Unzufriedenheit mit sich selbst empfinden,
welche bei der Erinnerung an gegen Menschen verübtes Unrecht empfunden
wird, wo sie die Stimme des strafenden Gewissens heißt. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Denn grenzenloses Mitleid mit allen lebenden Wesen ist der festeste
und sicherste Bürge für das sittliche Wohlverhalten und bedarf keiner
Kasuistik. Wer davon erfüllt ist, wird zuverlässig keinen verletzen,
keinen beeinträchtigen, keinem wehe thun, vielmehr mit jedem Nachsicht
haben, jedem verzeihen, jedem helfen, so viel er vermag, und alle seine
Handlungen werden das Gepräge der Gerechtigkeit und Menschenliebe tragen.
Hingegen versuche man einmal zu sagen: „Dieser Mensch ist tugendhaft,
aber er kennt kein Mitleid.“ Oder: „Es ist ein ungerechter und boshafter
Mensch; jedoch ist er sehr mitleidig“; so wird der Widerspruch fühlbar.
— Der Geschmack ist verschieden; aber ich weiß mir kein schöneres
Gebet, als das, womit die alt-indischen Schauspiele (wie in früheren
Zeiten die englischen mit dem für den König) schließen. Es lautet:
„Mögen alle lebende Wesen von Schmerzen frei bleiben.“ [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Von Autoritäten abseiten der Schulen, wie gesagt, entblößt, führe
ich noch an, daß die Chinesen fünf Kardinaltugenden (Tschang) annehmen,
unter welchen das Mitleid (Sin) obenansteht. Die übrigen vier sind: Gerechtigkeit,
Höflichkeit, Weisheit und Aufrichtigkeit*). Dem entsprechend sehen wir
auch bei den Hindu, auf den zum Andenken verstorbener Fürsten errichteten
Gedächtnistafeln, unter den ihnen nachgerühmten Tugenden das Mitleid
mit Menschen und Tieren die erste Stelle einnehmen. In Athen hatte das
Mitleid einen Altar auf dem Forum: ͗Αϑηναίοις ϐέ έν τή
άγορά έστι ͗Ελέου βωμός, ώ μάλιστα ϑεών,
ές άνϑρώπινον βίον καί μεταβολάς πραγμάτων
ότι ώφέλιμος, μόνοι τιμάς ͑Ελλήνων νέμουσιν
͗Αϑηναίοι. Παυσ., I, 17. (Atheniensibus in foro commiserationis
ara est, quippe cui, inter omnes Deos, vitam humanam et mutationem rerum
maxime adjuvanti, soli inter Graecos, honores tribuunt Athenienses.) Diesen
Altar erwähnt auch Lukianos im Timon, § 99. — Ein von Stobäos uns
aufbehaltener Ausspruch des Phokion stellt das Mitleid als das Allerheiligste
im Menschen dar: οϋτε έξ ίεροϋ βωμόν, οΰτε έκ τής
άνϑρωπίνης φύσεως άφαιρετέον τόν έλεον
(nec aram e fano, nec commiserationem e vita humana tollendam esse). In
der Sapientia Indorum, welches die griechische Uebersetzung des Pantscha
Tantra ist, heißt es (Sect. 3, p. 220): Λέγεται γάρ, ώς πρώτη
τών άρετών ή έλεημοσύνη (princeps virtutum misericordia
censetur). Man sieht, daß alle Zeiten und alle Länder sehr wohl die
Quelle der Moralität erkannt haben; nur Europa nicht; woran allein der
Foetor Judaicus schuld ist, der hier alles und alles durchzieht: da muß
es dann schlechterdings ein Pflichtgebot, ein Sittengesetz, ein Imperativ,
kurzum, eine Ordre und Kommando sein, dem pariert wird: davon gehen sie
nicht ab, und wollen nicht einsehen, daß dergleichen immer nur den Egoismus
zur Grundlage hat. Bei einzelnen freilich und Ueberlegenen hat die gefühlte
Wahrheit sich kundgegeben: so bei Rousseau, wie oben angeführt; und auch
Lessing, in einem Briefe von 1756, sagt: „Der mitleidigste Mensch ist
der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten
der Großmut der aufgelegteste.“ [...]
*) Journ. Asiatique, Vol. 9, p. 62, zu vergleichen mit Meng-Tseu, ed.
Stan. Julien, 1824, L. I. § 45; auch mit Meng-Tseu in den Livres sacrès
de l’0rient par Pauthier, p. 281.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In allen Jahrhunderten hat die arme Wahrheit darüber erröten müssen,
daß sie paradox war: und es ist doch nicht ihre Schuld. Sie kann nicht
die Gestalt des thronenden allgemeinen Irrtums annehmen. Da sieht sie
seufzend auf zu ihrem Schutzgott, der Zeit, welcher ihr Sieg und Ruhm
zuwinkt, aber dessen Flügelschläge so groß und langsam sind, daß das
Individuum darüber hinstirbt. So bin denn auch ich mir des Paradoxen,
welches diese metaphysische Auslegung des ethischen Urphänomens für
die an ganz anderartige Begründungen der Ethik gewöhnten occidentalisch
Gebildeten haben muß, sehr wohl bewußt, kann jedoch nicht der Wahrheit
Gewalt anthun. Vielmehr ist alles, was ich, aus dieser Rücksicht, über
mich vermag, daß ich durch eine Anführung belege, wie jene Metaphysik
der Ethik schon vor Jahrtausenden die Grundansicht der indischen Weisheit
war, auf welche ich zurückdeute, wie Kopernikus auf das von Aristoteles
und Ptolemäus verdrängte Weltsystem der Pythagoreer. Im Bhagavad-Gita,
Lectio 13; 27, 28, heißt es, nach A. W. v. Schlegels Uebersetzung: Eundem
in omnibus animantibus consistentem summum dominum, istis pereuntibus
haud pereuntem qui cernit, is vere cernit. — Eundem vero cernens ubique
praesentem dominum, non violat semet ipsum sua ipsius culpa: exinde pergit
ad summum iter.
Bei diesen Andeutungen zur Metaphysik der Ethik muß ich es bewenden lassen,
obwohl noch ein bedeutender Schritt in derselben zu thun übrig bleibt.
Allein dieser setzt voraus, daß man auch in der Ethik selbst einen Schritt
weiter gegangen wäre, welches ich nicht thun durfte, weil in Europa der
Ethik ihr höchstes Ziel in der Rechts- und Tugendlehre gesteckt ist,
und man was über diese hinausgeht nicht kennt, oder doch nicht gelten
läßt. Dieser notwendigen Unterlassung also ist es zuzuschreiben, daß
die dargelegten Umrisse der Metaphysik der Ethik noch nicht, auch nur
aus der Ferne, den Schlußstein des ganzen Gebäudes der Metaphysik, oder
den eigentlichen Zusammenhang der Divina Commedia absehen lassen. Dies
lag aber auch weder in der Aufgabe, noch in meinem Plan. Denn man kann
nicht alles in einem Tage sagen, und soll auch nicht mehr antworten, als
man gefragt ist.
Indem man sucht, menschliche Erkenntnis und Einsicht zu fördern, wird
man stets den Widerstand des Zeitalters empfinden, gleich dem einer Last,
die man zu ziehen hätte, und die schwer auf den Boden drückt, aller
Anstrengung trotzend. Dann muß man sich trösten mit der Gewißheit,
zwar die Vorurteile gegen sich, aber die Wahrheit für sich zu haben,
welche, sobald nur ihr Bundesgenosse, die Zeit, zu ihr gestoßen sein
wird, des Sieges vollkommen gewiß ist, mithin, wenn auch nicht heute,
doch morgen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Da dieses alles nicht nur a priori demonstrabel ist, sondern sogar
die tägliche Erfahrung uns deutlich lehrt, daß jeder seinen moralischen
Charakter schon fertig mit auf die Welt bringt und ihm bis ans Ende unwandelbar
treu bleibt, und da ferner diese Wahrheit im realen, praktischen Leben
stillschweigend, aber sicher, vorausgesetzt wird, indem jeder sein Zutrauen,
oder Mißtrauen, zu einem andern den einmal an den Tag gelegten Charakterzügen
desselben gemäß auf immer feststellt; so könnte man sich wundern, wie
doch nur, seit beiläufig 1600 Jahren, das Gegenteil theoretisch behauptet
und demnach gelehrt wird, alle Menschen seien, in moralischer Hinsicht,
ursprünglich ganz gleich, und die große Verschiedenheit ihres Handelns
entspringe nicht aus ursprünglicher, angeborner Verschiedenheit der Anlage
und des Charakters, ebensowenig aber aus den eintretenden Umständen und
Anlässen; sondern eigentlich aus gar nichts, welches Garnichts sodann
den Namen „freier Wille“ erhält. — Allein diese absurde Lehre wird
notwendig gemacht durch eine andere, ebenfalls rein theoretische Annahme,
mit der sie genau zusammenhängt, nämlich durch diese, daß die Geburt
des Menschen der absolute Anfang seines Daseins sei, indem derselbe aus
nichts geschaffen (ein Terminus ad hoc) werde. Wenn nun, unter dieser
Voraussetzung, das Leben noch eine moralische Bedeutung und Tendenz behalten
soll; so muß diese freilich erst im Laufe desselben ihren Ursprung finden,
und zwar aus nichts, wie dieser ganze so gedachte Mensch aus nichts ist:
denn jede Beziehung auf eine vorhergängige Bedingung, ein früheres Dasein,
oder eine außerzeitliche That, auf dergleichen doch die unermeßliche,
ursprüngliche und angeborne Verschiedenheit der moralischen Charaktere
deutlich zurückweist, bleibt hier, ein für allemal, ausgeschlossen.
Daher also die absurde Fiktion eines freien Willens. — Die Wahrheiten
stehn bekanntlich alle im Zusammenhange; aber auch die Irrtümer machen
einander nötig, — wie eine Lüge eine zweite erfordert, oder wie zwei
Karten, gegeneinander gestemmt, sich wechselseitig stützen, — solange
nichts sie beide umstößt.
3. Nicht viel besser, als mit der Willensfreiheit, steht es, unter Annahme
des Theismus, mit unsrer Fortdauer nach dem Tode. Was von einem andern
geschaffen ist, hat einen Anfang seines Daseins gehabt. Daß nun dasselbe,
nachdem es doch eine unendliche Zeit gar nicht gewesen, von nun an in
alle Ewigkeit fortdauern solle, ist eine über die Maßen kühne Annahme.
Bin ich allererst bei meiner Geburt aus Nichts geworden und geschaffen;
so ist die höchste Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß ich im Tode wieder
zu nichts werde. Unendliche Dauer a parte post und Nichts a parte ante
geht nicht zusammen. Nur was selbst ursprünglich, ewig, ungeschaffen
ist, kann unzerstörbar sein. (S. Aristoteles, De coelo, I, 12. 282, a.
25 ff. und Priestley, On matter and spirit, Birmingham 1782, Vol. I, p.
234.) Allenfalls können daher die im Tode verzagen, welche glauben, vor
30 oder 60 Jahren ein reines Nichts gewesen und aus diesem sodann als
das Werk eines andern hervorgegangen zu sein; da sie jetzt die schwere
Aufgabe haben, anzunehmen, daß ein so entstandenes Dasein, seines späten,
erst nach Ablauf einer unendlichen Zeit eingetretenen Anfangs ungeachtet,
doch von endloser Dauer sein werde. Hingegen wie sollte der den Tod fürchten,
der sich als das ursprüngliche und ewige Wesen, die Quelle alles Daseins
selbst, erkennt, und weiß, daß außer ihm eigentlich nichts existiert;
der mit dem Spruche des heiligen Upanischads hae omnes creaturae in totum
ego sum, et praeter me aliud ens non est im Munde, oder doch im Herzen,
sein individuelles Dasein endigt. Also nur er kann, bei konsequentem Denken,
ruhig sterben. Denn, wie gesagt, Aseität ist die Bedingung, wie der Zurechnungsfähigkeit,
so auch der Unsterblichkeit. Diesem entsprechend ist in Indien die Verachtung
des Todes und die vollkommenste Gelassenheit, selbst Freudigkeit im Sterben
recht eigentlich zu Hause. Das Judentum hingegen, welches ursprünglich
die einzige und alleinige rein monotheistische, einen wirklichen Gott=Schöpfer
Himmels und der Erden lehrende Religion ist, hat, mit vollkommener Konsequenz,
keine Unsterblichkeitslehre, also auch keine Vergeltung nach dem Tode,
sondern bloß zeitliche Strafen und Belohnungen; wodurch es sich ebenfalls
von allen andern Religionen, wenn auch nicht zu seinem Vorteil, unterscheidet
*). Die dem Judentum entsprossenen zwei Religionen sind, indem sie, aus
besseren, ihnen anderweitig bekannt gewordenen Glaubenslehren, die Unsterblichkeit
hinzunahmen und doch den Gott=Schöpfer beibehielten, hierin eigentlich
inkonsequent geworden.
Daß, wie eben gesagt, das Judentum die alleinige rein monotheistische,
d. h. einen Gott=Schöpfer als Ursprung aller Dinge lehrende Religion
sei, ist ein Verdienst, welches man, unbegreiflicherweise, zu verbergen
bemüht gewesen ist, indem man stets behauptet und gelehrt hat, alle Völker
verehrten den wahren Gott, wenn auch unter andern Namen. Hieran fehlt
jedoch nicht nur viel, sondern alles. Daß der Buddhaismus, also die Religion,
welche durch die überwiegende Anzahl ihrer Bekenner die vornehmste auf
Erden ist, durchaus und ausdrücklich atheistisch sei, ist durch die Uebereinstimmung
aller unverfälschten Zeugnisse und Urschriften außer Zweifel gesetzt.
Auch die Veden lehren keinen Gott=Schöpfer, sondern eine Weltseele, genannt
das Brahm (im Neutro), wovon der, dem Nabel des Wischnu entsprossene Brahma,
mit den vier Gesichtern und als Teil des Trimurti, bloß eine populäre
Personifikation, in der so höchst durchsichtigen indischen Mythologie
ist. Er stellt offenbar die Zeugung, das Entstehen der Wesen, wie Wischnu
ihre Akme, und Schiwa ihren Untergang dar. Auch ist sein Herbringen der
Welt ein sündlicher Akt, eben wie die Weltinkarnation des Brahm. Sodann
dem Ormuzd der Zendavesta ist, wie wir wissen, Ahriman ebenbürtig, und
beide sind aus der ungemessenen Zeit, Zervane Akerene (wenn es damit seine
Richtigkeit hat), hervorgegangen. Ebenfalls in der von Sanchoniathon niedergeschriebenen
und von Philo Byblius uns aufbehaltenen sehr schönen und höchst lesenswerten
Kosmogonie der Phönicier, die vielleicht das Urbild der mosaischen ist,
finden wir keine Spur von Theismus oder Weltschöpfung durch ein persönliches
Wesen. Nämlich auch hier sehn wir, wie in der mosaischen Genesis, das
ursprüngliche Chaos in Nacht versenkt; aber kein Gott tritt auf, befehlend,
es werde Licht, und werde dies und werde das: o nein! sondern ήρασϑη
το πνευμα τον ίδιων άρχων: der in der Masse gärende
Geist verliebt sich in sein eigenes Wesen, wodurch eine Mischung jener
Urbestandteile der Welt entsteht, aus welcher, und zwar, sehr treffend
und bedeutungsvoll, infolge eben der Sehnsucht, ποϑος, welche, wie
der Kommentator richtig bemerkt, der Eros der Griechen ist, sich der Urschlamm
entwickelt, und aus diesem zuletzt Pflanzen und endlich auch erkennende
Wesen, d. i. Tiere hervorgehn. Denn bis dahin ging, wie ausdrücklich
bemerkt wird, alles ohne Erkenntnis vor sich: αυτο δε ουκ εγιγνωσκε
την έαυτου κτισιν. So steht es, fügt Sanchoniathon hinzu,
in der von Taaut, dem Aegypter, niedergeschriebenen Kosmogonie. Auf seine
Kosmogonie folgt sodann die nähere Zoogonie. Gewisse atmosphärische
und terrestrische Vorgänge werden beschrieben, die wirklich an die folgerichtigen
Annahmen unserer heutigen Geologie erinnern: zuletzt folgt auf heftige
Regengüsse Donner und Blitz, von dessen Krachen aufgeschreckt die erkennenden
Tiere
ins Dasein erwachen, „und nunmehr bewegt sich, auf der Erde und im Meer,
das Männliche und Weibliche“. — Eusebius, dem wir diese Bruchstücke
des Philo Byblius verdanken (s. Praeparat. evangel. L. II, c. 10), klagt
demnach mit vollem Recht diese Kosmogonie des Atheismus an: das ist sie
unstreitig, wie alle und jede Lehre von der Entstehung der Welt, mit alleiniger
Ausnahme der jüdischen. — In der Mythologie der Griechen und Römer
finden wir zwar Götter, als Väter von Göttern und beiläufig von Menschen
(obwohl diese ursprünglich die Töpferarbeit des Prometheus sind), jedoch
keinen Gott=Schöpfer. Denn daß späterhin ein paar mit dem Judentum
bekannt gewordene Philosophen den Vater Zeus zu einem solchen haben umdeuten
wollen, kümmert diesen nicht; so wenig, wie daß ihn, ohne seine Erlaubnis
dazu eingeholt zu haben, Dante, in seiner Hölle, mit dem Domeneddio,
dessen unerhörte Rachsucht und Grausamkeit daselbst celebriert und ausgemalt
wird, ohne Umstände identifizieren will; z. B. C. 14, 70. C. 31, 92.
Endlich (denn man hat nach allem gegriffen) ist auch die unzähligemal
wiederholte Nachricht, daß die nordamerikanischen Wilden unter dem Namen
des großen Geistes Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, verehrten,
mithin reine Theisten wären, ganz unrichtig. Dieser Irrtum ist neuerlich
widerlegt worden, durch eine Abhandlung über die nordamerikanischen Wilden,
welche John Scouler in einer 1846 gehaltenen Sitzung der Londoner ethnographischen
Gesellschaft vorgelesen hat und von welcher l’institut, journal des
sociètès savantes, Sect. 2, Juillet 1847, einen Auszug gibt. Er sagt:
„Wenn man uns, in den Berichten über die Superstitionen der Indianer,
vom großen Geiste spricht, sind wir geneigt, anzunehmen, daß dieser
Ausdruck eine Vorstellung bezeichne, die mit der, welche wir daran knüpfen,
übereinstimmt und daß ihr Glaube ein einfacher, natürlicher Theismus
sei. Allein diese Auslegung ist von der richtigen sehr weit entfernt.
Die Religion dieser Indianer ist vielmehr ein reiner Fetischismus, der
in Zaubermitteln und Zaubereien besteht. In dem Berichte Tanners, der
von Kindheit an unter ihnen gelebt hat, sind die Details getreu und merkwürdig,
hingegen weit verschieden von den Erfindungen gewisser Schriftsteller:
man ersieht nämlich daraus, daß die Religion dieser Indianer wirklich
nur ein Fetischismus ist, dem ähnlich, welcher ehemals bei den Finnen
und noch jetzt bei den sibirischen Völkern angetroffen wird. Bei den
östlich vom Gebirge wohnenden Indianern besteht der Fetisch bloß in
erstwelchem Gegenstande, dem man geheimnisvolle Eigenschaften beilegt“
u. s. w.
Diesem allen zufolge hat die hier in Rede stehende Meinung vielmehr ihrem
Gegenteile Platz zu machen, daß nämlich nur ein einziges, zwar sehr
kleines, unbedeutendes, von allen gleichzeitigen Völkern verachtetes
und ganz allein unter allen ohne irgend einen Glauben an Fortdauer nach
dem Tode lebendes, aber nun einmal dazu auserwähltes Volk reinen Monotheismus,
oder die Erkenntnis des wahren Gottes gehabt habe; und auch dieses nicht
durch Philosophie, sondern allein durch Offenbarung; wie es auch dieser
angemessen ist: denn welchen Wert hätte eine Offenbarung, die nur das
lehrte, was man auch ohne sie wüßte? — Daß kein anderes Volk einen
solchen Gedanken jemals gefaßt hat, muß demnach zur Wertschätzung der
Offenbarung beitragen.
*) Die eigentliche Judenreligion, wie sie in der Genesis und allen historischen
Büchern, bis zum Ende der Chronika, dargestellt und gelehrt wird, ist
die roheste aller Religionen, weil sie die einzige ist, die durchaus keine
Unsterblichkeitslehre, noch irgend eine Spur davon, hat. Jeder König
und jeder Held oder Prophet wird, wenn er stirbt, bei seinen Vätern begraben,
und damit ist alles aus: keine Spur von irgend einem Dasein nach dem Tode;
ja, wie absichtlich, scheint jeder Gedanke dieser Art beseitigt zu sein.
Z. B. dem König Josias hält der Jehovah eine lange Belobungsrede: sie
schließt mit der Verheißung einer Belohnung, diese lautet: ίδου
πϱοςτιϑημι σε πϱος τους πατεϱας σου και
πϱοςτεϑηση πϱος τα μνηματα σου έν είϱηνη
(2. Chron. 34, 28) und daß er also den Nebukadnezar nicht erleben soll.
Aber kein Gedanke an ein anderes Dasein nach dem Tode und damit an einen
positiven Lohn, statt des bloß negativen, zu sterben, und keine fernere
Leiden zu erleben. Sondern, hat der Herr Jehovah sein Werk und Spielzeug
genugsam abgenutzt und abgequält, so schmeißt er es weg, auf den Mist:
das ist der Lohn für dasselbe. Eben weil die Judenreligion keine Unsterblichkeit,
folglich auch keine Strafen nach dem Tode kennt, kann der Jehovah dem
Sünder, dem es auf Erden wohlgeht, nichts anderes androhen, als daß
er dessen Missethaten an seinen Kindern und Kindeskindern, bis ins vierte
Geschlecht, strafen werde, wie zu ersehen Exodus, c. 34, v. 7, und Numeri,
c. 14, v. 18. — Dies beweist die Abwesenheit aller Unsterblichkeitslehre.
Ebenfalls noch die Stelle im Tobias, K. 3, 6, wo dieser den Jehovah um
seinen Tod bittet, όπως άπολυϑω και γενωμαι γη;
weiter nichts, von einem Dasein nach dem Tode kein Begriff. — Im A.
T. wird als Lohn der Tugend verheißen, recht lange auf Erden zu leben
(z. B. 5. Moses, K. 5, V. 16 und 33), im Veda hingegen, nicht wieder geboren
zu werden. — Die Verachtung, in der die Juden stets bei allen ihnen
gleichzeitigen Völkern standen, mag großenteils auf der armseligen Beschaffenheit
ihrer Religion beruht haben.
Was Koheleth 3, 19, 20 ausspricht, ist die eigentliche Gesinnung der Judenreligion.
Wenn etwan, wie im Daniel 12, 2, auf eine Unsterblichkeit angespielt wird,
so ist es fremde hineingebrachte Lehre, wie dies aus Daniel 1, 4 und 6
hervorgeht. Im 2. Buch der Makkabäer K. 7 tritt die Unsterblichkeitslehre
deutlich auf: Babylonischen Ursprungs. Alle andern Religionen, die der
Inder, sowohl Brahmanen als Buddhaisten, Aegypter, Perser, ja, der Druiden,
lehren Unsterblichkeit und auch, mit Ausnahme der Perser im Zendavesta,
Metempsychose. Daß die Edda, namentlich die Voluspa, Seelenwanderung
lehrt, bezeugt D. G. v. Ekendahl, in seiner Recension der Svenska Siare
och skalder von Atterbom — in den Blättern für litter. Unterhaltung,
den 25. August 1843. Selbst Griechen und Römer hatten etwas post letum,
Tartarus und Elysium, und sagten:
Sunt aliquid manes, letum non omnia finit:
Luridaque evictos effugit umbra rogos.
Propert. Eleg. IV, 7.
Ueberhaupt besteht das eigentlich Wesentliche einer Religion als solcher
in der Ueberzeugung, die sie uns gibt, daß unser eigentliches Dasein
nicht auf unser Leben beschränkt, sondern unendlich ist. Solches nun
leistet diese erbärmliche Judenreligion durchaus nicht, ja unternimmt
es nicht. Darum ist sie die roheste und schlechteste unter allen Religionen,
besteht bloß in einem absurden und empörenden Theismus und läuft darauf
hinaus, daß der κυϱιος, der die Welt geschaffen hat, verehrt sein
will: daher er vor allen Dingen eifersüchtig (eifrig), neidisch ist auf
seine Kameraden, die übrigen Götter: wird denen geopfert, so ergrimmt
er, und seinen Juden geht’s schlecht. Alle diese andern Religionen und
ihre Götter werden in der LXX βδελυγμα geschimpft: aber das unsterblichkeitslose
rohe Judentum verdient eigentlich diesen Namen. Daß dasselbe die Grundlage
der in Europa herrschenden Religion geworden ist, ist höchst beklagenswert.
Denn es ist eine Religion ohne alle metaphysische Tendenz. Während alle
andern Religionen die metaphysische Bedeutung des Lebens dem Volke in
Bild und Gleichnis beizubringen suchen, ist die Judenreligion ganz immanent
und liefert nichts als ein bloßes Kriegsgeschrei bei Bekämpfung anderer
Völker. Lessings Erziehung des Menschengeschlechts sollte heißen: Erziehung
des Judengeschlechts: denn das ganze Menschengeschlecht war von jener
Wahrheit überzeugt; mit Ausnahme dieser Auserwählten. Sind doch eben
die Juden das auserwählte Volk ihres Gottes, und er ist der auserwählte
Gott seines Volkes. Und das hat weiter niemanden zu kümmern. (Εσομαι
αυτων ϑεος και αυτοι εσονται μου λαος —
ist eine Stelle aus einem Propheten — nach Clemens Alexandrinus.) —
Wenn ich aber bemerke, daß die gegenwärtigen europäischen Völker sich
gewissermaßen als die Erben jenes auserwählten Volkes Gottes ansehn,
so kann ich mein Bedauern nicht verhehlen. Hingegen kann man dem Judentum
den Ruhm nicht streitig machen, daß es die einzige wirklich monotheistische
Religion auf Erden sei: keine andere hat einen objektiven Gott, Schöpfer
Himmels und der Erde aufzuweisen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Vor allem aber ist, unter den Lehren des Empedokles, sein entschiedener
Pessimismus beachtenswert. Er hat das Elend unseres Daseins vollkommen
erkannt und die Welt ist ihm, so gut wie den wahren Christen, ein Jammerthal,
— Ατης λειμων. Schon er vergleicht sie, wie später Plato,
mit einer finstern Höhle, in der wir eingesperrt wären. In unserm irdischen
Dasein sieht er einen Zustand der Verbannung und des Elends, und der Leib
ist der Kerker der Seele. Diese Seelen haben einst sich in einem unendlich
glücklichen Zustande befunden und sind durch eigene Schuld und Sünde
in das gegenwärtige Verderben geraten, in welches sie, durch sündigen
Wandel, sich immer mehr verstricken und in den Kreislauf der Metempsychose
geraten, hingegen durch Tugend und Sittenreinheit, zu welcher auch die
Enthaltung von tierischer Nahrung gehört, und durch Abwendung von den
irdischen Genüssen und Wünschen wieder in den ehemaligen Zustand zurückgelangen
können. — Also dieselbe Urweisheit, die den Grundgedanken des Brahmanismus
und Buddhaismus, ja, auch des wahren Christentums (darunter nicht der
optimistische, jüdisch-protestantische Rationalismus zu verstehn ist)
ausmacht, hat auch dieser uralte Grieche sich zum Bewußtsein gebracht;
wodurch der Consensus gentium darüber sich vervollständigt. Daß Empedokles,
den die Alten durchgängig als einen Pythagoreer bezeichnen, diese Ansicht
vom Pythagoras überkommen habe, ist wahrscheinlich: zumal, da im Grunde
auch Plato sie teilt, der ebenfalls noch unter dem Einflusse des Pythagoras
steht. Zur Lehre von der Metempsychose, die mit dieser Weltansicht zusammenhängt,
bekennt Empedokles sich auf das entschiedenste. — Die Stellen der Alten,
welche, nebst seinen eigenen Versen von jener Weltauffassung des Empedokles
Zeugnis ablegen, findet man mit großem Fleiße zusammengestellt in Sturzii
Empedocles Agrigentinus, S. 448 — 458. — Die Ansicht, daß der Leib
ein Kerker, das Leben ein Zustand des Leidens und der Läuterung sei,
aus welchem der Tod uns erlöst, wenn wir der Seelenwanderung quitt werden,
teilen Aegypter, Pythagoreer, Empedokles, mit Hindu und Buddhaisten. Mit
Ausnahme der Metempsychose ist sie auch im Christentum enthalten. Jene
Ansicht der Alten bezeugen Diodorus Siculus und Cicero. (S. Wernsdorf,
De metempsychosi Veterum, p. 31 und Cic. fragmenta, p. 299 [somn. scip.],
316, 319. ed. Bip.) Cicero gibt an diesen Stellen nicht an, welcher Philosophenschule
solche angehören; doch scheinen es Ueberreste Pythagorischer Weisheit
zu sein. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Es ist nämlich gut sich bei jeder Gelegenheit zu überzeugen,
daß eigentlicher Theismus und Judentum Wechselbegriffe sind. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Der ernstlich gemeinte Theismus setzt notwendig voraus, daß man
die Welt einteile in Himmel und Erde: auf dieser laufen die Menschen herum;
in jenem sitzt der Gott, der sie regiert. Nimmt nun die Astronomie den
Himmel weg; so hat sie den Gott mit weggenommen: sie hat nämlich die
Welt so ausgedehnt, daß für den Gott kein Raum übrig bleibt. Aber ein
persönliches Wesen, wie jeder Gott unumgänglich ist, das keinen Ort
hätte, sondern überall und nirgends wäre, läßt sich bloß sagen,
nicht imaginieren, und darum nicht glauben. Demnach muß, in dem Maße,
als die physische Astronomie popularisiert wird, der Theismus schwinden,
so fest er auch durch unablässiges und feierlichstes Vorsagen den Menschen
eingeprägt worden; wie denn auch die katholische Kirche dies sofort richtig
erkannt und demgemäß das Kopernikanische System verfolgt hat: worüber
daher sich so sehr und mit Zetergeschrei über die Bedrängnis des Galilei
zu verwundern einfältig ist: denn omnis natura vult esse conservatrix
sui. Wer weiß, ob nicht irgend eine stille Erkenntnis, oder wenigstens
Ahndung dieser Kongenialität des Aristoteles mit der Kirchenlehre, und
der durch ihn beseitigten Gefahr, zu seiner übermäßigen Verehrung im
Mittelalter beigetragen hat? Wer weiß, ob nicht mancher, angeregt durch
die Berichte desselben über die älteren astronomischen Systeme, im stillen,
lange vor Kopernikus, die Wahrheiten eingesehen hat, die dieser, nach
vieljährigem Zaudern und im Begriff aus der Welt zu scheiden, endlich
zu proklamieren wagte?
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wie nämlich das Schlimmste, was einem Staate widerfahren kann,
ist, daß die verworfenste Klasse, der Hefen der Gesellschaft ans Ruder
kommt; so kann der Philosophie und allem von ihr Abhängigen, also dem
ganzen Wissen und Geistesleben der Menschheit, nichts Schlimmeres begegnen,
als daß ein Alltagskopf, der sich bloß einerseits durch seine Obsequiosität,
und andrerseits durch seine Frechheit im Unsinnschreiben auszeichnet,
mithin so ein Hegel, als das größte Genie und als der Mann, in welchem
die Philosophie ihr lang verfolgtes Ziel endlich und für immer erreicht
hat, mit größtem, ja beispiellosem Nachdruck proklamiert wird. Denn
die Folge eines solchen Hochverrats am Edelsten der Menschheit ist nachher
ein Zustand, wie jetzt der philosophische, und dadurch der litterarische
überhaupt, in Deutschland: Unwissenheit mit Unverschämtheit verbrüdert
an der Spitze, Kamaraderie an der Stelle der Verdienste, völlige Verworrenheit
aller Grundbegriffe, gänzliche Desorientation und Desorganisation der
Philosophie, Plattköpfe als Reformatoren der Religion, freches Auftreten
des Materialismus und Bestialismus, Unkenntnis der alten Sprachen und
Verhunzen der eigenen durch hirnlose Wortbeschneiderei und niederträchtige
Buchstabenzählerei, nach selbsteigenem Ermessen der Ignoranten und Dummköpfe,
u. s. f. u. s. f. — seht nur um euch! Sogar als äußerliches Symptom
der überhandnehmenden Roheit erblickt ihr den konstanten Begleiter derselben,
— den langen Bart, dieses Geschlechtsabzeichen, mitten im Gesicht, welches
besagt, daß man die Maskulinität, die man mit den Tieren gemein hat,
der Humanität vorzieht, indem man vor allem ein Mann, mas, und erst nächstdem
ein Mensch sein will. Das Abscheren der Bärte, in allen hochgebildeten
Zeitaltern und Ländern, ist aus dem richtigen Gefühl des Gegenteils
entstanden, vermöge dessen man vor allem ein Mensch, gewissermaßen ein
Mensch in abstracto, mit Hintansetzung des tierischen Geschlechtsunterschiedes,
sein möchte. Hingegen hat die Bartlänge stets mit der Barbarei, an die
schon ihr Name erinnert, gleichen Schritt gehalten. Daher florierten die
Bärte im Mittelalter, diesem Millennium der Roheit und Unwissenheit,
dessen Tracht und Bauart nachzuahmen unsre edelen Jetztzeitler bemüht
sind *). — Die fernere und sekundäre Folge des in Rede stehenden Verrates
an der Philosophie kann denn auch nicht ausbleiben: sie ist Verachtung
der Nation bei den Nachbarn, und des Zeitalters bei der Nachwelt. Denn
wie man’s treibt, so geht’s, und da wird nichts geschenkt. [...]
*) Der Bart, sagt man, sei dem Menschen natürlich: allerdings, und darum
ist er dem Menschen im Naturzustande ganz angemessen; ebenso aber dem
Menschen im zivilisierten Zustande die Rasur; indem sie anzeigt, daß
hier die tierische rohe Gewalt, deren jedem sogleich fühlbares Abzeichen
jener dem männlichen Geschlecht eigentümliche Auswuchs ist, dem Gesetz,
der Ordnung und Gesittung hat weichen müssen. —
Der Bart vergrößert den tierischen Teil des Gesichts und hebt ihn hervor:
dadurch gibt er ihm das so auffallend brutale Ansehn: man betrachte nur
so einen Bartmenschen im Profil, während er ißt! — Für eine Zierde
möchten sie den Bart ausgeben. Diese Zierde war man seit zweihundert
Jahren nur an Juden, Kosaken, Kapuzinern, Gefangenen und Straßenräubern
zu sehn gewohnt. — Die Ferocität und Atrocität, welche der Bart der
Physiognomie verleiht, beruht darauf, daß eine respektiv leblose Masse
die Hälfte des Gesichts einnimmt, und zwar die das Moralische ausdrückende
Hälfte. Zudem ist alles Behaartsein tierisch, die Rasur ist das Abzeichen
der höheren Zivilisation. Die Polizei ist überdies schon deshalb befugt,
die Bärte zu verbieten, weil sie halbe Masken sind, unter denen es schwer
ist, seinen Mann wieder zu erkennen; daher sie jeden Unfug begünstigen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wehe der Zeit, wo, in der Philosophie, Frechheit und Unsinn Einsicht
und Verstand verdrängt haben! Denn die Früchte nehmen den Geschmack
des Bodens an, auf welchem sie gewachsen sind. Was laut, öffentlich,
allseitig angepriesen wird, das wird gelesen, ist also die Geistesnahrung
des sich ausbildenden Geschlechts: diese aber hat auf dessen Säfte und
nachher auf dessen Erzeugnisse den entschiedensten Einfluß. Daher bestimmt
die Herrschende Philosophie einer Zeit ihren Geist. Herrscht nun also
die Philosophie des absoluten Unsinns, gelten aus der Luft gegriffene
und unter Tollhäuslergeschwätz vorgebrachte Absurdidäten für große
Gedanken, — nun da entsteht, nach solcher Aussaat, das saubere Geschlecht,
ohne Geist, ohne Wahrheitsliebe, ohne Redlichkeit, ohne Geschmack, ohne
Aufschwung zu irgend etwas Edlem, zu irgend etwas über die materiellen
Interessen, zu denen auch die politischen gehören, Hinausliegendem, —
wie wir es da vor uns sehn. Hieraus ist es zu erklären, wie auf das Zeitalter,
da Kant philosophierte, Goethe dichtete, Mozart komponierte, das jetzige
hat folgen können, das der politischen Dichter, der noch politischeren
Philosophen, der hungrigen, vom Lug und Trug der Litteratur ihr Leben
fristenden Litteraten und der die Sprache mutwillig verhunzenden Tintenkleckser
jeder Art. — Es nennt sich, mit einem seiner selbstgemachten Worte,
so charakteristisch, wie euphonisch, die „Jetztzeit“: jawohl Jetztzeit,
d. h. da man nur an das Jetzt denkt und keinen Blick auf die kommende
und richtende Zeit zu werfen wagt. Ich wünsche, ich könnte dieser „Jetztzeit“
in einem Zauberspiegel zeigen, wie sie in den Augen der Nachwelt sich
ausnehmen wird. Sie nennt inzwischen jene soeben belobte Vergangenheit
die „Zopfzeit“. Aber an jenen Zöpfen saßen Köpfe; jetzt hingegen
scheint mit dem Stengel auch die Frucht verschwunden zu sein. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ich kann hier nicht die beiläufige Bemerkung unterdrücken, daß
eine sehr nachteilige Vorschule zur Professur der Philosophie die Hauslehrerstellen
sind, welche beinahe alle, die jemals jene bekleideten, nach ihren Universitätsstudien,
mehrere Jahre hindurch versehn haben. Denn solche Stellen sind eine rechte
Schule der Unterwürfigkeit und Fügsamkeit. Besonders wird man darin
gewohnt, seine Lehren ganz und gar dem Willen des Brotherrn zu unterwerfen
und keine anderen als dessen Zwecke zu kennen. Diese, früh angenommene
Gewohnheit wurzelt ein und wird zur zweiten Natur; so daß man nachher,
als Philosophieprofessor, nichts natürlicher findet, als auch die Philosophie
ebenso den Wünschen des die Professuren besetzenden Ministeriums gemäß
zuzuschneiden und zu modeln; woraus denn am Ende philosophische Ansichten,
oder gar Systeme, wie auf Bestellung gemacht, hervorgehn. Da hat die Wahrheit
schönes Spiel! — Hier stellt sich freilich heraus, daß um dieser unbedingt
zu huldigen, um wirklich zu philosophieren, zu so vielen Bedingungen fast
unumgänglich auch noch diese kommt, daß man auf eigenen Beinen stehe
und keinen Herrn kenne, wonach denn das δος μοι που στω in
gewissem Sinne auch hier gelte. Wenigstens haben die allermeisten von
denen, die je etwas Großes in der Philosophie leisteten, sich in diesem
Falle befunden. Spinoza war sich der Sache so deutlich bewußt, daß er
die ihm angetragene Professur gerade deshalb ausschlug.
͑Ημισυ γαρ τ̓ αρετης αποαινυται ευρυοπα
Ζευς
Ανερος, ευτ͗ αν μιν κατα δουλιον ήμαρ έλμσιν.
Das wirkliche Philosophieren verlangt Unabhängigkeit:
Πας γαρ ανηρ πενιη δεδμημενος ουτε τι ειπειν
Ουϑ͗ ερξαι δυναται, γλωσσα δε οί δεδεται.
Theogn.
Auch in Sadis Gulistan wird gesagt, daß wer Nahrungssorgen hat, nichts
leisten kann. (S. Sadis Gulistan übers. von Graf, Leipzig 1846, S.185.)
Dafür jedoch ist der echte Philosoph, seiner Natur nach, ein genügsames
Wesen und bedarf nicht viel, um unabhängig zu leben: denn allemal wird
sein Wahlspruch Shenstones Satz sein: Liberty is a more invigorating cordial
than Tokay. (Freiheit ist eine kräftigere Herzstärkung, als Tokayer.)
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] So haben denn z. B. die Herren von der lukrativen Philosophie im
Menschen ein Gottesbewußtsein entdeckt, welches bis dahin aller Welt
entgangen war, und werfen damit, durch ihre wechselseitige Einstimmung
und die Unschuld ihres nächsten Publikums dreist gemacht, keck und kühn
um sich, wodurch sie am Ende gar die ehrlichen Holländer der Universität
Leiden verführt haben; so daß diese, die Winkelzüge der Philosophieprofessoren
richtig für Fortschritte der Wissenschaft ansehend, ganz treuherzig,
am 15. Februar 1844, die Preisfrage gestellt haben: Quid statuendum de
sensu Dei, qui dicitur, menti humanae indito, u. s. w. Vermöge eines
solchen „Gottesbewusstseins“ wäre denn das, was mühsam zu beweisen
alle Philosophen, bis auf Kant, sich abarbeiteten, etwas unmittelbar Bewußtes.
Welche Pinsel müßten aber dann alle jene früheren Philosophen gewesen
sein, die sich ihr Leben lang abgemüht haben, Beweise für eine Sache
aufzustellen, deren wir uns geradezu bewußt sind, welches besagt, daß
wir sie noch unmittelbarer erkennen, als daß zweimal zwei vier ist, als
wozu doch schon Ueberlegung gehört. Eine solche Sache beweisen zu wollen,
müßte ja sein, wie wenn man beweisen wollte, daß die Augen sehn, die
Ohren hören und die Nase rieche. Und welch unvernünftiges Vieh müßten
doch die Anhänger der, nach der Zahl ihrer Bekenner, vornehmsten Religion
auf Erden, die Buddhaisten, sein, deren Religionseifer so groß ist, daß
in Tibet beinahe der sechste Mensch dem geistlichen Stande angehört und
damit dem Cölibat verfallen ist, deren Glaubenslehre jedoch zwar eine
höchst lautete, erhabene, liebevolle, ja streng asketische Moral (die
nicht, wie die christliche, die Tiere vergessen hat) trägt und stützt,
allein nicht nur entschieden atheistisch ist, sondern sogar ausdrücklich
den Theismus perhorresziert. Die Persönlichkeit ist nämlich ein Phänomen,
das uns nur aus unserer animalischen Natur bekannt und daher, von dieser
gesondert, nicht mehr deutlich denkbar ist: ein solches nun zum Ursprung
und Prinzip der Welt zu machen, ist immer ein Satz, der nicht sogleich
jedem in den Kopf will; geschweige daß er schon von Hause aus darin wurzelte
und lebte. Ein unpersönlicher Gott hingegen ist eine bloße Philosophieprofessorenflause,
eine Contradictio in adjecto, ein leeres Wort, die Gedankenlosen abzufinden,
oder die Vigilanten zu beschwichtigen. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Unter der Benennung und Firma der Philosophie und in fremdartigem
Gewande die Grunddogmen der Landesreligion, welche man alsdann, mit einem
Hegels würdigen Ausdruck, „die absolute Religion“ tituliert, vortragen,
mag eine recht nützliche Sache sein; sofern es dient, die Studenten den
Zwecken des Staates besser anzupassen, imgleichen auch das lesende Publikum
im Glauben zu befestigen: aber dergleichen für Philosophie ausgeben heißt
denn doch eine Sache für das verkaufen, was sie nicht ist. Wenn dies
und alles Obige seinen ungestörten Fortgang behält, muß mehr und mehr
die Universitätsphilosophie zu einer remora der Wahrheit werden. Denn
es ist um alle Philosophie geschehn, wenn zum Maßstab ihrer Beurteilung,
oder gar zur Richtschnur ihrer Sätze, etwas anderes genommen wird, als
ganz allein die Wahrheit, die, selbst bei aller Redlichkeit des Forschens
und aller Anstrengung der überlegensten Geisteskraft, so schwer zu erreichende
Wahrheit: es führt dahin, daß sie zu einer bloßen fable convenue wird,
wie Fontenelle die Geschichte nennt. Nie wird man in der Lösung der Probleme,
welche unser so unendlich rätselhaftes Dasein uns von allen Seiten entgegenhält,
auch nur einen Schritt weiter kommen, wenn man nach einem vorgesteckten
Ziele philosophiert. Daß aber dies der generische Charakter der verschiedenen
Spezies jetziger Universitätsphilosophie sei, wird wohl niemand leugnen:
denn nur zu sichtbar kollimieren alle ihre Systeme und Sätze nach einem
Zielpunkt. Dieser ist zudem nicht einmal das eigentliche, das neutestamentliche
Christentum, oder der Geist desselben, als welcher ihnen zu hoch, zu ätherisch,
zu excentrisch, zu sehr nicht von dieser Welt, daher zu pessimistisch
und hiedurch zur Apotheose des „Staats“ ganz ungeeignet ist; sondern
es ist bloß das Judentum, die Lehre, daß die Welt ihr Dasein von einem
höchst vortrefflichen, persönlichen Wesen habe, daher auch ein allerliebstes
Ding παντα καλα λιαν sei. Dies ist ihnen aller Weisheit Kern,
und dahin soll die Philosophie führen, oder, sträubt sie sich, geführt
werden. Daher denn auch der Krieg, den, seit dem Sturz der Hegelei, alle
Professoren gegen den sogenannten Pantheismus führen, in dessen Perhorreszierung
sie wetteifern, einmütig den Stab über ihn brechend. Ist etwan dieser
Eifer aus der Entdeckung triftiger und schlagender Gründe gegen denselben
entsprungen? Oder sieht man nicht vielmehr, mit welcher Ratlosigkeit und
Angst sie nach Gründen gegen jenen in ursprünglicher Kraft ruhig dastehenden
und sie belächelnden Gegner suchen? kann man daher noch bezweifeln, daß
bloß die Inkompatibilität jener Lehre mit der „absoluten Religion“
es ist, warum sie nicht wahr sein soll, nicht soll, und wenn die ganze
Natur sie mit tausend und aber tausend Kehlen verkündigte. Die Natur
soll schweigen, damit das Judentum spreche. Wenn nun ferner, neben der
„absoluten Religion“, noch irgend etwas bei ihnen Berücksichtigung
findet; so versteht es sich, das es die sonstigen Wünsche eines hohen
Ministeriums, bei dem die Macht Professuren zu geben und zu nehmen ist,
sein werden. Ist doch dasselbe die Muse, welche sie begeistert und ihren
Lukubrationen vorsteht, daher wohl auch am Eingange, in Form einer Dedikation,
ordentlich angerufen wird. Das sind mir die Leute, die Wahrheit aus dem
Brunnen zu ziehn, den Schleier des Truges zu zerreißen und aller Verfinsterung
Hohn zu sprechen.
Zu keinem Lehrfache wären, der Natur der Sache nach, so entschieden Leute
von überwiegenden Fähigkeiten und durchdrungen von Liebe zur Wissenschaft
und Eifer für die Wahrheit erfordert, als da, wo die Resultate der höchsten
Anstrengungen des menschlichen Geistes, in der wichtigsten aller Angelegenheiten,
der Blüte einer neuen Generation, im lebendigen Worte, übergeben, ja,
der Geist der Forschung in ihr erweckt werden soll. Andrerseits aber wieder
halten die Ministerien dafür, daß kein Lehrfach auf die innerste Gesinnung
der künftigen gelehrten, also den Staat und die Gesellschaft eigentlich
lenkenden Klasse so viel Einfluß habe, wie gerade dieses; daher es nur
mit den allerdevotesten, ihre Lehre gänzlich nach dem Willen und jedesmaligen
Ansichten des Ministeriums zuschneidenden Männern besetzt werden darf.
Natürlich ist es dann die erstere dieser beiden Anforderungen, welche
zurückstehn muß. Wer nun aber mit diesem Stande der Dinge nicht bekannt
ist, dem kann es zuzeiten vorkommen, als ob seltsamerweise gerade die
entschiedensten Schafsköpfe sich der Wissenschaft des Plato und Aristoteles
gewidmet hätten. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Auf Schelling folgte jetzt schon eine philosophische Ministerkreatur,
der, in politischer, obendrein mit einem Fehlgriff bedienter Absicht,
von oben herunter zum großen Philosophen gestempelte Hegel, ein platter,
geistloser, ekelhaft-widerlicher, unwissender Charlatan, der, mit beispielloser
Frechheit, Aberwitz und Unsinn zusammenschmierte, welche von seinen feilen
Anhängern als unsterbliche Weisheit ausposaunt und von Dummköpfen richtig
dafür genommen wurde, wodurch ein so vollständiger Chorus der Bewunderung
entstand, wie man ihn nie zuvor vernommen hatte *). Die einem solchen
Menschen gewaltsam verschaffte, ausgebreitete geistige Wirksamkeit hat
den intellektuellen Verderb einer ganzen gelehrten Generation zur Folge
gehabt. Der Bewunderer jener Afterphilosophie wartet der Hohn der Nachwelt,
dem jetzt schon der Spott der Nachbarn, lieblich zu hören, präludiert;
— oder sollte es meinen Ohren nicht wohlklingen, wenn die Nation, deren
gelehrte Kaste meine Leistungen, dreißig Jahre hindurch, für nichts,
für keines Blickes würdig geachtet hat, — von den Nachbarn den Ruhm
erhält, das ganze Schlechte, das Absurde, das Unsinnige und dabei materiellen
Absichten Dienende, als höchste und unerhörte Weisheit dreißig Jahre
lang verehrt, ja vergöttert zu haben? Ich soll wohl auch, als ein guter
Patriot, mich im Lobe der Deutschen und des Deutschtums ergehn, und mich
freuen, dieser und keiner andern Nation angehört zu haben? Allein es
ist, wie das spanische Sprichwort sagt: Cada uno cuenta de la feria, como
le va en alla. (Jeder berichtet von der Messe, je nachdem es ihm darauf
ergangen.) Geht zu den Demokolaken und laßt euch loben. Tüchtige, plumpe,
von Ministern aufgepuffte, brav Unsinn schmierende Charlatane, ohne Geist
und ohne Verdienst, das ist’s was den Deutschen gehört; nicht Männer
wie ich. — Dies ist das Zeugnis, welches ich ihnen, beim Abschiede,
zu geben habe. Wieland (Briefe an Merck S. 239) nennt es ein Unglück,
ein Deutscher geboren zu sein: Bürgert, Mozart, Beethoven u. a. m. würden
ihm beigestimmt haben: ich auch. Es beruht darauf, daß σοφον ειναι
δει τον επιγνωσομενον τον σοφον, oder il n`y
a que l’esprit qui sente l’esprit **). [...]
*) Man sehe die Vorrede zu meinen „Grundproblemen der Ethik“.
**) Heutzutage hat das Studium der Kantischen Philosophie noch den besonderen
Nutzen zu lehren, wie tief seit der Kritik der reinen Vernunft die philosophische
Litteratur in Deutschland gesunken ist: so sehr stechen seine tiefen Untersuchungen
ab gegen das heutige rohe Geschwätz, bei welchem man von der einen Seite
hoffnungsvolle Kandidaten und auf der andern Barbiergesellen zu vernehmen
glaubt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Inzwischen verlangt die Billigkeit, daß man die Universitätsphilosophie
nicht bloß, wie hier geschehn, aus dem Standpunkte des angeblichen, sondern
auch aus dem des wahren und eigentlichen Zweckes derselben beurteile.
Dieser nämlich läuft darauf hinaus, daß die künftigen Referendarien,
Advokaten, Aerzte, Kandidaten und Schulmänner auch im Innersten ihrer
Ueberzeugungen diejenige Richtung erhalten, welche den Absichten, die
der Staat und seine Regierung mit ihnen haben, angemessen ist. Dagegen
habe ich nichts einzuwenden, bescheide mich also in dieser Hinsicht. Denn
über die Notwendigkeit, oder Entbehrlichkeit eines solchen Staatsmittels
zu urteilen, halte ich mich nicht für kompetent; sondern stelle es denen
anheim, welche die schwere Aufgabe haben, Menschen zu regieren, d. h.
unter vielen Millionen eines, der großen Mehrzahl nach, grenzenlos egoistischen,
ungerechten, unbilligen, unredlichen, neidischen, boshaften und dabei
sehr beschränkten und querköpfigen Geschlechtes, Gesetz, Ordnung, Ruhe
und Friede aufrecht zu erhalten und die wenigen, denen irgend ein Besitz
zu teil geworden, zu schützen gegen die Unzahl derer, welche nichts,
als ihre Körperkräfte haben. Die Aufgabe ist so schwer, daß ich mich
wahrlich nicht vermesse, über die dabei anzuwendenden Mittel mit ihnen
zu rechten. Denn „ich danke Gott an jedem Morgen, daß ich nicht brauch’
fürs Römsche Reich zu sorgen,“ — ist stets mein Wahlspruch gewesen.
Diese Staatszwecke der Universitätsphilosophie waren es aber, welche
der Hegelei eine so beispiellose Ministergunst verschafften. Denn ihr
war der Staat „der absolut vollendete ethische Organismus“, und sie
ließ den ganzen Zweck des menschlichen Daseins im Staat aufgehn. Konnte
es eine bessere Zurichtung für künftige Referendarien und demnächst
Staatsbeamte geben, als diese, infolge welcher ihr ganzes Wesen und Sein,
mit Leib und Seele, völlig dem Staat verfiel, wie das der Biene dem Bienenstock,
und sie auf nichts anderes, weder in dieser, noch in einer andern Welt
hinzuarbeiten hatten, als daß sie taugliche Räder würden, mitzuwirken,
um die große Staatsmaschine, ultimus finis bonorum, im Gange zu erhalten?
Der Referendar und der Mensch war danach eins und dasselbe. Es war eine
rechte Apotheose der Philisterei. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Die Kabbalistische und die Gnostische Philosophie, bei deren Urhebern,
als Juden und Christen, der Monotheismus vorweg feststand, sind Versuche,
den schreienden Widerspruch zwischen der Hervorbringung der Welt durch
ein allmächtiges, allgütiges und allweises Wesen, und der traurigen,
mangelhaften Beschaffenheit eben dieser Welt aufzuheben. Sie führen daher,
zwischen die Welt und jene Weltursache, eine Reihe Mittelwesen ein, durch
deren Schuld ein Abfall und durch diesen erst die Welt entstanden sei.
Sie wälzen also gleichsam die Schuld vom Souverän auf die Minister.
Angedeutet war dies Verfahren freilich schon durch den Mythos vom Sündenfall,
der überhaupt der Glanzpunkt des Judentums ist. Jene Wesen nun also sind,
bei den Gnostikern, das πληρωμα, die Aeonen, die ύλη, der Demiurgos
u. s. w. Die Reihe wurde von jedem Gnostiker beliebig verlängert.
Das ganze Verfahren ist dem analog, daß, um den Widerspruch, den die
angenommene Verbindung und wechselseitige Einwirkung einer materiellen
und immateriellen Substanz im Menschen mit sich führt, zu mildern, physiologische
Philosophen Mittelwesen einzuschieben suchten, wie Nervenflüssigkeit,
Nervenäther, Lebensgeister u. dgl. Beides verdeckt, was es nicht aufzuheben
vermag.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die Musik ist, in diesem Sinn, eine zweite Wirklichkeit, welche
der ersten völlig parallel geht, übrigens aber ganz anderer Art und
Beschaffenheit ist; also vollkommene Analogie, jedoch gar keine Aehnlichkeit
mit ihr hat. Nun aber ist die Musik, als solche, nur in unserm Gehörnerven
und Gehirn vorhanden: außerhalb oder an sich (im Lockischen Sinne verstanden),
besteht sie aus lauter Zahlenverhältnissen: nämlich zunächst, ihrer
Quantität nach, hinsichtlich des Takts: und dann, ihrer Qualität nach,
hinsichtlich der Stufen der Tonleiter, als welche auf den arithmetischen
Verhältnissen der Vibrationen beruhen; oder, mit anderen Worten, wie
in ihrem rhythmischen, so auch in ihrem harmonischen Element. Hienach
also ist das ganze Wesen der Welt, sowohl als Mikrokosmos, wie als Makrokosmos,
allerdings durch bloße Zahlenverhältnisse auszudrücken, mithin gewissermaßen
auf sie zurückzuführen: in diesem Sinne hätte dann Pythagoras recht,
das eigentliche Wesen der Dinge in die Zahlen zu setzen. — Was sind
nun aber Zahlen? — Successionsverhältnisse, deren Möglichkeit auf
der Zeit beruht.
Wenn man liest, was über die Zahlenphilosophie der Pythagoreer in den
Scholien zum Aristoteles (p. 829 ed. Berol.) gesagt wird; so kann man
auf die Vermutung geraten, daß der so seltsame und geheimnisvolle, an
das Absurde streifende Gebrauch des Wortes λογος im Eingang des dem
Johannes zugeschriebenen Evangeliums, wie auch die früheren Analoga desselben
beim Philo, von der Pythagorischen Zahlenphilosophie abstammen, nämlich
von der Bedeutung des Wortes λογος im arithmetischen Sinn, als Zahlenverhältnis,
ratio numerica; da ein solches Verhältnis nach den Pythagoreern, die
innerste und unzerstörbare Essenz jedes Wesen ausmacht, also dessen erstes
und ursprüngliches Prinzipium, αρϑη, ist; wonach denn von jedem Dinge
gälte εν αρχη ην ό λογος. Man berücksichtigte dabei, daß
Aristoteles (De anima I, 1) sagt: τα παϑη λογοι ενυλοι
εισι, et mox: ό μεν γαρ λογος ειδος του πραγματος.
Auch wird man dadurch an den λογος οπερματικος der Stoiker
erinnert, auf welchen ich bald zurückkommen werde. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
In den Rechenbüchern pflegt die Richtigkeit der Lösung eines Exempels
sich durch das Aufgehen desselben, d. h. dadurch, daß kein Rest bleibt,
kundzugeben. Mit der Lösung des Rätsels der Welt hat es ein ähnliches
Bewandtnis. Sämtliche Systeme und Rechnungen, die nicht aufgehn: sie
lassen einen Rest, oder auch, wenn man ein chemisches Gleichnis vorzieht,
einen unauflöslichen Niederschlag. Dieser besteht darin, daß, wenn man
aus ihren Sätzen folgerecht weiter schließt, die Ergebnisse nicht zu
der vorliegenden realen Welt passen, nicht mit ihr stimmen, vielmehr manche
Seiten derselben dabei ganz unerklärlich bleiben. So z. B. stimmt zu
den materialistischen Systemen, welche aus der mit bloß mechanischen
Eigenschaften ausgestatteten Materie, und gemäß den Gesetzen derselben,
die Welt entstehn lassen, nicht die durchgängige bewunderungswürdige
Zweckmäßigkeit der Natur, noch das Dasein der Erkenntnis, in welcher
doch sogar jene Materie allererst sich darstellt. Dies also ist ihr Rest.
— Mit den theistischen Systemen wiederum, nicht minder jedoch mit den
pantheistischen, sind die überwiegenden physischen Uebel und die moralische
Verderbnis der Welt nicht in Uebereinstimmung zu bringen: diese also bleiben
als Rest stehen, oder als unauflöslicher Niederschlag liegen. — Zwar
ermangelt man in solchen Fällen nicht, dergleichen Reste mit Sophismen,
nötigenfalls auch mit bloßen Worten und Phrasen zuzudecken: allein auf
die Länge hält das nicht Stich. Da wird dann wohl, weil doch das Exempel
nicht aufgeht, nach einzelnen Rechnungsfehlern gesucht, bis man endlich
sich gestehn muß, der Ansatz selbst sei falsch gewesen. Wenn hingegen
die durchgängige Konsequenz und Zusammenstimmung aller Sätze eines Systems
bei jedem Schritte begleitet ist von einer ebenso durchgängigen Uebereinstimmung
mit der Erfahrungswelt, ohne daß zwischen beiden ein Mißklang je hörbar
würde; — so ist dies das Kriterium der Wahrheit desselben, das verlangte
Aufgehn des Rechnungsexempels. Imgleichen, daß schon der Ansatz falsch
gewesen sei, will sagen, daß man die Sache schon anfangs nicht am rechten
Ende angegriffen hatte, wodurch man nachher von Irrtum zu Irrtum geführt
wurde. Denn es ist mit der Philosophie wie mit gar vielen Dingen: alles
kommt darauf an, daß man sie am rechten Ende angreife. Das zu erklärende
Phänomen der Welt bietet nun aber unzählige Enden dar, von denen nur
eines das rechte sein kann: es gleicht einem verschlungenen Fadengewirre,
mit vielen daran hängenden, falschen Endfäden: nur wer den wirklichen
herausfindet, kann das Ganze entwirren. Dann aber entwickelt sich leicht
eines aus dem andern, und daran wird kenntlich, daß es das rechte Ende
gewesen sei. Auch einem Labyrinth kann man es vergleichen, welches hundert
Eingänge darbietet, die in Korridore öffnen, welche alle, nach langen
und vielfach verschlungenen Windungen, am Ende wieder hinausführen; mit
Ausnahme eines einzigen, dessen Windungen wirklich zum Mittelpunkte leiten,
woselbst das Idol steht. Hat man diesen Eingang getroffen, so wird man
den Weg nicht verfehlen: durch keinen andern aber kann man je zum Ziele
gelangen. — Ich verhehle nicht, der Meinung zu sein, daß nur der Wille
in uns das rechte Ende des Fadengewirres, der wahre Eingang des Labyrinthes,
sei. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Jedoch sollen hier keineswegs, als über ein inauditum nefas, die
Götter angerufen werden: ist doch dies alles nur eine Scene des Schauspiels,
welches wir zu allen Zeiten, in allen Künsten und Wissenschaften, vor
Augen haben, nämlich den alten Kampf derer, die für die Sache leben,
mit denen, die von ihr leben, oder derer, die es sind, mit denen, die
es vorstellen. Den einen ist sie der Zweck, zu welchem ihr das Leben das
bloße Mittel ist; den andern das Mittel, ja die lästige Bedingung zum
Leben, zum Wohlsein, zum Genuß, zum Familienglück, als in welchen allein
ihr wahrer Ernst liegt; weil hier die Grenze ihrer Wirkungssphäre von
der Natur gezogen ist. Wer dies exemplifiziert sehen und näher kennen
lernen will, studiere Litterargeschichte und lese die Biographien großer
Meister in jeder Art und Kunst. Da wird er sehn, daß es zu allen Zeiten
so gewesen ist, und begreifen, daß es auch so bleiben wird. In der Vergangenheit
erkennt es jeder; fast keiner in der Gegenwart. Die glänzenden Blätter
der Litterargeschichte sind, beinahe durchgängig, zugleich die tragischen.
In allen Fächern bringen sie uns vor Augen, wie, in der Regel, das Verdienst
hat warten müssen, bis die Narren ausgenarrt hatten, das Gelag zu Ende
und alles zu Bette gegangen war: dann erhob es sich, wie ein Gespenst
aus tiefer Nacht, um seinen, ihm vorenthaltenen Ehrenplatz doch endlich
noch als Schatten einzunehmen.
Wir inzwischen haben es hier allein mit der Philosophie und ihren Vertretern
zu thun. Da finden wir nun zunächst, daß von jeher sehr wenige Philosophen
Professoren der Philosophie gewesen sind, und verhältnismäßig noch
wenigere Professoren der Philosophie Philosophen; daher man sagen könnte,
daß, wie die idioelektrischen Körper keine Leiter der Elektrizität
sind, so die Philosophen keine Professoren der Philosophie. In der That
steht dem Selbstdenker diese Bestellung beinahe mehr im Wege, als jede
andere. Denn das philosophische Katheder ist gewissermaßen ein öffentlicher
Beichtstuhl, wo man coram populo sein Glaubensbekenntnis ablegt. Sodann
ist der wirklichen Erlangung gründlicher, oder gar tiefer Einsichten,
also dem wahren Weisewerden, fast nichts so hinderlich, wie der beständige
Zwang, weise zu scheinen, das Auskramen vorgeblicher Erkenntnisse, vor
den lernbegierigen Schülern, und das Antworten-bereit-haben auf alle
ersinnlichen Fragen. Das schlimmste aber ist, daß einen Mann in solcher
Lage, bei jedem Gedanken, der etwan noch in ihm aufsteigt, schon die Sorge
beschleicht, wie solcher zu den Absichten hoher Vorgesetzter passen würde:
dies paralysiert sein Denken so sehr, daß schon die Gedanken selbst nicht
mehr aufzusteigen wagen. Der Wahrheit ist die Atmosphäre der Freiheit
unentbehrlich. Ueber die Exceptio, quae firmat regulam, daß Kant ein
Professor gewesen, habe ich schon oben das Nötige erwähnt, und füge
nur hinzu, daß auch Kants Philosophie eine großartigere, entschiedenere,
reinere und schönere geworden sein würde, wenn er nicht jene Professur
bekleidet hätte; obwohl er, sehr weise, den Philosophen möglichst vom
Professor gesondert hielt, indem er seine eigene Lehre nicht auf dem Katheder
vortrug. (Siehe Rosenkranz, Geschichte der Kantischen Philosophie, S.
148.) [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ich erlaube mir hiezu die Bemerkung, daß die Menschen unbeschnitten,
folglich nicht als Juden auf die Welt kommen. — Aber sogar auch die
Annahme irgend einer von der Welt verschiedenen Ursache derselben ist
noch kein Theismus. Dieser verlangt nicht nur eine von der Welt verschiedene,
sondern eine intelligente, d. h. erkennende und wollende, also persönliche,
mithin auch individuelle Weltursache: eine solche ist es ganz allein,
die das Wort Gott bezeichnet. Ein unpersönlicher Gott ist gar kein Gott,
sondern bloß ein mißbrauchtes Wort, ein Unbegriff, eine Contradictio
in adjecto, ein Schibboleth für Philosophieprofessoren, welche, nachdem
sie die Sache haben aufgeben müssen, mit dem Worte durchzuschleichen
bemüht sind. Andrerseits nun aber ist die Persönlichkeit, d. h. die
selbstbewußte Individualität, welche erst erkennt und dann dem Erkannten
gemäß will, ein Phänomen, welches uns ganz allein aus der, auf unserm
kleinen Planeten vorhandenen, animalischen Natur bekannt und mit dieser
so innig verknüpft ist, daß es von ihr getrennt und unabhängig zu denken,
wir nicht nur nicht befugt, sondern auch nicht einmal fähig sind. Ein
Wesen solcher Art nun aber als den Ursprung der Natur selbst, ja, alles
Daseins überhaupt anzunehmen, ist ein kolossaler und überaus kühner
Gedanke, über den wir erstaunen würden, wenn wir ihn zum erstenmale
vernähmen und er nicht, durch die frühzeitigste Einprägung und beständige
Wiederholung, uns geläufig, ja, zur zweiten Natur, fast möchte ich sagen,
zur fixen Idee geworden wäre. Daher sei es beiläufig erwähnt, daß
nichts mir die Echtheit des Kaspar Hauser so sehr beglaubigt hat, als
die Angabe, daß die ihm vorgetragene, sogenannte natürliche Theologie
ihm nicht sonderlich hat einleuchten wollen, wie man es doch erwartet
hatte; wozu noch kommt, daß er (nach dem „Briefe des Grafen Stanhope
an den Schullehrer Meyer“) eine sonderbare Ehrfurcht vor der Sonne bezeigte.
— Nun aber in der Philosophie zu lehren, jener theologische Grundgedanke
verstände sich von selbst und die Vernunft wäre eben nur die Fähigkeit,
denselben unmittelbar zu fassen und als wahr zu erkennen, ist ein unverschämtes
Vorgeben. Nicht nur darf in der Philosophie ein solcher Gedanke nicht
ohne den vollgültigsten Beweis angenommen werden, sondern sogar der Religion
ist er durchaus nicht wesentlich: Dies bezeugt die auf Erden am zahlreichsten
vertretene Religion, der uralte, jetzt 370 Millionen Anhänger zählende,
höchst moralische, ja asketische, sogar auch den zahlreichsten Klerus
ernährende Buddhaismus, indem er einen solchen Gedanken nicht zuläßt,
vielmehr ihn ausdrücklich perhorresziert, und recht ex professo, nach
unserm Ausdruck, atheistisch ist *). [...]
*) „Der Zaradobura, Ober-Rahan (Oberpriester) der Buddhaisten in Ava
zählt in einem Aufsatz über seine Religion, den er einem katholischen
Bischofe gab, zu den sechs verdammlichen Ketzereien auch die Lehre, daß
ein Wesen dasei, welches die Welt und alle Dinge in der Welt geschaffen
habe, und das allein würdig sei angebetet zu werden;“ Francis Buchanan,
On the religion of the Burmas, in the Asiatic Researches, Vol. 6, p. 268.
Auch verdient hier angeführt zu werden, was in derselben Sammlung, Bd.
15, S. 148, erwähnt wird, daß nämlich die Buddhaisten vor keinem Götterbilde
ihr Haupt beugen, als Grund angebend, daß das Urwesen die ganze Natur
durchdringe, folglich auch in ihren Köpfen sei. Desgleichen, daß der
grundgelehrte Orientalist und Petersburger Akademiker J. J. Schmidt, in
seinen „Forschungen im Gebiete der älteren Bildungsgeschichte Mittelasiens“,
Petersburg 1824, S. 180 sagt: „Das System des Buddhaismus kennt „kein
ewiges, unerschaffenes, einiges göttliches Wesen, das vor allen Zeiten
war und alles Sichtbare und Unsichtbare erschaffen hat. Diese Idee ist
ihm ganz fremd, und man findet in den buddhaistischen Büchern nicht die
geringste Spur davon. Ebensowenig gibt es eine Schöpfung“ u. s. w.
— Wo bleibt nun da das „Gottesbewußtsein“ der von Kant und der
Wahrheit bedrängten Philosophieprofessoren? Wie ist dasselbe auch nur
damit zu vereinigen, daß die Sprache der Chinesen, welche doch ungefähr
zwei Fünftel des ganzen Menschengeschlechts ausmachen, für Gott und
Schaffen gar keine Ausdrücke hat? daher schon der erste Vers des Pentateuchs
sich in dieselbe nicht übersetzen läßt, zur großen Perplexität der
Missionarien, welcher Sir George Staunton durch ein eigenes Buch hat zur
Hilfe kommen wollen; es heißt: An inquiry into the proper mode of rendering
the word God in translating the sacred Scriptures into the Chinese language,
Lond. 1848. (Untersuchung über die passende Art, beim Uebersetzen der
heiligen Schrift ins Chinesische, das Wort Gott auszudrücken.)
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Oben habe ich von dem mächtigen Einfluß der Geistesnahrung auf
das Zeitalter geredet. Dieser nun beruht darauf, daß sie sowohl den Stoff
wie die Form des Denkens bestimmt. Daher kommt gar viel darauf an, was
gelobt und demnach gelesen wird. Denn das Denken mit einem wahrhaft großen
Geiste stärkt den eigenen, erteilt ihm eine regelrechte Bewegung, versetzt
ihn in den richtigen Schwung: es wirkt analog der Hand des Schreibmeisters,
welche die des Kindes führt. Hingegen das Denken mit Leuten, die es eigentlich
auf bloßen Schein, mithin auf Täuschung des Lesers abgesehn haben, wie
Fichte, Schelling und Hegel, verdirbt den Kopf in eben dem Maße; nicht
weniger das Denken mit Querköpfen, oder mit solchen, die sich ihren Verstand
verkehrt angezogen haben, von denen Herbart ein Beispiel ist. Ueberhaupt
ist das Lesen der Schriften selbst auch nur gewöhnlicher Köpfe, in Fächern,
wo es sich nicht um Thatsachen, oder deren Ermittelung, handelt, sondern
bloß eigene Gedanken den Stoff ausmachen, eine heillose Verschwendung
der eigenen Zeit und Kraft. Denn was dergleichen Leute denken, kann jeder
andere auch denken: daß sie sich zum Denken förmlich zurechtgesetzt
und es darauf angelegt haben, bessert die Sache durchaus nicht; da es
ihre Kräfte nicht erhöht und man meistens dann am wenigsten denkt, wenn
man förmlich sich dazu zurecht gesetzt hat. Dazu kommt noch, daß ihr
Intellekt seiner natürlichen Bestimmung, im Dienste des Willens zu arbeiten,
getreu bleibt; wie dies eben normal ist. Darum aber liegt ihrem Treiben
und Denken stets eine Absicht zum Grunde: sie haben allezeit Zwecke und
erkennen nur in Bezug auf diese, mithin nur das, was diesen entspricht.
Die willensfreie Aktivität des Intellekts, welche die Bedingung der reinen
Objektivität und dadurch aller großer Leistungen ist, bleibt ihnen ewig
fremd, ist ihrem Herzen eine Fabel. Für sie haben nur Zwecke Interesse,
nur Zwecke Realität: denn in ihnen bleibt das Wollen vorwaltend. Daher
ist es doppelt thöricht, an ihren Produktionen seine Zeit zu verschwenden.
Allein was das Publikum nie erkennt und begreift, weil es gute Gründe
hat, es nicht erkennen zu wollen, ist die Aristokratie der Natur. Daher
legt es sobald die Seltenen und Wenigen, welchen, im Laufe der Jahrhunderte,
die Natur den hohen Beruf des Nachdenkens über sie, oder auch der Darstellung
des Geistes ihrer Werke, erteilt hatte, aus den Händen, um sich mit den
Produktionen des neuesten Stümpers bekannt zu machen. Ist einmal ein
Heros dagewesen; so stellt es bald einen Schächer daneben, — als ungefähr
auch so einen. Hat einmal die Natur in günstigster Laune das seltenste
ihrer Erzeugnisse, einen wirklich über das gewöhnliche Maß hinaus begabten
Geist, aus ihren Händen hervorgehn lassen, hat das Schicksal, in milder
Stimmung, seine Ausbildung gestattet, ja, haben seine Werke endlich „den
Widerstand der stumpfen Welt besiegt“ und sind als Muster anerkannt
und anempfohlen, — da dauert es nicht lange, so kommen die Leute mit
einem Erdenkloß ihres Gelichters herangeschleppt, um ihn daneben auf
den Altar zu stellen; eben weil sie nicht begreifen, nicht ahnden, wie
aristokratisch die Natur ist: sie ist es so sehr, daß auf 300 Millionen
ihrer Fabrikware noch nicht ein wahrhaft großer Geist kommt; daher man
alsdann diesen gründlich kennen lernen, seine Werke als eine Art Offenbarung
betrachten, sie unermüdlich lesen und diurna nocturnaque manu abnutzen,
dagegen aber sämtliche Alltagsköpfe liegen lassen soll, als das, was
sie sind, nämlich als etwas so Gemeines und Alltägliches, wie die Fliegen
an der Wand. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Da wir nun, aus den Resultaten meiner Philosophie des Ernstes (im
Gegensatz bloßer Professoren- oder Spaßphilosophie), das Abwenden des
Willens vom Leben als das letzte Ziel des zeitlichen Daseins erkannt haben;
so müssen wir annehmen, daß dahin ein jeder, auf die ihm ganz individuell
angemessene Art, also auch oft auf weiten Umwegen allmählich geleitet
werde. Da nun ferner Glück und Genuß diesem Zwecke eigentlich entgegenarbeiten;
so sehn wir, diesem entsprechend, jedem Lebenslauf Unglück und Leiden
unausbleiblich eingewebt, wiewohl in sehr ungleichem Maße und nur selten
im überfüllten, nämlich in den tragischen Ausgängen; wo es dann aussieht,
als ob der Wille gewissermaßen mit Gewalt zur Abwendung vom Leben getrieben
werden und gleichsam durch den Kaiserschnitt zur Wiedergeburt gelangen
sollte.
So geleitet dann jene unsichtbare und nur in zweifelhaftem Scheine sich
kundgebende Lenkung uns bis zum Tode, diesem eigentlichen Resultat und
insofern Zweck des Lebens. In der Stunde desselben drängen alle die geheimnisvollen
(wenngleich eigentlich in uns selbst wurzelnden) Mächte, die das ewige
Schicksal des Menschen bestimmen, sich zusammen und treten in Aktion.
Aus ihrem Konflikt ergibt sich der Weg, den er jetzt zu wandern hat, bereitet
nämlich seine Palingenesie sich vor, nebst allem Wohl und Wehe, welches
in ihr begriffen und von dem an unwiderruflich bestimmt ist. — Hierauf
beruht der hochernste, wichtige, feierliche und furchtbare Charakter der
Todesstunde. Sie ist eine Krisis, im stärksten Sinne des Worts, — ein
Weltgericht.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ueberhaupt aber, wie sollte der, welcher für sich, nebst Weib und
Kind, ein redliches Auskommen sucht, zugleich sich der Wahrheit weihen?
der Wahrheit, die zu allen Zeiten ein gefährlicher Begleiter, ein überall
unwillkommener Gast gewesen ist, — die vermutlich auch deshalb nackt
dargestellt wird, weil sie nichts mitbringt, nichts auszuteilen hat, sondern
nur ihrer selbst wegen gesucht sein will. Zwei so verschiedenen Herren,
wie der Welt und der Wahrheit, die nichts, als den Anfangsbuchstaben,
gemein haben, läßt sich zugleich nicht dienen: das Unternehmen führt
zur Heuchelei, zur Augendienerei, zur Achselträgerei. Da kann es geschehn,
daß aus einem Priester der Wahrheit, ein Verfechter des Truges wird,
der eifrig lehrt was er selbst nicht glaubt, dabei der vertrauensvollen
Jugend die Zeit und den Kopf verdirbt, auch wohl gar, mit Verleugnung
alles litterarischen Gewissens zum Präkonen einflußreicher Pfuscher,
z. B. frömmelnder Strohköpfe, sich hergibt; oder auch, daß er, weil
vom Staat und zu Staatszwecken besoldet, nun den Staat zu apotheosieren,
ihn zum Gipfelpunkt alles menschlichen Strebens und aller Dinge zu machen
sich angelegen sein läßt, und dadurch nicht nur den philosophischen
Hörsaal in eine Schule der plattesten Philisterei umschafft, sondern
am Ende, wie z. B. Hegel, zu der empörenden Lehre gelangt, daß die Bestimmung
des Menschen im Staat aufgehe, — etwan wie die der Biene im Bienenstock;
wodurch das hohe Ziel unsers Daseins den Augen ganz entrückt wird. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wenn wir nun, um die dargelegte Ansicht uns einigermaßen faßlich
zu machen, die anerkannte Aehnlichkeit des individuellen Lebens mit dem
Traume zu Hilfe genommen haben; so ist andrerseits auf den Unterschied
aufmerksam zu machen, daß im bloßen Traume das Verhältnis einseitig
ist, nämlich nur ein Ich wirklich will und empfindet, während die übrigen
nichts, als Phantome sind; im großen Traume des Lebens hingegen ein wechselseitiges
Verhältnis stattfindet, indem nicht nur der eine im Traume des andern,
gerade so wie es daselbst nötig ist, figuriert, sondern auch dieser wieder
in dem seinigen; so daß, vermöge einer wirklichen Harmonia praestabilita,
jeder doch nur das träumt, was ihm, seiner eigenen metaphysischen Lenkung
gemäß, angemessen ist, und alle Lebensträume so künstlich ineinander
geflochten sind, daß jeder erfährt, was ihm gedeihlich ist und zugleich
leistet, was andern nötig; wonach denn eine etwanige große Weltbegebenheit
sich dem Schicksale vieler Tausende, jedem auf individuelle Weise, anpaßt.
Alle Ereignisse im Leben eines Menschen ständen demnach in zwei grundverschiedenen
Arten des Zusammenhangs: erstlich, im objektiven, kausalen Zusammenhang
des Naturlaufs; zweitens, in einem subjektiven Zusammenhange, der nur
in Beziehung auf das sie erlebende Individuum vorhanden und so subjektiv
wie dessen eigene Träume ist, in welchem jedoch ihre Succession und Inhalt
ebenfalls notwendig bestimmt ist, aber in der Art, wie die Succession
der Scenen eines Dramas, durch den Plan des Dichters. Daß nun jene beiden
Arten des Zusammenhangs zugleich bestehn und die nämliche Begebenheit,
als ein Glied zweier ganz verschiedener Ketten, doch beiden sich genau
einfügt, infolge wovon jedesmal das Schicksal des einen zum Schicksal
des andern paßt und jeder der Held seines eigenen, zugleich aber auch
der Figurant im fremden Drama ist, dies ist freilich etwas, das alle unsere
Fassungskraft übersteigt und nur vermöge der wundersamsten harmonia
praestabilita als möglich gedacht werden kann. Aber wäre es andrerseits
nicht engbrüstiger Kleinmut, es für unmöglich zu halten, daß die Lebensläufe
aller Menschen in ihrem Ineinandergreifen ebenso viel concentus und Harmonie
haben sollten, wie der Komponist der vielen, scheinbar durcheinander tobenden
Stimmen seiner Symphonie zu geben weiß? Auch wird unsere Scheu vor jenem
kolossalen Gedanken sich mindern, wenn wir uns erinnern, daß das Subjekt
des großen Lebenstraumes in gewissem Sinne nur eines ist, der Wille zum
Leben, und daß alle Vielheit der Erscheinungen durch Zeit und Raum bedingt
ist. Es ist ein großer Traum, den jenes eine Wesen träumt: aber so,
daß alle seine Personen ihn mitträumen. Daher greift alles ineinander
und paßt zu einander. Geht man nun darauf ein, nimmt man jene doppelte
Kette aller Begebenheiten an, vermöge deren jedes Wesen einerseits seiner
selbst wegen da ist, seiner Natur gemäß mit Notwendigkeit handelt und
wirkt und seinen eigenen Gang geht, andrerseits aber auch für die Auffassung
eines fremden Wesens und die Einwirkung auf dasselbe so ganz bestimmt
und geeignet ist, wie die Bilder in dessen Träumen; — so wird man dieses
auf die ganze Natur, also auch auf Tiere und erkenntnislose Wesen auszudehnen
haben. Da eröffnet sich dann abermals eine Aussicht auf die Möglichkeit
der omina, praesagia und portenta, indem nämlich das, was, nach dem Laufe
der Natur, notwendig eintritt, doch andrerseits wieder anzusehn ist als
bloßes Bild für mich und Staffage meines Lebenstraumes, bloß in Bezug
auf mich geschehend und existierend, oder auch als bloßer Widerschein
und Widerhall meines Thuns und Erlebens; wonach dann das Natürliche und
ursächlich nachweisbar Notwendige eines Ereignisses das Ominose desselben
keineswegs aufhöbe, und ebenso dieses nicht jenes. Daher sind die ganz
auf dem Irrwege, welche das Ominose eines Ereignisses dadurch zu beseitigen
vermeinen, indem sie die Unvermeidlichkeit seines Eintritts darthun, daß
sie die natürlichen und notwendig wirkenden Ursachen desselben recht
deutlich und, wenn es ein Naturereignis ist, mit gelehrter Miene, auch
physikalisch nachweisen. Denn an diesen zweifelt kein vernünftiger Mensch,
und für ein Mirakel will keiner das Omen ausgeben; sondern gerade daraus,
daß die ins Unendliche hinaufreichende Kette der Ursachen und Wirkungen,
mit der ihr eigenen, strengen Notwendigkeit und unvordenklichen Prädestination,
den Eintritt dieses Ereignisses, in solchem bedeutsamen Augenblick, unvermeidlich
festgestellt hat, erwächst demselben das Ominose; daher jenen Altklugen,
zumal wenn sie physikalisch werden, das there are more things in heaven
and earth, than are dreamt of in your philosophy (Hamlet, Akt I, Sc. 5)
vorzüglich zuzurufen ist. Andrerseits jedoch sehn wir mit dem Glauben
an die Omina auch der Astrologie wieder die Thüre geöffnet; da die geringste,
als ominos geltende Begebenheit, der Flug eines Vogels, das Begegnen eines
Menschen u. dgl. durch eine ebenso unendlich lange und ebenso streng notwendige
Kette von Ursachen bedingt ist, wie der berechenbare Stand der Gestirne
zu einer gegebenen Zeit. Nur steht freilich die Konstellation so hoch,
daß die Hälfte der Erdbewohner sie zugleich sieht; während dagegen
das Omen nur im Bereich des betreffenden einzelnen erscheint. Will man
übrigens die Möglichkeit des Ominosen sich noch durch ein Bild versinnlichen;
so kann man den, der, bei einem wichtigen Schritt in seinem Lebenslauf,
dessen Folgen noch die Zukunft verbirgt, ein gutes, oder schlimmes Omen
erblickt und dadurch gewarnt oder bestärkt wird, einer Saite vergleichen,
welche, wenn angeschlagen, sich selbst nicht hört, jedoch die, infolge
ihrer Vibration mitklingende fremde Saite vernähme. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Betrachtungen dieser Art und namentlich der Rückblick auf das ganze
Treiben mit der Philosophie auf Universitäten, seit Kants Abgange, stellen
in mir mehr und mehr die Meinung fest, daß, wenn es überhaupt eine Philosophie
geben soll, d. h. wenn es dem menschlichen Geiste vergönnt sein soll,
seine höchsten und edelsten Kräfte dem, ohne allen Vergleich, wichtigsten
aller Probleme zuwenden zu dürfen, dies nur dann mit Erfolg geschehn
kann, wann die Philosophie allem Einflusse des Staates entzogen bleibt,
und daß demnach dieser schon ein Großes für sie thut und ihr seine
Humanität und seinen Edelmut genugsam beweist, wenn er sie nicht verfolgt,
sondern sie gewähren läßt und ihr Bestand vergönnt, als einer freien
Kunst, die übrigens ihr eigener Lohn sein muß; wogegen er des Aufwandes
für Professuren derselben sich überhoben achten kann; weil die Leute,
die von der Philosophie leben wollen, höchst selten eben die sein werden,
welche eigentlich für sie leben, bisweilen aber sogar die sein können,
welche versteckterweise gegen sie machinieren.
Oeffentliche Lehrstühle gebühren allein den bereits geschaffenen, wirklich
vorhandenen Wissenschaften, welche man daher eben nur gelernt zu haben
braucht, um sie lehren zu können, die also im ganzen bloß weiter zu
geben sind, wie das auf dem schwarzen Brette gebräuchliche tradere besagt;
wobei es jedoch den fähigeren Köpfen unbenommen bleibt, sie zu bereichern,
zu berichtigen und zu vervollkommnen. Aber eine Wissenschaft, die noch
gar nicht existiert, die ihr Ziel noch nicht erreicht hat, nicht einmal
ihren Weg sicher kennt, ja deren Möglichkeit noch bestritten wird, eine
solche Wissenschaft durch Professoren lehren zu lassen ist eigentlich
absurd. Die natürliche Folge davon ist, daß jeder von diesen glaubt,
sein Beruf sei, die noch fehlende Wissenschaft zu schaffen; nicht bedenkend,
daß einen solchen Beruf nur die Natur, nicht aber das Ministerium des
öffentlichen Unterrichts erteilen kann. Er versucht es daher, so gut
es gehn will, setzt baldigst seine Mißgeburt in die Welt und gibt sie
für die lang ersehnte Sophia aus, wobei es an einem dienstwilligen Kollegen,
der bei ihrer Taufe als solcher zu Gevatter steht, gewiß nicht fehlen
wird. Danach werden dann die Herren, weil sie ja von der Philosophie leben,
so dreist, daß sie sich Philosophen nennen, und demnach auch vermeinen,
ihnen gebühre das große Wort und die Entscheidung in Sachen der Philosophie,
ja, daß sie am Ende gar noch Philosophenversammlungen (eine Contradictio
in adjecto, da Philosophen selten im Dual und fast nie im Plural zugleich
auf der Welt sind) ansagen und dann scharenweise zusammenlaufen, das Wohl
der Philosophie zu beraten*)! [...]
*) „Keine alleinseligmachende Philosophie!“ ruft die Philosophasterversammlung
in Gotha, d. h. zu deutsch: Kein Streben nach objektiver Wahrheit! Es
lebe die Mediokrität! Keine geistige Aristokratie, keine Alleinherrschaft
der von der Natur Bevorzugten! Sondern Pöbelherrschaft! Jeder von uns
rede wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und einer gelte so viel wie der
andere!“ Da haben die Lumpe gutes Spiel! Sie möchten nämlich auch
aus der Geschichte der Philosophie die bisherige monarchische Verfassung
verbannen, um eine Proletarierrepublik einzuführen: aber die Natur legt
Protest ein; sie ist streng aristokratisch!
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Wohl kaum ist irgend ein philosophisches System so einfach und aus so
wenigen Elementen zusammengesetzt, wie das meinige; daher sich dasselbe
mit einem Blick leicht überschauen und zusammenfassen läßt. Dies beruht
zuletzt auf der völligen Einheit und Uebereinstimmung seiner Grundgedanken,
und ist überhaupt ein günstiges Zeichen für seine Wahrheit, die ja
der Einfachheit verwandt ist: της αληϑειας λογος εφυ·
simplex sigillum veri. Man könnte mein System bezeichnen als immanenten
Dogmatismus: denn seine Lehrsätze sind zwar dogmatisch, gehn jedoch nicht
über die in der Erfahrung gegebene Welt hinaus; sondern erklären bloß
was diese sei, indem sie dieselbe in ihre letzten Bestandteile zerlegen.
Nämlich der alte, von Kant umgestoßene Dogmatismus (nicht weniger die
Windbeuteleien der drei modernen Universitätssophisten) ist transcendent;
indem er über die Welt hinausgeht, um sie aus etwas anderem zu erklären:
er macht sie zur Folge eines Grundes, auf welchen er aus ihr schließt.
Meine Philosophie hingegen hub mit dem Satz an, daß es allein in der
Welt und unter Voraussetzung derselben Gründe und Folgen gebe; indem
der Satz vom Grunde, in seinen vier Gestalten, bloß die allgemeinste
Form des Intellekts sei, in diesem aber allein, als dem wahren Locus mundi,
die objektive Welt dastehe. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Man kann, hinsichtlich aller Bewegung überhaupt, welcher Art sie
auch sein möge, a priori feststellen, daß sie allererst wahrnehmbar
wird durch den Vergleich mit irgend einem Ruhenden; woraus folgt, daß
auch der Lauf der Zeit, mit allem in ihr, nicht wahrgenommen werden könnte,
wenn nicht etwas wäre, das an demselben keinen Teil hat, und mit dessen
Ruhe wir die Bewegung jenes vergleichen. Wir urteilen hierin freilich
nach Analogie der Bewegung im Raum: aber Raum und Zeit müssen immer dienen,
einander wechselseitig zu erläutern, daher wir eben auch die Zeit unter
dem Bilde einer geraden Linie uns vorstellen müssen, um sie anschaulich
auffassend, a priori zu konstruieren. Demzufolge also können wir uns
nicht vorstellen, daß, wenn alles in unserm Bewußtsein, zugleich und
zusammen, im Flusse der Zeit fortrückte, dieses Fortrücken dennoch wahrnehmbar
sein sollte; sondern hiezu müssen wir ein Feststehendes voraussetzen,
an welchem die Zeit mit ihrem Inhalt vorüberflösse. Für die Anschauung
des äußern Sinnes leistet dies die Materie, als die bleibende Substanz,
unter dem Wechsel der Accidenzien; wie dies auch Kant darstellt, im Beweise
zur „ersten Analogie der Erfahrung“, S. 183 der ersten Ausgabe. An
eben dieser Stelle ist es jedoch, wo er den schon sonst von mir gerügten,
unerträglichen, ja seinen eigenen Lehren widersprechenden Fehler begeht,
zu sagen, daß nicht die Zeit selbst verflösse, sondern nur die Erscheinungen
in ihr. Daß dies grundsätzlich sei, beweist die uns allen inwohnende
feste Gewißheit, daß, wenn auch alle Dinge im Himmel und auf Erden plötzlich
stille ständen, doch die Zeit, davon ungestört, ihren Lauf fortsetzen
würde; so daß, wenn späterhin die Natur einmal wieder in Gang geriete,
die Frage nach der Länge der dagewesenen Pause, an sich selbst einer
ganz genauen Beantwortung fähig sein würde. Wäre dem anders; so müßte
mit der Uhr auch die Zeit stille stehn, oder, wenn jene liefe, mitlaufen.
Gerade dies Sachverhältnis aber, nebst unserer Gewißheit a priori darüber,
beweist unwidersprechlich, daß die Zeit in unserm Kopfe, nicht aber draußen,
ihren Verlauf, und also ihr Wesen, hat. — Im Gebiete der äußern Anschauung,
sagte ich, ist das Beharrende die Materie: bei unserm Argument der Persönlichkeit
hingegen ist die Rede bloß von der Wahrnehmung des innern Sinnes, in
welche auch die des äußern erst wieder aufgenommen wird. Daher also
sagte ich, daß wenn unser Bewußtsein mit seinem gesamten Inhalt gleichmäßig
im Strome der Zeit sich fortbewegte, wir dieser Bewegung nicht inne werden
könnten. Also muß hiezu im Bewußtsein selbst etwas Unbewegliches sein.
Dieses aber kann nichts anderes sein, als das erkennende Subjekt selbst,
als welches dem Laufe der Zeit und dem Wechsel ihres Inhalts unerschüttert
und unverändert zuschaut. Vor seinem Blicke läuft das Leben wie ein
Schauspiel zu Ende. Wie wenig es selbst an diesem Laufe teil hat, wird
uns sogar fühlbar, wenn wir, im Alter, die Scenen der Jugend und Kindheit
uns lebhaft vergegenwärtigen. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die objektive Hälfte der Gegenwart und Wirklichkeit steht in der
Hand des Schicksals und ist demnach veränderlich: die subjektive sind
wir selbst; daher sie im wesentlichen unveränderlich ist. Demgemäß
trägt das Leben jedes Menschen, trotz aller Abwechselung von außen,
durchgängig denselben Charakter und ist einer Reihe Variationen auf ein
Thema zu vergleichen. Aus seiner Individualität kann keiner heraus. Und
wie das Tier, unter allen Verhältnissen, in die man es setzt, auf den
engen Kreis beschränkt bleibt, den die Natur seinem Wesen unwiderruflich
gezogen hat, weshalb z. B. unsere Bestrebungen, ein geliebtes Tier zu
beglücken, eben wegen jener Grenzen seines Wesens und Bewußtseins, stets
innerhalb enger Schranken sich halten müssen; — so ist es auch mit
dem Menschen: durch seine Individualität ist das Maß seines möglichen
Glückes zum voraus bestimmt. Besonders haben die Schranken seiner Geisteskräfte
seine Fähigkeit für erhöhten Genuß ein für allemal festgestellt.
Sind sie eng, so werden alle Bemühungen von außen, alles was Menschen,
alles was das Glück für ihn thut, nicht vermögen, ihn über das Maß
des gewöhnlichen, halb tierischen Menschenglücks und Behagens hinauszuführen:
auf Sinnengenuß, trauliches und heiteres Familienleben, niedrige Geselligkeit
und vulgären Zeitvertreib bleibt er angewiesen: sogar die Bildung vermag
im ganzen, zur Erweiterung jenes Kreises, nicht gar viel, wenngleich etwas.
Denn die höchsten, die mannigfaltigsten und die anhaltendesten Genüsse
sind die geistigen; wie sehr auch wir, in der Jugend, uns darüber täuschen
mögen; diese aber hängen hauptsächlich von der geistigen Kraft ab.
— Hieraus also ist klar, wie sehr unser Glück abhängt von dem, was
wir sind, von unserer Individualität; während man meistens nur unser
Schicksal, nur das, was wir haben, oder was wir vorstellen, in Anschlag
bringt. Das Schicksal aber kann sich bessern: zudem wird man, bei innerm
Reichtum, von ihm nicht viel verlangen: hingegen ein Tropf bleibt ein
Tropf, ein stumpfer Klotz ein stumpfer Klotz, bis an sein Ende, und wäre
er im Paradiese und von Huris umgeben. Deshalb sagt Goethe:
Volk und Knecht und Ueberwinder,
Sie gestehn, zu jeder Zeit,
Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.
Westöstl. Diwan.
Daß für unser Glück und unsern Genuß das Subjektive ungleich wesentlicher,
als das Objektive sei, bestätigt sich in allem: von dem an, daß Hunger
der beste Koch ist und der Greis die Göttin des Jünglings gleichgültig
ansieht, bis hinauf zum Leben des Genies und des Heiligen. Besonders überwiegt
die Gesundheit alle äußern Güter so sehr, daß wahrlich ein gesunder
Bettler glücklicher ist, als ein kranker König. Ein aus vollkommener
Gesundheit und glücklicher Organisation hervorgehendes, ruhiges und heiteres
Temperament, ein klarer, lebhafter, eindringender und richtig fassender
Verstand, ein gemäßigter, sanfter Wille und demnach ein gutes Gewissen,
dies sind Vorzüge, die kein Rang oder Reichtum ersetzen kann. Denn was
einer für sich selbst ist, was ihn in die Einsamkeit begleitet und was
keiner ihm geben, oder nehmen kann, ist offenbar für ihn wesentlicher,
als alles, was er besitzen, oder auch was er in den Augen anderer sein
mag. Ein geistreicher Mensch hat, in gänzlicher Einsamkeit, an seinen
eigenen Gedanken und Phantasien vortreffliche Unterhaltung, während von
einem Stumpfen die fortwährende Abwechselung von Gesellschaften, Schauspielen,
Ausfahrten und Lustbarkeiten, die marternde Langeweile nicht abzuwehren
vermag. Ein guter, gemäßigter, sanfter Charakter kann unter dürftigen
Umständen zufrieden sein; während ein begehrlicher, neidischer und böser
es bei allem Reichtum nicht ist. Nun aber gar dem, welcher beständig
den Genuß einer außerordentlichen, geistig eminenten Individualität
hat, sind die meisten der allgemein angestrebten Genüsse ganz überflüssig,
ja, nur störend und lästig. Daher sagt Horaz von sich:
Gemmas, marmor, ebur, Thyrrhena sigilla, tabellas,
Argentum, vestes Gaetulo murice tinctas,
Sunt qui non habeant, est qui non curat habere;
und Sokrates sagte, beim Anblick zum Verkauf ausgelegter Luxusartikel:
„Wie vieles gibt es doch, was ich nicht nötig habe.“ [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Scotus Erigena.
Dieser bewundernswürdige Mann gewährt uns den interessanten Anblick
des Kampfes zwischen selbsterkannter, selbstgeschaueter Wahrheit und lokalen,
durch frühe Einimpfung fixierten, allem Zweifel, wenigstens allem direkten
Angriff, entwachsenen Dogmen, nebst dem daraus hervorgehenden Streben
einer edlen Natur, die so entstandene Dissonanz irgendwie zum Einklang
zurückzuführen. Dies kann dann aber freilich nur dadurch geschehn, daß
die Dogmen gewendet, gedreht und nötigenfalls verdreht werden, bis sie
sich der selbsterkannten Wahrheit nolentes volentes anschmiegen, als welche
das dominierende Prinzip bleibt, jedoch genötigt wird, in einem seltsamen
und sogar beschwerlichen Gewande einherzugehn. Diese Methode weiß Erigena,
in seinem großen Werke De divisione naturae, überall mit Glück durchzuführen,
bis er endlich auch an den Ursprung des Uebels und der Sünde, nebst den
angedrohten Qualen der Hölle, sich damit machen will: hier scheitert
sie, und zwar am Optimismus, der eine Folge des jüdischen Monotheismus
ist. Er lehrt, im fünften Buch, die Rückkehr aller Dinge in Gott und
die metaphysische Einheit und Unteilbarkeit der ganzen Menschheit, ja,
der ganzen Natur. Nun frägt sich: wo bleibt die Sünde? sie kann nicht
mit in den Gott; — wo ist die Hölle, mit ihrer endlosen Qual, wie sie
verheißen worden? — wer soll hinein? die Menschheit ist ja erlöst,
und zwar ganz. — Hier bleibt das Dogma unüberwindlich. Erigena windet
sich kläglich, durch weitläuftige Sophismen, die auf Worte hinauslaufen,
wird endlich zu Widersprüchen und Absurditäten genötigt, zumal da die
Frage nach dem Ursprung der Sünde unvermeidlicherweise mit hineingekommen,
dieser nun aber weder in Gott, noch auch in dem von ihm geschaffenen Willen
liegen kann; weil sonst Gott der Urheber der Sünde wäre; welches letztere
er vortrefflich einsieht, S. 287 der Oxforder Editio princeps von 1681.
Nun wird er zu Absurditäten getrieben: da soll die Sünde weder eine
Ursache noch ein Subjekt haben: malum incausale est, . . . . penitus incausale
et insubstantiale est: ibid. — Der tiefere Grund dieser Uebelstände
ist, daß die Lehre von der Erlösung der Menschheit und der Welt, welche
offenbar indischen Ursprungs ist, eben auch die indische Lehre voraussetzt,
nach welcher der Ursprung der Welt (dieses Sansara der Buddhaisten) selbst
schon vom Uebel, nämlich eine sündliche That des Brahma ist, welcher
Brahma nun wieder wir eigentlich selbst sind: denn die indische Mythologie
ist überall durchsichtig. Hingegen im Christentum hat jene Lehre von
der Erlösung der Welt gepfropft werden müssen auf den jüdischen Theismus,
wo der Herr die Welt nicht nur gemacht, sondern auch nachher sie vortrefflich
gefunden hat: παντα καλα λιαν. Hinc illae lacrimae: hieraus
erwachsen jene Schwierigkeiten, die Erigena vollkommen erkannte, wiewohl
er, in seinem Zeitalter, nicht wagen durfte, das Uebel an der Wurzel anzugreifen.
Inzwischen ist er von hindostanischer Milde: er verwirft die vom Christentum
gesetzte ewige Verdammnis und Strafe: alle Kreatur, vernünftige, tierische,
vegetabilische und leblose, muß, ihrer innern Essenz nach, selbst durch
den notwendigen Lauf der Natur, zur ewigen Seligkeit gelangen: denn sie
ist von der ewigen Güte ausgegangen. Aber den Heiligen und Gerechten
allein wird die gänzliche Einheit mit Gott, Deificatio. Uebrigens ist
Erigena so redlich, die große Verlegenheit, in welche ihn der Ursprung
des Uebels versetzt, nicht zu verbergen: er legt sie, in der angeführten
Stelle des fünften Buches, deutlich dar. In der That ist der Ursprung
des Uebels die Klippe, an welcher, so gut wie der Pantheismus, auch der
Theismus scheitert: denn beide implizieren Optimismus. Nun aber sind das
Uebel und die Sünde, beide in ihrer furchtbaren Größe, nicht wegzuleugnen,
ja, durch die verheißenen Strafen für die letztere, wird das erstere
nur noch vermehrt. Woher nun alles dieses, in einer Welt, die entweder
selbst ein Gott, oder das wohlgemeinte Werk eines Gottes ist? Wenn die
theistischen Gegner des Pantheismus diesem entgegenschreien: „Was? alle
die bösen, schrecklichen, scheußlichen Wesen sollen Gott sein?“ —
so können die Pantheisten erwidern: „Wie? alle jene bösen, schrecklichen,
scheußlichen Wesen soll ein Gott, de gaietè de coeur, hervorgebracht
haben?“ — In derselben Not, wie hier, finden wir den Erigena auch
noch in dem andern seiner auf uns gekommenen Werke, dem Buche De praedestinatione,
welches jedoch dem De divisione naturae weit nachsteht; wie er denn in
demselben auch nicht als Philosoph, sondern als Theolog auftritt. Auch
hier also quält er sich erbärmlich mit jenen Widersprüchen, welche
ihren letzten Grund darin haben, daß das Christentum auf das Judentum
geimpft ist. Seine Bemühungen stellen solche aber nur in noch helleres
Licht. Der Gott soll alles, alles und in allem alles gemacht haben; das
steht fest: — „folglich auch das Böse und das Uebel“. Diese unausweichbare
Konsequenz ist wegzuschaffen und Erigena sieht sich genötigt, erbärmliche
Wortklaubereien vorzubringen. Da sollen das Uebel und das Böse gar nicht
sein, sollen also nichts sein. — Den Teufel auch! — Oder aber der
freie Wille soll an ihnen schuld sein: diesen nämlich habe der Gott zwar
geschaffen, jedoch frei; daher es ihn nicht angeht, was derselbe nachher
vornimmt: denn er war ja eben frei, d. h. konnte so und auch anders, konnte
also gut, sowohl wie schlecht sein. — Bravo! — Die Wahrheit aber ist,
daß Freisein und Geschaffensein zwei einander aufhebende, also sich widersprechende
Eigenschaften sind; daher die Behauptung, Gott habe Wesen geschaffen,
und ihnen zugleich Freiheit des Willens erteilt, eigentlich besagt, er
habe sie geschaffen und zugleich nicht geschaffen. Denn operari sequitur
esse, d. h. die Wirkungen, oder Aktionen, jedes irgend möglichen Dinges
können nie etwas anders, als die Folge seiner Beschaffenheit sein; welche
selbst sogar nur an ihnen erkannt wird. Daher müßte ein Wesen, um in
dem hier geforderten Sinne frei zu sein, gar keine Beschaffenheit haben,
d. h. aber gar nichts sein, also sein und nicht sein zugleich. Denn was
ist muß auch etwas sein: eine Existenz ohne Essenz läßt sich nicht
einmal denken. Ist nun ein Wesen geschaffen; so ist es so geschaffen,
wie es beschaffen ist: mithin ist es schlecht geschaffen, wenn es schlecht
beschaffen ist, und schlecht beschaffen, wenn es schlecht handelt, d.
h. wirkt. Demzufolge wälzt die Schuld der Welt, eben wie ihr Uebel, welches
so wenig wie jene abzuleugnen ist, sich immer auf ihren Urheber zurück,
von welchem es abzuwälzen, wie früher Augustinus, so hier Scotus Erigena
sich jämmerlich abmühet. Soll hingegen ein Wesen moralisch frei sein;
so darf es nicht geschaffen sein, sondern muß Aseität haben, d. h. ein
ursprüngliches, aus eigener Urkraft und Machtvollkommenheit existierendes
sein, und nicht auf ein anderes zurückweisen. Dann ist sein Dasein sein
eigener Schöpfungsakt, der sich in der Zeit entfaltet und ausbreitet,
zwar eine ein für allemal entschiedene Beschaffenheit dieses Wesens an
den Tag legt, welche jedoch sein eigenes Werk ist, für deren sämtliche
Aeußerungen die Verantwortlichkeit also auf ihm selbst haftet. — Soll
nun ferner ein Wesen für sein Thun verantwortlich, also soll es zurechnungsfähig
sein; so muß es frei sein. Also aus der Verantwortlichkeit und Imputabilität,
die unser Gewissen aussagt, folgt sehr sicher, daß der Wille frei sei,
hieraus aber wieder, daß er das Ursprüngliche selbst, mithin nicht bloß
das Handeln, sondern schon das Dasein und Wesen des Menschen sein eigenes
Werk sei. Ueber alles dieses verweise ich auf meine Abhandlung über die
Freiheit des Willens, wo man es ausführlich und unwiderleglich auseinandergesetzt
findet; daher eben die Philosophieprofessoren diese gekrönte Preisschrift
durch das unverbrüchlichste Schweigen zu sekretieren gesucht haben. —
Die Schuld der Sünde und des Uebels fällt allemal von der Natur auf
ihren Urheber zurück. Ist nun dieser der in allen ihren Erscheinungen
sich darstellende Wille selbst; so ist jene an den rechten Mann gekommen:
soll es hingegen ein Gott sein; so widerspricht die Urheberschaft der
Sünde und des Uebels seiner Göttlichkeit. — Beim Lesen des Dionysius
Areopagita, auf den Erigena sich so häufig beruft, habe ich gefunden,
daß derselbe ganz und gar sein Vorbild gewesen ist. Sowohl der Pantheismus
Erigenas, als seine Theorie des Bösen und des Uebels, findet sich, den
Grundzügen nach, schon beim Dionysius: freilich aber ist bei diesem nur
angedeutet was Erigena entwickelt, mit Kühnheit ausgesprochen und mit
Feuer dargestellt hat. Erigena hat unendlich mehr Geist, als Dionysius:
allein den Stoff und die Richtung der Betrachtungen hat ihm Dionysius
gegeben und ihm also mächtig vorgearbeitet. Daß Dionysius unecht sei,
thut nichts zur Sache, es ist gleichviel, wie der Verfasser des Buches
De divinis nominibus geheißen hat. Da er indessen wahrscheinlich in Alexandrien
lebte, so glaube ich, daß er, auf eine anderweitige, uns unbekannte Art,
auch der Kanal gewesen ist, durch welchen ein Tröpfchen indischer Weisheit
bis zum Erigena gelangt sein mag; da, wie Colebrooke in seiner Abhandlung
über die Philosophie der Hindu (in Colebrooke’s Miscellaneous essays
Vol. I. p. 244) bemerkt hat, der Lehrsatz III der Karika des Kapila sich
beim Erigena findet.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ich glaube keineswegs etwas meiner Feder Unwürdiges zu thun, indem
ich hier die Sorge für Erhaltung des erworbenen und des ererbten Vermögens
anempfehle. Denn von Hause aus so viel zu besitzen, daß man, wäre es
auch nur für seine Person und ohne Familie, in wahrer Unabhängigkeit,
d. h. ohne zu arbeiten, bequem leben kann, ist ein unschätzbarer Vorzug:
denn es ist die Exemtion und die Immunität von der dem menschlichen Leben
anhängenden Bedürftigkeit und Plage, also die Emancipation vom allgemeinen
Frondienst, diesem naturgemäßen Lose des Erdensohns. Nur unter dieser
Begünstigung des Schicksals ist man als ein wahrer Freier geboren: denn
nur so ist man eigentlich sui juris, Herr seiner Zeit und seiner Kräfte,
und darf jeden Morgen sagen: „Der Tag ist mein.“ Auch ist ebendeshalb
zwischen dem, der tausend, und dem der hunderttausend Thaler Renten hat,
der Unterschied unendlich kleiner, als zwischen ersterem und dem, der
nichts hat. Seinen höchsten Wert aber erlangt das angeborene Vermögen,
wenn es dem zugefallen ist, der mit geistigen Kräften höherer Art ausgestattet,
Bestrebungen verfolgt, die sich mit dem Erwerbe nicht wohl vertragen:
denn alsdann ist er vom Schicksal doppelt dotiert und kann jetzt seinem
Genius leben: der Menschheit aber wird er seine Schuld dadurch hundertfach
abtragen, daß er leistet was kein anderer konnte und etwas hervorbringt,
das ihrer Gesamtheit zu gute kommt, wohl auch gar ihr zur Ehre gereicht.
Ein anderer nun wieder wird, in so bevorzugter Lage, sich durch philanthropische
Bestrebungen um die Menschheit verdient machen. Wer hingegen nichts von
dem allen, auch nur einigermaßen, oder versuchsweise, leistet, ja, nicht
einmal, durch gründliche Erlernung irgend einer Wissenschaft, sich wenigstens
die Möglichkeit eröffnet, dieselbe zu fördern, — ein solcher ist,
bei angeerbtem Vermögen, ein bloßer Tagedieb und verächtlich. Auch
wird er nicht glücklich sein: denn die Exemtion von der Not liefert ihn
dem andern Pol des menschlichen Elends, der Langenweile, in die Hände,
die ihn so martert, daß er viel glücklicher wäre, wenn die Not ihm
Beschäftigung gegeben hätte. Eben diese Langeweile aber wird ihn leicht
zu Extravaganzen verleiten, welche ihn um jenen Vorzug bringen, dessen
er nicht würdig war. Wirklich befinden Unzählige sich bloß deshalb
in Mangel, weil, als sie Geld hatten, sie es ausgaben, um nur sich augenblickliche
Linderung der sie drückenden Langenweile zu verschaffen.
Ganz anders nun aber verhält es sich, wenn der Zweck ist, es im Staatsdienste
hoch zu bringen, wo demnach Gunst, Freunde, Verbindungen erworben werden
müssen, um durch sie, von Stufe zu Stufe, Beförderung, vielleicht gar
bis zu den höchsten Posten, zu erlangen: hier nämlich ist es im Grunde
wohl besser, ohne alles Vermögen in die Welt gestoßen zu sein. Besonders
wird es dem, welcher nicht adelig, hingegen mit einigem Talent ausgestattet
ist, zum wahren Vorteil und zur Empfehlung gereichen, wenn er ein ganz
armer Teufel ist. Denn was jeder, schon in der bloßen Unterhaltung, wie
viel mehr im Dienste, am meisten sucht und liebt, ist die Inferiorität
des andern. Nun aber ist allein ein armer Teufel von seiner gänzlichen,
tiefen, entschiedenen und allseitigen Inferiorität und seiner völligen
Unbedeutsamkeit und Wertlosigkeit in dem Grade überzeugt und durchdrungen,
wie es hier erfordert wird. Nur er demnach verbeugt sich oft und anhaltend
genug, und nur seine Bücklinge erreichen volle 90 Grad: nur er läßt
alles über sich ergehn und lächelt dazu; nur er erkennt die gänzliche
Wertlosigkeit der Verdienste; nur er preist öffentlich, mit lauter Stimme,
oder auch in großem Druck, die litterarischen Stümpereien der über
ihn Gestellten, oder sonst Einflußreichen, als Meisterwerke; nur er versteht
zu betteln: folglich kann nur er, beizeiten, also in der Jugend, sogar
ein Epopte jener verborgenen Wahrheit werden, die Goethe uns enthüllt
hat in den Worten:
“Uebers Niederträchtige
Niemand sich beklage:
Denn es ist das Mächtige,
Was man dir auch sage.“
Westöstl. Diwan.
Hingegen der, welcher von Hause aus zu leben hat, wird sich meistens ungebärdig
stellen: er ist gewohnt tète levèe zu gehn, hat alle jene Künste nicht
gelernt, trotzt dazu vielleicht noch auf etwanige Talente, deren Unzulänglichkeit
vielmehr, dem mèdiocre et rampant gegenüber, er begreifen sollte; er
ist am Ende wohl gar im stande, die Inferiorität der über ihn Gestellten
zu merken; und wenn es nun vollends zu den Indignitäten kommt, da wird
er stätisch oder kopfscheu. Damit poussiert man sich nicht in der Welt:
vielmehr kann es mit ihm zuletzt dahin kommen, daß er mit dem frechen
Voltaire sagt: nous n’avons que deux jours å vivre: ce n’est pas
la peine de les passer à ramper sous des coquins mèprisables: — leider
ist, beiläufig gesagt, dieses coquin mèprisable ein Prädikat, zu dem
es in der Welt verteufelt viele Subjekte gibt. Man sieht also, daß das
Juvenalische
Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat
Res angusta domi,
mehr von der Laufbahn der Virtuositäten, als von der der Weltleute, gültig
ist. —
Zu dem, was einer hat, habe ich Frau und Kinder nicht gerechnet; da er
von diesen vielmehr gehabt wird. Eher ließen sich Freunde dazu zählen:
doch muß auch hier der Besitzende im gleichen Maße der Besitz des andern
sein.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wenden wir uns nunmehr zur rationalen Kosmologie; so finden wir
an ihren Antinomien prägnante Ausdrücke der aus dem Satze vom Grunde
entspringenden Perplexität, die von jeher zum Philosophieren getrieben
hat. Diese nun, auf einem etwas andern Wege, deutlicher und unumwundener
hervorzuheben, als dort geschehn, ist die Absicht folgender Darstellung,
welche nicht, wie die Kantische, bloß dialektisch, mit abstrakten Begriffen
operiert, sondern sich Unmittelbar an das anschauende Bewußtsein wendet.
Die Zeit kann keinen Anfang haben, und keine Ursache kann die erste sein.
Beides ist a priori gewiß, also unbestreitbar: denn aller Anfang ist
in der Zeit, setzt sie also voraus; und jede Ursach muß eine frühere
hinter sich haben, deren Wirkung sie ist. Wie hätte also jemals ein erster
Anfang der Welt und der Dinge eintreten können? (Danach erscheint denn
freilich der erste Vers des Pentateuchs als eine Petitio principii und
zwar im allereigentlichsten Sinne des Worts.) Aber nun andrerseits: wenn
ein erster Anfang nicht gewesen wäre; so könnte die jetzige reale Gegenwart
nicht erst jetzt sein, sondern wäre schon längst gewesen: denn zwischen
ihr und dem ersten Anfange müssen wir irgend einen, jedoch bestimmten
und begrenzten Zeitraum annehmen, der nun aber, wenn wir den Anfang leugnen,
d. h. ihn ins Unendliche hinaufrücken, mit hinaufrückt. Aber sogar auch
wenn wir einen ersten Anfang setzen; so ist uns damit im Grunde doch nicht
geholfen: denn, haben wir auch dadurch die Kausalkette beliebig abgeschnitten;
so wird alsbald die bloße Zeit sich uns beschwerlich erweisen. Nämlich
die immer erneuerte Frage „warum jener erste Anfang nicht schon früher
eingetreten?“ wird ihn schrittweise, in der anfangslosen Zeit, immer
weiter hinaufschieben, wodurch dann die Kette der zwischen ihm und uns
liegenden Ursachen dermaßen in die Höhe gezogen wird, daß sie nimmer
lang genug werden kann, um bis zur jetzigen Gegenwart herab zu reichen,
wonach es alsdann zu dieser immer noch nicht gekommen sein würde. Dem
widerstreitet nun aber, daß sie doch jetzt einmal wirklich da ist und
sogar unser einziges Datum zu der Rechnung ausmacht. Die Berechtigung
nun aber zur obigen, so unbequemen Frage entsteht daraus, daß der erste
Anfang, eben als solcher, keine ihm vorhergängige Ursache voraussetzt
und gerade darum ebensogut hätte Trillionen Jahre früher eintreten können.
Bedurfte er nämlich keiner Ursache zum Eintreten, so hatte er auch auf
keine zu warten, mußte demnach schon unendlich früher eingetreten sein,
weil nichts da war, ihn zu hemmen. Denn, dem ersten Anfange darf, wie
nichts als seine Ursach, so auch nichts als sein Hindernis vorhergehn:
er hat also schlechterdings auf nichts zu warten und kommt nie früh genug.
Daher also ist, in welchen Zeitpunkt man ihn auch setzen mag, nie einzusehn,
warum er nicht schon sollte viel früher dagewesen sein. Dies also schiebt
ihn immer weiter hinauf: weil nun aber doch die Zeit selbst durchaus keinen
Anfang haben kann; so ist allemal bis zum gegenwärtigen Augenblick eine
unendliche Zeit, eine Ewigkeit, abgelaufen: daher ist dann auch das Hinaufschieben
des Weltanfangs ein endloses, so daß von ihm bis zu uns jede Kausalkette
zu kurz ausfällt, infolge wovon wir dann von demselben nie bis zur Gegenwart
herabgelangen. Dies kommt daher, daß uns ein gegebener und fester Anknüpfungspunkt
(point d’attache) fehlt, daher wir einen solchen beliebig irgendwo annehmen,
derselbe aber stets vor unsern Händen zurückweicht, die Unendlichkeit
hinauf. — So fällt es also aus, wenn wir einen ersten Anfang setzen
und davon ausgehn: wir gelangen nie von ihm zur Gegenwart herab.
Gehn wir hingegen umgekehrt von der doch wirklich gegebenen Gegenwart
aus: dann gelangen wir, wie schon gemeldet, nie zum ersten Anfang hinauf;
da jede Ursache, zu der wir hinauf schreiten, immer Wirkung einer frühern
gewesen sein muß, welche dann sich wieder im selben Fall befindet, und
dies durchaus kein Ende erreichen kann. Jetzt wird uns also die Welt anfangslos,
wie die unendliche Zeit selbst; wobei unsre Einbildungskraft ermüdet
und unser Verstand keine Befriedigung erhält.
Diese beiden entgegengesetzten Ansichten sind demnach einem Stocke zu
vergleichen, dessen eines Ende, und zwar welches man will, man bequem
fassen kann, wobei jedoch das andere sich immer ins Unendliche verlängert.
Das Wesentliche der Sache aber läßt sich in dem Satze resümieren, daß
die Zeit, als schlechthin unendlich, immer viel zu groß ausfällt für
eine ihr als endlich angenommene Welt. Im Grunde aber bestätigt sich
hiebei doch wieder die Wahrheit der „Antithese“ in der Kantischen
Antinomie; weil sich, wenn wir von dem allein Gewissen und wirklich Gegebenen,
der realen Gegenwart, ausgehn, die Anfangslosigkeit ergibt; hingegen der
erste Anfang bloß eine beliebige Annahme ist, die sich aber auch als
solche nicht mit dem besagten allein Gewissen und Wirklichen, der Gegenwart,
vereinbaren läßt. — Wir haben übrigens diese Betrachtungen als solche
anzusehn, welche die Ungereimtheiten aufdecken, die aus der Annahme der
absoluten Realität der Zeit hervorgehn; folglich als Bestätigungen der
Grundlehre Kants.
Die Frage, ob die Welt dem Raume nach begrenzt, oder unbegrenzt sei, ist
nicht schlechthin transcendent; vielmehr an sich selbst empirisch; da
die Sache immer noch im Bereich möglicher Erfahrung liegt, welche wirklich
zu machen nur durch unsere eigene physische Beschaffenheit uns benommen
bleibt. A priori gibt es hier kein demonstrabel sicheres Argument, weder
für die eine noch die andere Alternative; so daß die Sache wirklich
einer Antinomie sehr ähnlich sieht, sofern, bei der einen, wie der andern
Annahme, bedeutende Uebelstände sich hervorthun. Nämlich eine begrenzte
Welt im unendlichen Raume schwindet, sei sie auch noch so groß, zu einer
unendlich kleinen Größe, und man frägt, wozu denn der übrige Raum
da sei? Andrerseits wieder kann man nicht fassen, daß kein Fixstern der
äußerste im Raume sein sollte. — Beiläufig gesagt, würden die Planeten
eines solchen nur während der einen Hälfte ihres Jahres nachts einen
gestirnten Himmel haben, während der andern aber einen ungestirnten,
— der auf die Bewohner einen sehr unheimlichen Eindruck machen müßte.
Demnach läßt jene Frage sich auch so ausdrücken: gibt es einen Fixstern,
dessen Planeten in diesem Prädikamente stehn oder nicht? Hier zeigt sie
sich als offenbar empirisch. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Unser praktisches, reales Leben nämlich ist, wenn nicht die Leidenschaften
es bewegen, langweilig und fade; wenn sie aber es bewegen, wird es bald
schmerzlich: darum sind die allein beglückt, denen irgend ein Ueberschuß
des Intellekts, über das zum Dienst ihres Willens erforderliche Maß,
zu teil geworden. Denn damit führen sie, neben ihrem wirklichen, noch
ein intellektuelles Leben, welches sie fortwährend auf eine schmerzlose
Weise und doch lebhaft beschäftigt und unterhält. Bloße Muße, d. h.
durch den Dienst des Willens unbeschäftigter Intellekt, reicht dazu nicht
aus; sondern ein wirklicher Ueberschuß der Kraft ist erfordert: denn
nur dieser befähigt zu einer dem Willen nicht dienenden, rein geistigen
Beschäftigung: hingegen otium sine litteris mors est et hominis vivi
sepultura (Sen. ep. 82). Je nachdem nun aber dieser Ueberschuß klein
oder groß ist, gibt es unzählige Abstufungen jenes, neben dem realen
zu führenden intellektuellen Lebens, vom bloßen Insekten-, Vögel-,
Mineralien-, Münzensammeln und Beschreiben, bis zu den höchsten Leistungen
der Poesie und Philosophie. Ein solches intellektuelles Leben schützt
aber nicht nur gegen die Langeweile, sondern auch gegen die verderblichen
Folgen derselben. Es wird nämlich zur Schutzwehr gegen schlechte Gesellschaft
und gegen die vielen Gefahren, Unglücksfälle, Verluste und Verschwendungen,
in die man gerät, wenn man sein Glück ganz in der realen Welt sucht.
So hat z. B. mir meine Philosophie nie etwas eingebracht; aber sie hat
mir sehr viel erspart.
Der normale Mensch hingegen ist, hinsichtlich des Genusses seines Lebens,
auf Dinge außer ihm gewiesen, auf den Besitz, den Rang, auf Weib und
Kinder, Freunde, Gesellschaft u. s. w., auf diese stützt sich sein Lebensglück:
darum fällt es dahin, wenn er sie verliert, oder er sich in ihnen getäuscht
sah. Dieses Verhältnis auszudrücken, können wir sagen, daß sein Schwerpunkt
außer ihm fällt. Eben deshalb hat er auch stets wechselnde Wünsche
und Grillen: er wird, wenn seine Mittel es erlauben, bald Landhäuser,
bald Pferde kaufen, bald Feste geben, bald Reisen machen, überhaupt aber
großen Luxus treiben; weil er eben in Dingen aller Art ein Genüge von
außen sucht; wie der Entkräftete aus Consommès und Apothekerdrogen
die Gesundheit und Stärke zu erlangen hofft, deren wahre Quelle die eigene
Lebenskraft ist. Stellen wir nun, um nicht gleich zum andern Extrem überzugehn,
neben ihnen einen Mann von nicht gerade eminenten, aber doch das gewöhnliche
knappe Maß überschreitenden Geisteskräften; so sehn wir diesen etwan
irgend eine schöne Kunst als Dilettant üben, oder aber eine Realwissenschaft,
wie Botanik, Mineralogie, Physik, Astronomie, Geschichte u. dgl. betreiben
und alsbald einen großen Teil seines Genusses darin finden, sich daran
erholend, wenn jene äußern Quellen stocken, oder ihn nicht mehr befriedigen.
Wir können insofern sagen, daß sein Schwerpunkt schon zum Teil in ihn
selbst fällt. Weil jedoch bloßer Dilettantismus in der Kunst noch sehr
weit von der hervorbringenden Fähigkeit liegt, und weil bloße Realwissenschaften
bei den Verhältnissen der Erscheinungen zu einander stehn bleiben; so
kann der ganze Mensch nicht darin aufgehn, sein ganzes Wesen kann nicht
bis auf den Grund von ihnen erfüllt werden und daher sein Dasein sich
nicht mit ihnen so verweben, daß er am übrigen alles Interesse verlöre.
Dies nun bleibt der höchsten geistigen Eminenz allein vorbehalten, die
man mit dem Namen des Genies zu bezeichnen pflegt: denn nur sie nimmt
das Dasein und Wesen der Dinge im ganzen und absolut zu ihrem Thema, wonach
sie dann ihre tiefe Auffassung desselben, gemäß ihrer individuellen
Richtung, durch Kunst, Poesie oder Philosophie auszusprechen streben wird.
Daher ist allein einem Menschen dieser Art die ungestörte Beschäftigung
mit sich, mit seinen Gedanken und Werken dringendes Bedürfnis, Einsamkeit
willkommen, freie Muße das höchste Gut, alles übrige entbehrlich, ja,
wenn vorhanden, oft nur zur Last. Nur von einem solchen Menschen können
wir demnach sagen, daß sein Schwerpunkt ganz in ihn fällt. Hieraus wird
sogar erklärlich, daß die höchst seltenen Leute dieser Art, selbst
beim besten Charakter, doch nicht jene innige und grenzenlose Teilnahme
an Freunden, Familie und Gemeinwesen zeigen, deren mache der andern fähig
sind: denn sie können sich zuletzt über alles trösten; wenn sie nur
sich selbst haben. Sonach liegt in ihnen ein isolierendes Element mehr,
welches um so wirksamer ist, als die andern ihnen eigentlich nie vollkommen
genügen, weshalb sie in ihnen nicht ganz und gar ihresgleichen sehn können,
ja, das Heterogene in allem und jedem ihnen stets fühlbar wird, allmählich
sich gewöhnen, unter den Menschen als verschiedenartige Wesen umherzugehn
und, in ihren Gedanken über dieselben, sich der dritten, nicht der ersten
Person Pluralis zu bedienen. —
Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint nun der, welchen die Natur in intellektueller
Hinsicht sehr reich ausgestattet hat, als der Glücklichste; so gewiß
das Subjektive uns näher liegt, als das Objektive, dessen Wirkung, welcher
Art sie auch sei, immer erst durch jenes vermittelt, also nur sekundär
ist. Dies bezeugt auch der schöne Vers:
Πλουτος δ της ψυχης πλουτος μονος εστιν
αληϑης,
Τ̓ ̓αλλα δ ͗ εχει ατην πλειονα των κτεανων.
Lucian. in Anthol. I, 67.
Ein solcher innerlich Reicher bedarf von außen nichts weiter, als eines
negativen Geschenks, nämlich freier Muße, um seine geistigen Fähigkeiten
ausbilden und entwickeln und seinen innern Reichtum genießen zu können,
also eigentlich nur der Erlaubnis, sein ganzes Leben hindurch, jeden Tag
und jede Stunde, ganz er selbst sein zu dürfen. Wenn einer bestimmt ist,
die Spur seines Geistes dem ganzen Menschengeschlechte aufzudrücken;
so gibt es für ihn nur ein Glück oder Unglück, nämlich seine Anlagen
vollkommen ausbilden und seine Werke vollenden zu können, — oder aber
hieran verhindert zu sein. Alles andre ist für ihn geringfügig. Demgemäß
sehn wir die großen Geister aller Zeiten auf freie Muße den allerhöchsten
Wert legen. Denn die freie Muße eines jeden ist so viel wert, wie er
selbst Wert ist. Δοκει δε ή ευδαιμονια εν τη σχολη
ειναι (videtur beatitudo in otio esse sita), sagt Aristoteles (Eth.
Nic. X, 7), und Diogenes Laertius (II, 5, 31) berichtet, daß Σωκρατης
επηνει σχολην, ώς καλλιστον κτηματων (Socrates
otium et possessionum omnium pulcherrimam laudabat). Dem entspricht auch,
daß Aristoteles (Eth. Nic. X, 7, 8, 9) das philosophische Wesen für
das glücklichste erklärt. Sogar gehört hieher, was er in der Politik
(IV, 11) sagt: τον ευδαιμονα βιον ειναι τον κατʹ
αρετην ανεμποδιστον, welches, gründlich übersetzt,
besagt: „seine Trefflichkeit, welcher Art sie auch sei, ungehindert
üben zu können, ist das eigentliche Glück“, und also zusammentrifft
mit Goethes Ausspruch, im Wilh. Meister: „Wer mit einem Talent zu einem
Talent geboren ist, findet in demselben sein schönstes Dasein.“ —
Nun aber ist freie Muße zu besitzen nicht nur dem gewöhnlichen Schicksal,
sondern auch der gewöhnlichen Natur des Menschen fremd: denn seine natürliche
Bestimmung ist, daß er seine Zeit mit Herbeischaffung des zu seiner und
seiner Familie Existenz Notwendigen zubringe. Er ist ein Sohn der Not,
nicht eine freie Intelligenz. Dem entsprechend wird freie Muße dem gewöhnlichen
Menschen bald zur Last, ja, endlich zur Qual, wenn er sie nicht, mittelst
allerlei erkünstelter und fingierter Zwecke, durch Spiel, Zeitvertreib
und Steckenpferde jeder Gestalt auszufüllen vermag: auch bringt sie ihm,
aus demselben Grunde, Gefahr, da es mit Recht heißt difficilis in otio
quies. Andrerseits jedoch ist ein über das normale Maß weit hinausgehender
Intellekt ebenfalls abnorm, also unnatürlich. Ist er dennoch einmal vorhanden,
so bedarf es, für das Glück des damit Begabten, eben jener den andern
bald lästigen, bald verderblichen freien Muße; da er ohne diese ein
Pegasus im Joche, mithin unglücklich sein wird. Treffen nun aber beide
Unnatürlichkeiten, die äußere und die innere, zusammen; so ist es ein
großer Glücksfall: denn jetzt wird der so Begünstigte ein Leben höherer
Art führen, nämlich das eines Eximierten von den beiden entgegengesetzten
Quellen des menschlichen Leidens, der Not und der Langenweile, oder dem
sorglichen Treiben für die Existenz und der Unfähigkeit, die Muße (d.
i. die freie Existenz selbst) zu ertragen, welchen beiden Uebeln der Mensch
sonst nur dadurch entgeht, daß sie selbst sich wechselseitig neutralisieren
und aufheben.
Gegen dieses alles jedoch kommt andrerseits in Betracht, daß die großen
Geistesgaben, infolge der überwiegenden Nerventhätigkeit, eine überaus
gesteigerte Empfindlichkeit für den Schmerz, in jeglicher Gestalt, herbeiführen,
daß ferner das sie bedingende leidenschaftliche Temperament und zugleich
die von ihnen unzertrennliche größere Lebhaftigkeit und Vollkommenheit
aller Vorstellungen eine ungleich größere Heftigkeit der durch diese
erregten Affekte herbeiführt, während es doch überhaupt mehr peinliche
als angenehme Affekte gibt; endlich auch, daß die großen Geistesgaben
ihren Besitzer den übrigen Menschen und ihrem Treiben entfremden, da,
je mehr er an sich selber hat, desto weniger er an ihnen finden kann.
Hundert Dinge, an welchen sie großes Genüge haben, sind ihm schal und
ungenießbar; wodurch denn das überall sich geltend machende Gesetz der
Kompensation vielleicht auch hier in Kraft bleibt; ist doch sogar oft
genug, und nicht ohne Schein, behauptet worden, der geistig beschränkteste
Mensch sei im Grunde der glücklichste; wenngleich keiner ihn um dieses
Glück beneiden mag. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz.
Denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften,
auf die er stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu dem greifen würde,
was er mit so vielen Millionen teilt. Wer bedeutende persönliche Vorzüge
besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig
vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf,
der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das
letzte Mittel, auf die Nation, der er angehört, stolz zu sein: hieran
erholt er sich und ist nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Thorheiten,
die ihr eigen sind, πυξ και λαξ zu verteidigen. Daher wird man
z. B. unter fünfzig Engländern kaum mehr als einen finden, welcher miteinstimmt,
wenn man von der stupiden und degradierenden Bigotterie seiner Nation
mit gebührender Verachtung spricht: der eine aber pflegt ein Mann von
Kopf zu sein. — Die Deutschen sind frei von Nationalstolz und legen
hiedurch einen Beweis der ihnen nachgerühmten Ehrlichkeit ab; vom Gegenteil
aber die unter ihnen, welche einen solchen vorgeben und lächerlicherweise
affektieren; wie dies zumeist die „deutschen Brüder“ und Demokraten
thun, die dem Volke schmeicheln, um es zu verführen. Es heißt zwar,
die Deutschen hätten das Pulver erfunden: ich kann jedoch dieser Meinung
nicht beitreten. Und Lichtenberg frägt: „Warum gibt sich nicht leicht
jemand, der es nicht ist, für einen Deutschen aus, sondern gemeiniglich,
wenn er sich für etwas ausgeben will, für einen Franzosen oder Engländer?“
Uebrigens überwiegt die Individualität bei weitem die Nationalität,
und in einem gegebenen Menschen verdient jene tausendmal mehr Berücksichtigung,
als diese. Dem Nationalcharakter wird, da er von der Menge redet, nie
viel Gutes ehrlicherweise nachzurühmen sein. Vielmehr erscheint nur die
menschliche Beschränktheit, Verkehrtheit und Schlechtigkeit in jedem
Lande in einer andern Form und diese nennt man den Nationalcharakter.
Von einem derselben degoutiert loben wir den andern, bis es uns mit ihm
ebenso ergangen ist. — Jede Nation spottet über die andere, und alle
haben recht. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Offenbar nun könnte zu unserm Glücke, als welches allergrößtenteils
auf Gemütsruhe und Zufriedenheit beruht, kaum irgend etwas so viel beitragen,
als die Einschränkung und Herabstimmung dieser Triebfeder auf ihr vernünftig
zu rechtfertigendes Maß, welches vielleicht ein Fünfzigstel des gegenwärtigen
sein wird, also das Herausziehn dieses immerfort peinigenden Stachels
aus unserm Fleisch. Dies ist jedoch sehr schwer: denn wir haben es mit
einer natürlichen und angeborenen Verkehrtheit zu thun. Etiam sapientibus
cupido gloriae novissima exuitur sagt Tacitus (Hist. IV, 6). Um jene allgemeine
Thorheit los zu werden, wäre das alleinige Mittel, sie deutlich als eine
solche zu erkennen und zu diesem Zwecke sich klar zu machen, wie ganz
falsch, verkehrt, irrig und absurd die meisten Meinungen in den Köpfen
der Menschen zu sein pflegen, daher sie, an sich selbst, keiner Beachtung
wert sind; sodann, wie wenig realen Einfluß auf uns die Meinung anderer,
in den meisten Dingen und Fällen, haben kann; ferner, wie ungünstig
überhaupt sie meistenteils ist, so daß fast jeder sich krank ärgern
würde, wenn er vernähme, was alles von ihm gesagt und in welchem Tone
von ihm geredet wird; endlich, daß sogar die Ehre selbst doch eigentlich
nur von mittelbarem und nicht von unmittelbarem Werte ist u. dgl. m. Wenn
eine solche Bekehrung von der allgemeinen Thorheit uns gelänge; so würde
die Folge ein unglaublich großer Zuwachs an Gemütsruhe und Heiterkeit
und ebenfalls ein festeres und sichereres Auftreten, ein durchweg unbefangeneres
und natürlicheres Betragen sein. Der so überaus wohlthätige Einfluß,
den eine zurückgezogene Lebensweise auf unsere Gemütsruhe hat, beruht
größtenteils darauf, daß eine solche uns dem fortwährenden Leben vor
den Augen anderer, folglich der steten Berücksichtigung ihrer etwanigen
Meinung entzieht und dadurch uns uns selber zurückgibt. Imgleichen würden
wir sehr vielem realen Unglück entgehn, in welches nur jenes rein ideale
Streben, richtiger jene heillose Thorheit, uns zieht, würden auch viel
mehr Sorgfalt für solide Güter übrig behalten und dann auch diese ungestörter
genießen. Aber, wie gesagt, χαλεπα τα καλα. Die hier geschilderte
Thorheit unsrer Natur treibt hauptsächlich drei Sprößlinge: Ehrgeiz,
Eitelkeit und Stolz. Zwischen diesen zwei letzteren beruht der Unterschied
darauf, daß der Stolz die bereits feststehende Ueberzeugung vom eigenen
überwiegenden Werte, in irgend einer Hinsicht, ist; Eitelkeit hingegen
der Wunsch, in andern eine solche Ueberzeugung zu erwecken, meistens begleitet
von der stillen Hoffnung, sie, infolge davon, auch selbst zu der seinigen
machen zu können. Demnach ist Stolz die von innen ausgehende, folglich
direkte Hochschätzung seiner selbst; hingegen Eitelkeit das Streben,
solche von außen her, also indirekt zu erlangen. Dem entsprechend macht
die Eitelkeit gesprächig, der Stolz schweigsam. Aber der Eitele sollte
wissen, daß die hohe Meinung anderer, nach der er trachtet, sehr viel
leichter und sicherer durch anhaltendes Schweigen zu erlangen ist, als
durch Sprechen, auch wenn einer die schönsten Dinge zu sagen hätte.
— Stolz ist nicht wer will, sondern höchstens kann wer will Stolz affektieren,
wird aber aus dieser, wie aus jeder angenommenen Rolle bald herausfallen.
Denn nur die feste, innere, unerschütterliche Ueberzeugung von überwiegenden
Vorzügen und besonderm Werte macht wirklich stolz. Diese Ueberzeugung
mag nun irrig sein, oder auch auf bloß äußerlichen und konventionellen
Vorzügen beruhen, — das schadet dem Stolze nicht, wenn sie nur wirklich
und ernstlich vorhanden ist. Weil also der Stolz seine Wurzel in der Ueberzeugung
hat, steht er, wie alle Erkenntnis, nicht in unsrer Willkür. Sein schlimmster
Feind, ich meine sein größtes Hindernis, ist die Eitelkeit, als welche
um den Beifall anderer buhlt, um die eigene hohe Meinung von sich erst
darauf zu gründen, in welcher bereits ganz fest zu sein die Voraussetzung
des Stolzes ist.
So sehr nun auch durchgängig der Stolz getadelt und verschrieen wird;
so vermute ich doch, daß dies hauptsächlich von solchen ausgegangen
ist, die nichts haben, darauf sie stolz sein könnten. Der Unverschämtheit
und Dummdreistigkeit der meisten Menschen gegenüber, thut jeder, der
irgend welche Vorzüge hat, ganz wohl, sie selbst im Auge zu behalten,
um nicht sie gänzlich in Vergessenheit geraten zu lassen: denn wer, solche
gutmütig ignorierend, mit jenen sich geriert, als wäre er ganz ihresgleichen,
den werden sie treuherzig sofort dafür halten. Am meisten aber möchte
ich solches denen anempfehlen, deren Vorzüge von der höchsten Art, d.
h. reale, und also rein persönliche sind, da diese nicht, wie Orden und
Titel, jeden Augenblick durch sinnliche Einwirkung in Erinnerung gebracht
werden: denn sonst werden sie oft genug das sus Minervam exemplifiziert
sehn. „Scherze mit dem Sklaven; bald wird er dir den Hintern zeigen“
— ist ein vortreffliches arabisches Sprichwort, und das Horazische sume
superbiam, quaesitam meritis ist nicht zu verwerfen. Wohl aber ist die
Tugend der Bescheidenheit eine erkleckliche Erfindung für die Lumpe;
da ihr gemäß jeder von sich zu reden hat, als wäre auch er ein solcher,
welches herrlich nivelliert, indem es dann so herauskommt, als gäbe es
überhaupt nichts als Lumpe. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wenn man hingegen sieht, wie fast alles, wonach Menschen ihr Leben
lang, mit rastloser Anstrengung und unter tausend Gefahren und Mühseligkeiten,
unermüdlich streben, zum letzten Zwecke hat, sich dadurch in der Meinung
anderer zu erhöhen, indem nämlich nicht nur Aemter, Titel und Orden,
sondern auch Reichtum, und selbst Wissenschaft *) und Kunst, im Grunde
und hauptsächlich deshalb angestrebt werden, und der größere Respekt
anderer das letzte Ziel ist, darauf man hinarbeitet; so beweist dies leider
nur die Größe der menschlichen Thorheit. Viel zu viel Wert auf die Meinung
anderer zu legen ist ein allgemein herrschender Irrwahn: mag er nun in
unserer Natur selbst wurzeln, oder infolge der Gesellschaft und Zivilisation
entstanden sein; jedenfalls übt er auf unser gesamtes Thun und Lassen
einen ganz übermäßigen und unserm Glücke feindlichen Einfluß aus,
den wir verfolgen können, von da an, wo er sich in der ängstlichen und
sklavischen Rücksicht auf das qu’en dira-t-on zeigt, bis dahin, wo
er den Dolch des Virginius in das Herz seiner Tochter stößt, oder den
Menschen verleitet, für den Nachruhm, Ruhe, Reichtum und Gesundheit,
ja, das Leben zu opfern. Dieser Wahn bietet allerdings dem, der die Menschen
zu beherrschen, oder sonst zu lenken hat, eine bequeme Handhabe dar; weshalb
in jeder Art von Menschendressierungskunst die Weisung, das Ehrgefühl
rege zu erhalten und zu schärfen, eine Hauptstelle einnimmt: aber in
Hinsicht auf das eigene Glück des Menschen, welches hier unsere Absicht
ist, verhält die Sache sich ganz anders, und ist vielmehr davon abzumahnen,
daß man nicht zu viel Wert auf die Meinung anderer lege. Wenn es, wie
die tägliche Erfahrung lehrt, dennoch geschieht, wenn die meisten Menschen
gerade auf die Meinung anderer von ihnen den höchsten Wert legen und
es ihnen darum mehr zu thun ist, als um das, was, weil es in ihrem eigenen
Bewußtsein vorgeht, unmittelbar für sie vorhanden ist; wenn demnach,
mittelst Umkehrung der natürlichen Ordnung, ihnen jenes der reale, dieses
der bloß ideale Teil ihres Daseins zu sein scheint, wenn sie also das
Abgeleitete und Sekundäre zur Hauptsache machen und ihnen mehr das Bild
ihres Wesens im Kopfe anderer, als dieses Wesen selbst am Herzen liegt;
so ist diese unmittelbare Wertschätzung dessen, was für uns unmittelbar
gar nicht vorhanden ist, diejenige Thorheit, welche man Eitelkeit, vanitas,
genannt hat, um dadurch das Leere und Gehaltlose dieses Strebens zu bezeichnen.
Auch ist aus dem Obigen leicht einzusehn, daß sie zum Vergessen des Zwecks
über die Mittel gehört, so gut wie der Geiz.
In der That überschreitet der Wert, den wir auf die Meinung anderer legen,
und unsere beständige Sorge in betreff derselben, in der Regel, fast
jede vernünftige Bezweckung, so daß sie als eine Art allgemein verbreiteter,
oder vielmehr angeborener Manie angesehen werden kann. Bei allem, was
wir thun und lassen, wird, fast vor allem andern, die fremde Meinung berücksichtigt,
und aus der Sorge um sie werden wir, bei genauer Untersuchung, fast die
Hälfte aller Bekümmernisse und Aengste, die wir jemals empfunden haben,
hervorgegangen sein. Denn sie liegt allem unserm, so oft gekränkten,
weil so krankhaft empfindlichen, Selbstgefühl, allen unsern Eitelkeiten
und Prätensionen, wie auch unserm Prunken und Großthun, zum Grunde.
Ohne diese Sorge und Sucht würde der Luxus kaum ein Zehntel dessen sein,
was er ist. Aller und jeder Stolz, point d`honneur und puntiglio, so verschiedener
Gattung und Sphäre er auch sein kann, beruht auf ihr, — und welche
Opfer heischt sie da nicht oft! Sie zeigt sich schon im Kinde, sodann
in jedem Lebensalter, jedoch am stärkesten im späten; weil dann, beim
Versiegen der Fähigkeit zu sinnlichen Genüssen, Eitelkeit und Hochmut
nur noch mit dem Geize die Herrschaft zu teilen haben. Am deutlichsten
läßt sich dies an den Franzosen beobachten, als bei welchen sie ganz
endemisch ist und sich oft in der abgeschmacktesten Ehrsucht, lächerlichsten
Nationaleitelkeit und unverschämtesten Prahlerei Luft macht; wodurch
dann ihr Streben sich selbst vereitelt, indem es sie zum Spotte der andern
Nationen gemacht hat und die grande nation ein Neckname geworden ist.
Um nun aber die in Rede stehende Verkehrtheit der überschwenglichen Sorge
um die Meinung anderer noch speziell zu erläutern, mag hier ein, durch
den Lichteffekt des Zusammentreffens der Umstände mit dem angemessenen
Charakter, in seltenem Grade begünstigtes, recht superlatives Beispiel
jener in der Menschennatur wurzelnden Thorheit Platz finden, da an demselben
die Stärke dieser höchst wunderlichen Triebfeder sich ganz ermessen
läßt. Es ist folgende, den Times vom 31. März 1846 entnommene Stelle
aus dem ausführlichen Bericht von der soeben vollzogenen Hinrichtung
des Thomas Wix, eines Handwerksgesellen, der aus Rache seinen Meister
ermordet hatte: „An dem zur Hinrichtung festgesetzten Morgen fand sich
der hochwürdige Gefängniskaplan zeitig bei ihm ein. Allein Wix, obwohl
sich ruhig betragend, zeigte keinen Anteil an seinen Ermahnungen: vielmehr
war das einzige, was ihm am Herzen lag, daß es ihm gelingen möchte,
vor den Zuschauern seines schmachvollen Endes, sich mit recht großer
Bravour zu benehmen. — — — Dies ist ihm denn auch gelungen. Auf
dem Hofraum, den er zu dem, hart am Gefängnis errichteten Galgenschafott
zu durchschreiten hatte, sagte er: ̦Wohlan denn, wie Doktor Dodd gesagt
hat, bald werde ich das große Geheimnis wissen!̒ Er ging, obwohl mit
gebundenen Armen, die Leiter zum Schafott ohne die geringste Beihilfe
hinauf: daselbst angelangt machte er gegen die Zuschauer, rechts und links,
Verbeugungen, welche denn auch mit dem donnernden Beifallsruf der versammelten
Menge beantwortet und belohnt wurden, u. s. w.“ — Dies ist ein Prachtexemplar
der Ehrsucht, den Tod, in schrecklichster Gestalt, nebst der Ewigkeit
dahinter, vor Augen, keine andere Sorge zu haben, als die um den Eindruck
auf den zusammengelaufenen Haufen der Gaffer und die Meinung, welche man
in deren Köpfen zurücklassen wird! — Und doch war ebenso der im selben
Jahr in Frankreich, wegen versuchten Königsmordes, hingerichtete Lecomte,
bei seinem Prozeß, hauptsächlich darüber verdrießlich, daß er nicht
in anständiger Kleidung vor der Pairskammer erscheinen konnte, und selbst
bei seiner Hinrichtung war es ihm ein Hauptverdruß, daß man ihm nicht
erlaubt hatte, sich vorher zu rasieren. Daß es auch ehemals nicht anders
gewesen, ersehen wir aus dem, was Mateo Aleman, in der, seinem berühmten
Romane, Guzman de Alfarache vorgesetzten Einleitung (declaracion) anführt,
daß nämlich viele bethörte Verbrecher die letzten Stunden, welche sie
ausschließlich ihrem Seelenheil widmen sollten, diesem entziehn, um eine
kleine Predigt, die sie auf der Galgenleiter halten wollen, auszuarbeiten
und zu memorieren. — An solchen Zügen jedoch können wir selbst uns
spiegeln: denn kolossale Fälle geben überall die deutlichste Erläuterung.
Unser aller Sorgen, Kümmern, Wurmen, Aergern, Aengstigen, Anstrengen
u. s. w. betrifft, in vielleicht den meisten Fällen, eigentlich die fremde
Meinung und ist ebenso absurd, wie das jener armer Sünder. Nicht weniger
entspringt unser Neid und Haß größtenteils aus besagter Wurzel. [...]
*) Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Für unser Lebensglück ist demnach das, was wir sind, die Persönlichkeit,
durchaus das Erste und Wesentlichste; — schon weil sie beständig und
unter allen Umständen wirksam ist: zudem aber ist sie nicht, wie die
Güter der zwei andern Rubriken, dem Schicksal unterworfen, und kann uns
nicht entrissen werden. Ihr Wert kann insofern ein absoluter heißen,
im Gegensatz des bloß relativen der beiden andern. Hieraus nun folgt,
daß dem Menschen von außen viel weniger beizukommen ist, als man wohl
meint. Bloß die allgewaltige Zeit übt auch hier ihr Recht: ihr unterliegen
allmählich die körperlichen und die geistigen Vorzüge: der moralische
Charakter allein bleibt auch ihr unzugänglich. In dieser Hinsicht hätten
denn freilich die Güter der zwei letztern Rubriken, als welche die Zeit
unmittelbar nicht raubt, vor denen der ersten einen Vorzug. Einen zweiten
könnte man darin finden, daß sie, als im Objektiven gelegen, ihrer Natur
nach, erreichbar sind und jedem wenigstens die Möglichkeit vorliegt,
in ihren Besitz zu gelangen; während hingegen das Subjektive gar nicht
in unsere Macht gegeben ist, sondern, jure divino eingetreten, für das
ganze Leben unveränderlich feststeht; so daß hier unerbittlich der Ausspruch
gilt:
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen,
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Goethe.
Das einzige, was in dieser Hinsicht in unserer Macht steht, ist, daß
wir die gegebene Persönlichkeit zum möglichsten Vorteile benutzen, demnach
nur die ihr entsprechenden Bestrebungen verfolgen und uns um die Art von
Ausbildung bemühen, die ihr gerade angemessen ist, jede andere aber meiden,
folglich den Stand, die Beschäftigung, die Lebensweise wählen, welche
zu ihr passen.
Ein herkulischer, mit ungewöhnlicher Muskelkraft begabter Mensch, der
durch äußere Verhältnisse genötigt ist, einer sitzenden Beschäftigung,
einer kleinlichen, peinlichen Handarbeit obzuliegen, oder auch Studien
und Kopfarbeiten zu treiben, die ganz anderartige, bei ihm zurückstehende
Kräfte erfordern, folglich gerade die bei ihm ausgezeichneten Kräfte
unbenutzt zu lassen, der wird sich zeitlebens unglücklich fühlen; noch
mehr aber der, bei dem die intellektuellen Kräfte sehr überwiegend sind,
und der sie unentwickelt und ungenutzt lassen muß, um ein gemeines Geschäft
zu treiben, das ihrer nicht bedarf, oder gar körperliche Arbeit, zu der
seine Kraft nicht recht ausreicht. Jedoch ist hier, zumal in der Jugend,
die Klippe der Präsumtion zu vermeiden, daß man sich nicht ein Uebermaß
von Kräften zuschreibe, welches man nicht hat.
Aus dem entschiedenen Uebergewicht unsrer ersten Rubrik über die beiden
andern geht aber auch hervor, daß es weiser ist, auf Erhaltung seiner
Gesundheit und auf Ausbildung seiner Fähigkeiten, als auf Erwerbung von
Reichtum hinzuarbeiten; was jedoch nicht dahin mißdeutet werden darf,
daß man den Erwerb des Nötigen und Angemessenen vernachlässigen sollte.
Aber eigentlicher Reichtum, d. h. großer Ueberfluß, vermag wenig zu
unserm Glück; daher viele Reiche sich unglücklich fühlen; weil sie
ohne eigentliche Geistesbildung, ohne Kenntnisse und deshalb ohne irgend
ein objektives Interesse, welches sie zu geistiger Beschäftigung befähigen
könnte, sind. Denn was der Reichtum über die Befriedigung der wirklichen
und natürlichen Bedürfnisse hinaus noch leisten kann ist von geringem
Einfluß auf unser eigentliches Wohlbehagen: vielmehr wird dieses gestört
durch die vielen und unvermeidlichen Sorgen, welche die Erhaltung eines
großen Besitzes herbeiführt. Dennoch aber sind die Menschen tausendmal
mehr bemüht, sich Reichtum, als Geistesbildung zu erwerben; während
doch ganz gewiß was man ist, viel mehr zu unserm Glücke beiträgt, als
was man hat. Gar manchen daher sehn wir, in rastloser Geschäftigkeit,
emsig wie die Ameise, vom Morgen bis zum Abend bemüht, den schon vorhandenen
Reichtum zu vermehren. Ueber den engen Gesichtskreis des Bereichs der
Mittel hiezu hinaus kennt er nichts: sein Geist ist leer, daher für alles
andere unempfänglich. Die höchsten Genüsse, die geistigen, sind ihm
unzugänglich: durch die flüchtigen, sinnlichen, wenig Zeit, aber viel
Geld kostenden, die er zwischendurch sich erlaubt, sucht er vergeblich
jene andern zu ersetzen. Am Ende seines Lebens hat er dann, als Resultat
desselben, wenn das Glück gut war, wirklich einen recht großen Haufen
Geld vor sich, welchen noch zu vermehren, oder aber durchzubringen, er
jetzt seinen Erben überläßt. Ein solcher, wiewohl mit gar ernsthafter
und wichtiger Miene durchgeführter Lebenslauf ist daher ebenso thöricht,
wie mancher andere, der geradezu die Schellenkappe zum Symbol hatte.
Also was einer an sich selber hat ist zu seinem Lebensglücke das Wesentlichste.
Bloß weil dieses, in der Regel, so gar wenig ist, fühlen die meisten
von denen, welche über den Kampf mit der Not hinaus sind, sich im Grunde
ebenso unglücklich, wie die, welche sich noch darin herumschlagen. Die
Leere ihres Innern, das Fade ihres Bewußtseins, die Armut ihres Geistes
treibt sie zur Gesellschaft, die nun aber aus eben solchen besteht; weil
similis simili gaudet. Da wird dann gemeinschaftlich Jagd gemacht auf
Kurzweil und Unterhaltung, die sie zunächst in sinnlichen Genüssen,
in Vergnügungen jeder Art und endlich in Ausschweifungen suchen. Die
Quelle der heillosen Verschwendung, mittelst welcher so mancher, reich
ins Leben tretende Familiensohn sein großes Erbteil, oft in unglaublich
kurzer Zeit, durchbringt, ist wirklich keine andere, als nur die Langeweile,
welche aus der eben geschilderten Armut und Leere des Geistes entspringt.
So ein Jüngling war äußerlich reich, aber innerlich arm in die Welt
geschickt und strebte nun vergeblich, durch den äußern Reichtum den
innern zu ersetzen, indem er alles von außen empfangen wollte, — den
Greisen analog, welche sich durch die Ausdünstung junger Mädchen zu
stärken suchen. Dadurch führte denn am Ende die innere Armut auch noch
die äußere herbei.
Die Wichtigkeit der beiden andern Rubriken der Güter des menschlichen
Lebens brauche ich nicht hervorzuheben. Denn der Wert des Besitzes ist
heutzutage so allgemein anerkannt, daß er keiner Empfehlung bedarf. Sogar
hat die dritte Rubrik, gegen die zweite, eine sehr ätherische Beschaffenheit;
da sie bloß in der Meinung anderer besteht. Jedoch nach Ehre, d. h. gutem
Namen, hat jeder zu streben, nach Rang schon nur die, welche dem Staate
dienen, und nach Ruhm gar nur äußerst wenige. Indessen wird die Ehre
als ein unschätzbares Gut angesehn, und der Ruhm als das Köstlichste,
was der Mensch erlangen kann, das goldene Vließ der Auserwählten: hingegen
den Rang werden nur Thoren dem Besitze vorziehn. Die zweite und dritte
Rubrik stehn übrigens in sogenannter Wechselwirkung; sofern das habes,
habeberis des Petronius seine Richtigkeit hat und, umgekehrt, die günstige
Meinung anderer, in allen ihren Formen, oft zum Besitze verhilft.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Der Ruhm beruht eigentlich auf dem, was einer im Vergleich mit den
übrigen ist. Demnach ist er wesentlich ein Relatives, kann daher auch
nur relativen Wert haben. Er fiele ganz weg, wenn die übrigen würden,
was der Gerühmte ist. Absoluten Wert kann nur das haben, was ihn unter
allen Umständen behält, also hier, was einer unmittelbar und für sich
selbst ist: folglich muß hierin der Wert und das Glück des großen Herzens
und des großen Kopfes liegen. Also nicht der Ruhm, sondern das, wodurch
man ihn verdient, ist das Wertvolle. Denn es ist gleichsam die Substanz
und der Ruhm nur das Accidens der Sache: ja dieser wirkt auf den Gerühmten
hauptsächlich als ein äußerliches Symptom, durch welches er die Bestätigung
seiner eigenen hohen Meinung von sich selbst erhält; demnach man sagen
könnte, daß, wie das Licht gar nicht sichtbar ist, wenn es nicht von
einem Körper zurückgeworfen wird; ebenso jede Trefflichkeit erst durch
den Ruhm ihrer selbst recht gewiß wird. Allein er ist nicht einmal ein
untrügliches Symptom, da es auch Ruhm ohne Verdienst und Verdienst ohne
Ruhm gibt; weshalb ein Ausdruck Lessings so artig herauskommt: „Einige
Leute sind berühmt, und andre verdienen es zu sein.“ Auch wäre es
eine elende Existenz, deren Wert oder Unwert darauf beruhte, wie sie in
den Augen andrer erschiene: eine solche aber wäre das Leben des Helden
und des Genies, wenn dessen Wert im Ruhme, d. h. im Beifall andrer, bestände.
Vielmehr lebt und existiert ja jegliches Wesen seiner selbst wegen, daher
auch zunächst in sich und für sich. — Was einer ist, in welcher Art
und Weise es auch sei, das ist er zuvörderst und hauptsächlich für
sich selbst: und wenn es hier nicht viel wert ist, so ist es überhaupt
nicht viel. Hingegen ist das Abbild seines Wesens in den Köpfen andrer
ein sekundäres, abgeleitetes und dem Zufall unterworfenes, welches nur
sehr mittelbar sich auf das erstere zurückbezieht. Zudem sind die Köpfe
der Menge ein zu elender Schauplatz, als daß auf ihm das wahre Glück
seinen Ort haben könnte. Vielmehr ist daselbst nur ein chimärisches
Glück zu finden. Welche gemischte Gesellschaft trifft doch in jenem Tempel
des allgemeinen Ruhms zusammen! Feldherren, Minister, Quacksalber, Gaukler,
Tänzer, Sänger, Millionäre und Juden: ja, die Vorzüge aller dieser
werden dort viel aufrichtiger geschätzt, finden viel mehr estime sentie,
als die geistigen, zumal der hohen Art, die ja bei der großen Mehrzahl
nur eine estime sur parole erlangen. In eudämonologischer Hinsicht ist
also der Ruhm nichts weiter, als der seltenste und köstlichste Bissen
für unsern Stolz und unsre Eitelkeit. Diese aber sind in den meisten
Menschen, obwohl sie es verbergen, übermäßig vorhanden, vielleicht
sogar am stärksten in denen, die irgendwie geeignet sind, sich Ruhm zu
erwerben und daher meistens das unsichere Bewußtsein ihres überwiegenden
Wertes lange in sich herumtragen müssen, ehe die Gelegenheit kommt, solchen
zu erproben und dann die Anerkennung desselben zu erfahren: bis dahin
war ihnen zu Mute, als erlitten sie ein heimliches Unrecht *). Ueberhaupt
aber ist ja, wie am Anfange dieses Kapitels erörtert worden, der Wert,
den der Mensch auf die Meinung andrer von ihm legt, ganz unverhältnismäßig
und unvernünftig, so daß Hobbes die Sache zwar sehr stark, aber vielleicht
doch richtig ausgedrückt hat in den Worten: Omnis animi voluptas, omnisque
alacritas in eo sita est, quod quis habeat quibuscum conferens se, possit
magnifice sentire de se ipso (De cive I, 5). Hieraus ist der hohe Wert
erklärlich, den man allgemein auf den Ruhm legt, und die Opfer, welche
man bringt, in der bloßen Hoffnung, ihn dereinst zu erlangen:
Fame is the spur, that the clear spirit doth raise
(That last infirmity of noble minds)
To scorn delights and live laborious days.
wie auch:
how hard it is to climb The hights where Fame’s proud temple shines
afar.
Hieraus endlich erklärt es sich auch, daß die eitelste aller Nationen
beständig la gloire im Munde führt und solche unbedenklich als die Haupttriebfeder
zu großen Thaten und großen Werken ansieht. — Allein da unstreitig
der Ruhm nur das Sekundäre ist, das bloße Echo, Abbild, Schatten, Symptom
des Verdienstes, und da jedenfalls das Bewunderte mehr Wert haben muß,
als die Bewunderung; so kann das eigentlich Beglückende nicht im Ruhme
liegen, sondern in dem, wodurch man ihn erlangt, also im Verdienste selbst,
oder, genauer zu reden, in der Gesinnung und den Fähigkeiten, aus denen
es hervorging; es mag nun moralischer oder intellektueller Art sein. Denn
das Beste, was jeder ist, muß er notwendig für sich selbst sein: was
davon in den Köpfen andrer sich abspiegelt und er in ihrer Meinung gilt,
ist Nebensache und kann nur von untergeordnetem Interesse für ihn sein.
Wer demnach nur den Ruhm verdient, auch ohne ihn zu erhalten, besitzt
bei weitem die Hauptsache, und was er entbehrt, ist etwas, darüber er
sich mit derselben trösten kann. Denn nicht daß einer von der urteilslosen,
so oft bethörten Menge für einen großen Mann gehalten werde, sondern
daß er es sei, macht ihn beneidenswert; auch nicht, daß die Nachwelt
von ihm erfahre, sondern daß in ihm sich Gedanken erzeugen, welche verdienen,
Jahrhunderte hindurch aufbewahrt und nachgedacht zu werden, ist ein hohes
Glück. Zudem kann dieses ihm nicht entrissen werden: es ist των εφ͗̓
ήμιν, jenes andere των ουκ εφ͗ ήμιν. Wäre hingegen die
Bewunderung selbst die Hauptsache, so wäre das Bewunderte ihrer nicht
wert. Dies ist wirklich der Fall beim falschen, d. i. unverdienten Ruhm.
An diesem muß sein Besitzer zehren, ohne das, wovon derselbe das Symptom,
der bloße Abglanz, sein soll, wirklich zu haben. Aber sogar dieser Ruhm
selbst muß ihm oft verleidet werden, wann bisweilen, trotz aller, aus
der Eigenliebe entspringenden Selbsttäuschung, ihm auf der Höhe, für
die er nicht geeignet ist, doch schwindelt, oder ihm zu Mute wird, als
wäre er ein kupferner Dukaten; wo dann die Angst vor Enthüllung und
verdienter Demütigung ihn ergreift, zumal wann er auf den Stirnen der
Weiseren schon das Urteil der Nachwelt liest. Er gleicht sonach dem Besitzer
durch ein falsches Testament. — Den echtesten Ruhm, den Nachruhm, vernimmt
sein Gegenstand ja nie, und doch schätzt man ihn glücklich. Also bestand
sein Glück in den großen Eigenschaften selbst, die ihm den Ruhm erwarben,
und darin, daß er Gelegenheit fand, sie zu entwickeln, also daß ihm
vergönnt wurde, zu handeln, wie es ihm angemessen war, oder zu treiben,
was er mit Lust und Liebe trieb: denn nur die aus dieser entsprungenen
Werke erlangen Nachruhm. Sein Glück bestand also in seinem großen Herzen
oder auch im Reichtum eines Geistes, dessen Abdruck in seinen Werken die
Bewunderung kommender Jahrhunderte erhält; es bestand in den Gedanken
selbst, welchen nachzudenken die Beschäftigung und der Genuß der edelsten
Geister einer unabsehbaren Zukunft ward. Der Wert des Nachruhms liegt
also im Verdienen desselben, und dieses ist sein eigener Lohn. Ob nun
die Werke, welche ihn erwarben, unterweilen auch den Ruhm der Zeitgenossen
hatten, hing von zufälligen Umständen ab und war nicht von großer Bedeutung.
Denn da die Menschen in der Regel ohne eigenes Urteil sind und zumal hohe
und schwierige Leistungen abzuschätzen durchaus keine Fähigkeit haben;
so folgen sie hier stets fremder Auktorität, und der Ruhm, in hoher Gattung,
beruht bei neunundneunzig unter hundert Rühmern bloß auf Treu und Glauben.
Daher kann auch der vielstimmigste Beifall der Zeitgenossen für denkende
Köpfe nur wenig Wert haben, indem sie in ihm stets nur das Echo weniger
Stimmen hören, die zudem selbst nur sind, wie der Tag sie gebracht hat.
Würde wohl ein Virtuose sich geschmeichelt fühlen durch das laute Beifallsklatschen
seines Publikums, wenn ihm bekannt wäre, daß es, bis auf einen oder
zwei, aus lauter völlig Tauben bestände, die, um einander gegenseitig
ihr Gebrechen zu verbergen, eifrig klatschen, sobald sie die Hände jenes
einen in Bewegung sähen? Und nun gar, wenn die Kenntnis hinzukäme, daß
jene Vorklatscher sich oft bestechen ließen, um dem elendesten Geiger
den lautesten Applaus zu verschaffen! — Hieraus ist erklärlich, warum
der Ruhm der Zeitgenossen so selten die Metamorphose in Nachruhm erlebt;
weshalb d’Alembert, in seiner überaus schönen Beschreibung des Tempels
des litterarischen Ruhmes, sagt: „Das Innere des Tempels ist von lauter
Toten bewohnt, die während ihres Lebens nicht darin waren, und von einigen
Lebenden, welche fast alle, wann sie sterben, hinausgeworfen werden.“
Und beiläufig sei es hier bemerkt, daß einem bei Lebzeiten ein Monument
setzen die Erklärung ablegen heißt, daß hinsichtlich seiner der Nachwelt
nicht zu trauen sei. — [...]
*) Da unser größtes Vergnügen darin besteht, bewundert zu werden, die
Bewunderer aber, selbst wo alle Ursache wäre, sich ungern dazu herbeilassen;
so ist der Glücklichste der, welcher, gleichviel wie, es dahin gebracht
hat, sich selbst aufrichtig zu bewundern. Nur müssen die andern ihn nicht
irre machen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Wenn dennoch einer den Ruhm, welcher zum Nachruhm werden soll, erlebt,
so wird es selten früher, als im Alter geschehn: allenfalls gibt es bei
Künstlern und Dichtern Ausnahmen von dieser Regel, am wenigsten bei Philosophen.
Eine Bestätigung derselben geben die Bildnisse der durch ihre Werke berühmten
Männer, da dieselben meistens erst nach dem Eintritt ihrer Celebrität
angefertigt wurden: in der Regel sind sie alt und grau dargestellt, namentlich
die Philosophen. Inzwischen steht, eudämonologisch genommen, die Sache
ganz recht. Ruhm und Jugend auf einmal ist zu viel für einen Sterblichen.
Unser Leben ist so arm, daß seine Güter haushälterischer verteilt werden
müssen. Die Jugend hat vollauf an ihrem eigenen Reichtum und kann sich
daran genügen lassen. Aber im Alter, wann alle Genüsse und Freuden,
wie die Bäume im Winter, abgestorben sind, dann schlägt am gelegensten
der Baum des Ruhmes aus, als ein echtes Wintergrün: auch kann man ihn
den Winterbirnen vergleichen, die im Sommer wachsen, aber im Winter genossen
werden. Im Alter gibt es keinen schönern Trost, als daß man die ganze
Kraft seiner Jugend Werken einverleibt hat, die nicht mit altern.
Wollen wir jetzt noch etwas näher die Wege betrachten, auf welchen man,
in den Wissenschaften, als dem uns zunächst Liegenden, Ruhm erlangt;
so läßt sich hier folgende Regel aufstellen. Die durch solchen Ruhm
bezeichnete intellektuelle Ueberlegenheit wird allemal an den Tag gelegt
durch eine neue Kombination irgendwelcher Data. Diese nun können sehr
verschiedener Art sein; jedoch wird der durch ihre Kombination zu erlangende
Ruhm um so größer und ausgebreiteter sein, je mehr sie selbst allgemein
bekannt und jedem zugänglich sind. Bestehn z. B. die Data in einigen
Zahlen, oder Kurven, oder auch in irgend einer speziellen physikalischen,
zoologischen, botanischen, oder anatomischen Thatsache, oder auch in einigen
verdorbenen Stellen alter Autoren, oder in halbverlöschten Inschriften,
oder in solchen, deren Alphabet uns fehlt, oder in dunkeln Punkten der
Geschichte; so wird der durch die richtige Kombination derselben zu erlangende
Ruhm sich nicht viel weiter erstrecken, als die Kenntnis der Data selbst,
also auf eine kleine Anzahl meistens zurückgezogen lebender und auf den
Ruhm in ihrem Fach neidischer Leute. — Sind hingegen die Data solche,
welche das ganze Menschengeschlecht kennt, sind es z. B. wesentliche,
allen gemeinsame Eigenschaften des menschlichen Verstandes, oder Gemütes,
oder Naturkräfte, deren ganze Wirkungsart wir beständig vor Augen haben,
oder der allbekannte Lauf der Natur überhaupt; so wird der Ruhm, durch
eine neue, wichtige und evidente Kombination Licht über sie verbreitet
zu haben, sich mit der Zeit fast über die ganze zivilisierte Welt erstrecken.
Denn, sind die Data jedem zugänglich, so wird ihre Kombination es meistens
auch sein. — Dennoch wird hiebei der Ruhm allemal nur der überwundenen
Schwierigkeit entsprechen. Denn, je allbekannter die Data sind, desto
schwerer ist es, sie auf eine neue und doch richtige Weise zu kombinieren;
da schon eine überaus große Anzahl von Köpfen sich an ihnen versucht
und die möglichen Kombinationen derselben erschöpft hat. Hingegen werden
Data, welche, dem großen Publiko unzugänglich, nur auf mühsamen und
schwierigen Wegen erreichbar sind, fast immer noch neue Kombinationen
zulassen: wenn man daher an solche nur mit geradem Verstande und gesunder
Urteilskraft, also einer mäßigen geistigen Ueberlegenheit, kommt; so
ist es leicht möglich, daß man eine neue und richtige Kombination derselben
zu machen das Glück habe. Allein der hiedurch erworbene Ruhm wird ungefähr
dieselben Grenzen haben, wie die Kenntnis der Data. Denn zwar erfordert
die Lösung von Problemen solcher Art großes Studium und Arbeit, schon
um nur die Kenntnis der Data zu erlangen; während in jener andern Art,
in welcher eben der größte und ausgebreiteteste Ruhm zu erwerben ist,
die Data unentgeltlich gegeben sind: allein in dem Maße, wie diese letztere
Art weniger Arbeit erfordert, gehört mehr Talent, ja Genie dazu, und
mit diesen hält, hinsichtlich des Wertes und der Wertschätzung, keine
Arbeit, oder Studium, den Vergleich aus.
Hieraus nun ergibt sich, daß die, welche einen tüchtigen Verstand und
ein richtiges Urteil in sich spüren, ohne jedoch die höchsten Geistesgaben
sich zuzutrauen, viel Studium und ermüdende Arbeit nicht scheuen dürfen,
um mittelst dieser sich aus dem großen Haufen der Menschen, welchen die
allbekannten Data vorliegen, herauszuarbeiten und zu den entlegeneren
Orten zu gelangen, welche nur dem gelehrten Fleiße zugänglich sind.
Denn hier, wo die Zahl der Mitbewerber unendlich verringert ist, wird
der auch nur einigermaßen überlegene Kopf bald zu einer neuen und richtigen
Kombination der Data Gelegenheit finden: sogar wird das Verdienst seiner
Entdeckung sich mit auf die Schwierigkeit, zu den Datis zu gelangen, stützen.
Aber der also erworbene Applaus seiner Wissensgenossen, als welche die
alleinigen Kenner in diesem Fache sind, wird von der großen Menge der
Menschen nur von weitem vernommen werden. — Will man nun den hier angedeuteten
Weg bis zum Extrem verfolgen; so läßt sich der Punkt nachweisen, wo
die Data, wegen der großen Schwierigkeit ihrer Erlangung, für sich allein
und ohne daß eine Kombination derselben erfordert wäre, den Ruhm zu
begründen hinreichen. Dies leisten Reisen in sehr entlegene und wenig
besuchte Länder: man wird berühmt durch das, was man gesehn, nicht durch
das, was man gedacht hat. Dieser Weg hat auch noch einen großen Vorteil
darin, daß es viel leichter ist, was man gesehn, als was man gedacht
hat, andern mitzuteilen, und es mit dem Verständnis sich ebenso verhält:
demgemäß wird man für das erstere auch viel mehr Leser finden, als
für das andere. Denn, wie schon Asmus sagt:
„Wenn jemand eine Reise thut,
So kann er was erzählen.“
Diesem allen entspricht es aber auch, daß, bei der persönlichen Bekanntschaft
berühmter Leute dieser Art einem oft die Horazische Bemerkung einfällt:
Coelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt.
(Epist. I, 11, v. 27.)
Was aber nun andrerseits den mit hohen Fähigkeiten ausgestatteten Kopf
betrifft, als welcher allein sich an die Lösung der großen, das Allgemeine
und Ganze betreffenden und daher schwierigsten Probleme wagen darf; so
wird dieser zwar wohl daran thun, seinen Horizont möglichst auszudehnen,
jedoch immer gleichmäßig, nach allen Seiten, und ohne je sich zu weit
in irgend eine der besondern und nur wenigen bekannten Regionen zu verlieren,
d. h. ohne auf die Spezialitäten irgend einer einzelnen Wissenschaft
weit einzugehen, geschweige sich mit den Mikrologien zu befassen. Denn
er hat nicht nötig, sich an die schwer zugänglichen Gegenstände zu
machen, um dem Gedränge der Mitbewerber zu entgehn; sondern eben das
Allen Vorliegende wird ihm Stoff zu neuen, wichtigen und wahren Kombinationen
geben. Dem nun aber gemäß wird sein Verdienst von allen denen geschätzt
werden können, welchen die Data bekannt sind, also von einem großen
Teile des menschlichen Geschlechts. Hierauf gründet sich der mächtige
Unterschied zwischen dem Ruhm, den Dichter und Philosophen erlangen, und
dem, welcher Physikern, Chemikern, Anatomen, Mineralogen, Zoologen, Philologen,
Historikern u. s. w. erreichbar ist.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ich bin über die ritterliche Ehre weitläufig gewesen, aber in
guter Absicht und weil gegen die moralischen und intellektuellen Ungeheuer
auf dieser Welt der alleinige Herkules die Philosophie ist. Zwei Dinge
sind es hauptsächlich, welche den gesellschaftlichen Zustand der neuen
Zeit von dem des Altertums, zum Nachteil des ersteren unterscheiden, indem
sie demselben einen ernsten, finstern, sinistern Anstrich gegeben haben,
von welchem frei das Altertum heiter und unbefangen, wie der Morgen des
Lebens, dasteht. Sie sind: das ritterliche Ehrenprinzip und die venerische
Krankheit, — par nobile fratrum! Sie zusammen haben νεικος και
φιλια des Lebens vergiftet. Die venerische Krankheit nämlich erstreckt
ihren Einfluß viel weiter, als es auf den ersten Blick scheinen möchte,
indem derselbe keineswegs ein bloß physischer, sondern auch ein moralischer
ist. Seitdem Amors Köcher auch vergiftete Pfeile führt, ist in das Verhältnis
der Geschlechter zu einander ein fremdartiges, feindseliges, ja teuflisches
Element gekommen; infolge wovon ein finsteres und furchtsames Mißtrauen
es durchzieht; und der mittelbare Einfluß einer solchen Aenderung in
der Grundfeste aller menschlichen Gemeinschaft erstreckt sich, mehr oder
weniger, auch auf die übrigen geselligen Verhältnisse; welches auseinanderzusetzen
mich hier zu weit abführen würde. — Analog, wiewohl ganz anderartig,
ist der Einfluß des ritterlichen Ehrenprinzips, dieser ernsthaften Posse,
welche den Alten fremd war, hingegen die moderne Gesellschaft steif, ernst
und ängstlich macht, schon weil jede flüchtige Aeußerung skrutiniert
und ruminiert wird. Aber mehr als dies! Jenes Prinzip ist ein allgemeiner
Minotaur, dem nicht, wie dem antiken, von einem, sondern von jedem Lande
in Europa, alljährlich eine Anzahl Söhne edler Häuser zum Tribut gebracht
werden muß. Daher ist es an der Zeit, daß diesem Popanz einmal kühn
zu Leibe gegangen werde, wie hier geschehn. Möchten doch beide Monstra
der neueren Zeit im 19. Jahrhundert ihr Ende finden! Wir wollen die Hoffnung
nicht aufgeben, daß es mit dem ersteren den Aerzten, mittelst der Prophylaktika,
endlich doch noch gelingen werde. Den Popanz aber abzuthun ist Sache des
Philosophen, mittelst Berichtigung der Begriffe, da es den Regierungen,
mittelst Handhabung der Gesetze, bisher nicht hat gelingen wollen, zudem
auch nur auf dem ersteren Wege das Uebel an der Wurzel angegriffen wird.
Sollte es inzwischen den Regierungen mit der Abstellung des Duellwesens
wirklich Ernst sein und der geringe Erfolg ihres Bestrebens wirklich nur
an ihrem Unvermögen liegen; so will ich ihnen ein Gesetz vorschlagen,
für dessen Erfolg ich einstehe, und zwar ohne blutige Operationen, ohne
Schafott, oder Galgen, oder lebenswierige Einsperrungen, zu Hilfe zu nehmen.
Vielmehr ist es ein kleines, ganz leichtes, homöopathisches Mittelchen:
wer einen andern herausfordert, oder sich stellt, erhält, à la Chinoise,
am hellen Tage, vor der Hauptwache, zwölf Stockschläge vom Korporal,
die Kartellträger und Sekundanten jeder sechs. Wegen der etwanigen Folgen
wirklich vollzogener Duelle bliebe das gewöhnliche kriminelle Verfahren.
Vielleicht würde ein ritterlich Gesinnter mir einwenden, daß nach Vollstreckung
solcher Strafe mancher „Mann von Ehre“ im stande sein könnte, sich
totzuschießen; worauf ich antworte: es ist besser, daß so ein Narr sich
selber totschießt, als andere. — Im Grunde aber weiß ich sehr wohl,
daß es den Regierungen mit der Abstellung der Duelle nicht Ernst ist.
Die Gehalte der Zivilbeamten, noch viel mehr aber die der Offiziere, stehen
(von den höchsten Stellen abgesehn) weit unter dem Wert ihrer Leistungen.
Zur andern Hälfte werden sie daher mit der Ehre bezahlt. Diese wird zunächst
durch Titel und Orden vertreten, im weiteren Sinne durch die Standesehre
überhaupt. Für diese Standesehre nun ist das Duell ein brauchbares Handpferd;
daher es auch schon auf den Universitäten seine Vorschule hat. Die Opfer
desselben bezahlen demnach mit ihrem Blut das Defizit der Gehalte. —
Der Vollständigkeit wegen sei hier noch die Nationalehre erwähnt. Sie
ist die Ehre eines ganzen Volkes als Teiles der Völkergemeinschaft. Da
es in dieser kein anderes Forum gibt, als das der Gewalt, und demnach
jedes Mitglied derselben seine Rechte selbst zu schützen hat; so besteht
die Ehre einer Nation nicht allein in der erworbenen Meinung, daß ihr
zu trauen sei (Kredit), sondern auch in der, daß sie zu fürchten sei:
daher darf sie Eingriffe in ihre Rechte niemals ungeahndet lassen. Sie
vereinigt also den Ehrenpunkt der bürgerlichen mit dem der ritterlichen
Ehre. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Abgesehn von diesem Ursprunge des ritterlichen Ehrenprinzips, ist
seine Tendenz zunächst diese, daß man, durch Androhung physischer Gewalt,
die äußerlichen Bezeigungen derjenigen Achtung erzwingen will, welche
wirklich zu erwerben man entweder für zu beschwerlich, oder für überflüssig
hält. Dies ist ungefähr so, wie wenn jemand, die Kugel des Thermometers
mit der Hand erwärmend, am Steigen des Quecksilbers darthun wollte, daß
sein Zimmer wohlgeheizt sei. Näher betrachtet ist der Kern der Sache
dieser: wie die bürgerliche Ehre, als welche den friedlichen Verkehr
mit andern im Auge hat, in der Meinung dieser von uns besteht, daß wir
vollkommenes Zutrauen verdienen, weil wir die Rechte eines jeden unbedingt
achten; so besteht die ritterliche Ehre in der Meinung von uns, daß wir
zu fürchten seien, weil wir unsere eigenen Rechte unbedingt zu verteidigen
gesonnen sind. Der Grundsatz, daß es wesentlicher sei, gefürchtet zu
werden, als Zutrauen zu genießen, würde auch, weil auf die Gerechtigkeit
der Menschen wenig zu bauen ist, so gar falsch nicht sein, wenn wir im
Naturzustande lebten, wo jeder sich selbst zu schützen und seine Rechte
unmittelbar zu verteidigen hat. Aber im Stande der Zivilisation, wo der
Staat den Schutz unserer Person und unseres Eigentums übernommen hat,
findet er keine Anwendung mehr, und steht da, wie die Burgen und Warten
aus den Zeiten des Faustrechts, unnütz und verlassen, zwischen wohlbebauten
Feldern und belebten Landstraßen, oder gar Eisenbahnen. Demgemäß hat
denn auch die ihn festhaltende ritterliche Ehre sich auf solche Beeinträchtigungen
der Person geworfen, welche der Staat nur leicht, oder, nach dem Prinzip
de minimis lex non curat, gar nicht bestraft, indem es unbedeutende Kränkungen
und zum Teil bloße Neckereien sind. Sie aber hat in Hinsicht auf diese
sich hinaufgeschroben zu einer der Natur, der Beschaffenheit und dem Lose
des Menschen gänzlich unangemessenen Ueberschätzung des Wertes der eigenen
Person, als welchen sie bis zu einer Art von Heiligkeit steigert und demnach
die Strafe des Staates für kleine Kränkungen derselben durchaus unzulänglich
findet, solche daher selbst zu strafen übernimmt und zwar stets am Leibe
und Leben des Beleidigers. Offenbar liegt hier der unmäßigste Hochmut
und die empörendeste Hoffart zum Grunde, welche, ganz vergessend was
der Mensch eigentlich ist, eine unbedingte Unverletzlichkeit, wie auch
Tadellosigkeit, für ihn in Anspruch nehmen. Allein jeder, der diese mit
Gewalt durchzusetzen gesonnen ist und demzufolge die Maxime proklamiert:
„Wer mich schimpft, oder gar mir einen Schlag gibt, soll des Todes sein,“
— verdient eigentlich schon darum aus dem Lande verwiesen zu werden
*). Da wird denn, zur Beschönigung jenes vermessenen Uebermutes, allerhand
vorgegeben. Von zwei unerschrockenen Leuten, heißt es, gebe keiner je
nach, daher es vom leisesten Anstoß zu Schimpfreden, dann zu Prügeln
und endlich zum Totschlag kommen würde; demnach sei es besser, anstandshalber
die Mittelstufen zu überspringen und gleich an die Waffen zu gehn. Das
speziellere Verfahren hiebei hat man dann in ein steifes, pedantisches
System, mit Gesetzen und Regeln, gebracht, welches die ernsthafteste Posse
von der Welt ist und als ein wahrer Ehrentempel der Narrheit dasteht.
Nun aber ist der Grundsatz selbst falsch: bei Sachen von geringer Wichtigkeit
(die von großer bleiben stets den Gerichten anheimgestellt) gibt von
zwei unerschrockenen Leuten allerdings einer nach, nämlich der Klügste,
und bloße Meinungen läßt man auf sich beruhen. Den Beweis hievon liefert
das Volk, oder vielmehr alle die zahlreichen Stände, welche sich nicht
zum ritterlichen Ehrenprinzip bekennen, bei denen daher die Streitigkeiten
ihren natürlichen Verlauf haben: unter diesen Ständen ist der Totschlag
hundertmal seltener, als bei der vielleicht nur ein Tausendstel der Gesamtheit
betragenden Fraktion, welche jenem Prinzipe huldigt; und selbst eine Prügelei
ist eine Seltenheit. — Sodann aber wird behauptet, der gute Ton und
die feine Sitte der Gesellschaft hätten zum letzten Grundpfeiler jenes
Ehrenprinzip, mit seinen Duellen, als welche die Wehrmauer gegen die Ausbrüche
der Roheit und Ungezogenheit wären. Allein in Athen, Korinth und Rom
war ganz gewiß gute und zwar sehr gute Gesellschaft, auch feine Sitte
und guter Ton anzutreffen; ohne daß jener Popanz der ritterlichen Ehre
dahinter gesteckt hätte. Freilich aber führten daselbst auch nicht,
wie bei uns, die Weiber den Vorsitz in der Gesellschaft, welches, wie
es zunächst der Unterhaltung einen frivolen und läppischen Charakter
erteilt und jedes gehaltvolle Gespräch verbannt, gewiß auch sehr dazu
beiträgt, daß in unsrer guten Gesellschaft der persönliche Mut den
Rang vor jeder andern Eigenschaft behauptet; während er doch eigentlich
eine sehr untergeordnete, eine bloße Unteroffizierstugend ist, ja, eine,
in welcher sogar Tiere uns übertreffen, weshalb man z. B. sagt: „mutig
wie ein Löwe“. Sogar aber ist, im Gegenteil obiger Behauptung, das
ritterliche Ehrenprinzip oft das sichere Asylum, wie im großen der Unredlichkeit
und Schlechtigkeit, so im kleinen der Ungezogenheit, Rücksichtslosigkeit
und Flegelei, indem eine Menge sehr lästiger Unarten stillschweigend
geduldet werden, weil eben keiner Lust hat, an die Rüge derselben den
Hals zu setzen. — Dem allen entsprechend sehn wir das Duell im höchsten
Flor und mit blutdürstigem Ernst betrieben, gerade bei der Nation, welche
in politischen und finanziellen Angelegenheiten Mangel an wahrer Ehrenhaftigkeit
bewiesen hat: wie es damit bei ihr im Privatverkehr stehe, kann man bei
denen erfragen, die Erfahrung darin haben. Was aber gar ihre Urbanität
und gesellschaftliche Bildung betrifft, so ist sie als negatives Muster
längst berühmt. Alle jene Vorgeben halten also nicht Stich. [...]
*) Die ritterliche Ehre ist ein Kind des Hochmuts und der Narrheit. (Die
ihr entgegengesetzte Wahrheit spricht am schärfsten el principe constante
aus in den Worten: „esa es la herencia de Adan.“) Sehr auffallend
ist es, daß dieser Superlativ alles Hochmuts sich allein und ausschließlich
unter den Genossen derjenigen Religion findet, welche ihren Anhängern
die äußerste Demut zur Pflicht macht; da weder frühere Zeiten noch
andere Weltteile jenes Prinzip der ritterlichen Ehre kennen. Dennoch darf
man dasselbe nicht der Religion zuschreiben, vielmehr dem Feudalwesen,
bei welchem jeder Edele sich als einen kleinen Souverän, der keinen menschlichen
Richter über sich erkannte, ansah und sich daher eine völlige Unverletzlichkeit
und Heiligkeit der Person beilegen lernte, daher ihm jedes Attentat gegen
dieselbe, also jeder Schlag und jedes Schimpfwort, ein todeswürdiges
Verbrechen schien. Demgemäß waren das Ehrenprinzip und die Duelle ursprünglich
nur Sache des Adels und infolge davon in spätern Zeiten der Offiziere,
denen sich nachher hin und wieder, wiewohl nie durchgängig, die andern
höhern Stände anschlossen, um nicht weniger zu gelten. Wenn auch die
Duelle aus den Ordalien hervorgegangen sind; so sind diese doch nicht
der Grund, sondern die Folge und Anwendung des Ehrenprinzips: wer keinen
menschlichen Richter erkennt, appelliert an den göttlichen. Die Ordalien
selbst aber sind nicht dem Christentum eigen, sondern finden sich auch
im Hinduismus sehr stark, zwar meistens in älterer Zeit; doch Spuren
davon auch noch jetzt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Mit mehr Recht kann urgiert werden, daß, wie schon ein angeknurrter
Hund wieder knurrt, ein geschmeichelter wieder schmeichelt, es auch in
der Natur des Menschen liege, jede feindliche Begegnung feindlich zu erwidern
und durch Zeichen der Geringschätzung, oder des Hasses, erbittert und
gereizt zu werden; daher schon Cicero sagt: Habet quendam aculeum contumelia,
quem pati prudentes ac viri boni difficillime possunt; wie denn auch nirgends
auf der Welt (einige fromme Sekten beiseite gesetzt) Schimpfreden, oder
gar Schläge, gelassen hingenommen werden. Jedoch leitet die Natur keinenfalls
zu etwas weiterem, als zu einer der Sache angemessenen Vergeltung, nicht
aber dazu, den Vorwurf der Lüge, der Dummheit, oder der Feigheit, mit
dem Tode zu bestrafen, und der altdeutsche Grundsatz „auf eine Maulschelle
gehört ein Dolch“ ist ein empörender ritterlicher Aberglaube. Jedenfalls
ist die Erwiderung, oder Vergeltung, von Beleidigungen Sache des Zorns,
aber keineswegs der Ehre und Pflicht, wozu das ritterliche Ehrenprinzip
sie stempelt. Vielmehr ist ganz gewiß, daß jeder Vorwurf nur in dem
Maße, als er trifft, verletzen kann; welches auch daran ersichtlich ist,
daß die leiseste Andeutung, welche trifft, viel tiefer verwundet, als
die schwerste Anschuldigung, die gar keinen Grund hat. Wer daher wirklich
sich bewußt ist, einen Vorwurf nicht zu verdienen, darf und wird ihn
getrost verachten. Dagegen aber fordert das Ehrenprinzip von ihm, daß
er eine Empfindlichkeit zeige, die er gar nicht hat, und Beleidigungen,
die ihn nicht verletzen, blutig räche. Der aber muß selbst eine schwache
Meinung von seinem eigenen Werte haben, der sich beeilt, jeder denselben
anfechtenden Aeußerung den Daumen aufs Auge zu drücken, damit sie nicht
laut werde. Demzufolge wird, bei Injurien, wahre Selbstschätzung wirkliche
Gleichgültigkeit verleihen, und wo dies, aus Mangel derselben, nicht
der Fall ist, werden Klugheit und Bildung anleiten, den Schein davon zu
retten und den Zorn zu verbergen. Wenn man demnach nur erst den Aberglauben
des ritterlichen Ehrenprinzips los wäre, so daß niemand mehr vermeinen
dürfte, durch Schimpfen irgend etwas der Ehre eines andern nehmen oder
der seinigen wiedergeben zu können, auch nicht mehr jedes Unrecht, jede
Roheit, oder Grobheit, sogleich legitimiert werden könnte durch die Bereitwilligkeit
Satisfaktion zu geben, d. h. sich dafür zu schlagen; so würde bald die
Einsicht allgemein werden, daß, wenn es ans Schmähen und Schimpfen geht,
der in diesem Kampfe Besiegte der Sieger ist, und daß, wie Vincenzo Monti
sagt, die Injurien es machen wie die Kirchenprozessionen, welche stets
dahin zurückkehren von wo sie ausgegangen sind. Ferner würde es alsdann
nicht mehr, wie jetzt, hinreichend sein, daß einer eine Grobheit zu Markte
brächte, um recht zu behalten; mithin würden alsdann Einsicht und Verstand
ganz anders zum Worte kommen, als jetzt, wo sie immer erst zu berücksichtigen
haben, ob sie nicht irgendwie den Meinungen der Beschränktheit und Dummheit,
als welche schon ihr bloßes Auftreten alarmiert und erbittert hat, Anstoß
geben und dadurch herbeiführen können, daß das Haupt, in welchem sie
wohnen, gegen den flachen Schädel, in welchem jene hausen, aufs Würfelspiel
gesetzt werden müsse. Sonach würde alsdann in der Gesellschaft die geistige
Ueberlegenheit das ihr gebührende Primat erlangen, welches jetzt, wenn
auch verdeckt, die physische Ueberlegenheit und die Husarencourage hat,
und infolge hievon würden die vorzüglichsten Menschen doch schon einen
Grund weniger haben, als jetzt, sich von der Gesellschaft zurückzuziehn.
Eine Veränderung dieser Art würde demnach den wahren guten Ton herbeiführen
und der wirklich guten Gesellschaft den Weg bahnen, in der Form, wie sie,
ohne Zweifel, in Athen, Korinth und Rom bestanden hat. Wer von dieser
eine Probe zu sehn wünscht, dem empfehle ich das Gastmahl des Xenophon
zu lesen.
Die letzte Verteidigung des ritterlichen Kodex wird aber, ohne Zweifel,
lauten: „Ei, da könnte ja, Gott sei bei uns! wohl gar einer dem andern
einen Schlag versetzen!“ — worauf ich kurz erwidern könnte, daß
dies bei den neunhundertneunundneunzig Tausendstel der Gesellschaft, die
jenen Kodex nicht anerkennen, oft genug der Fall gewesen, ohne daß je
einer daran gestorben sei, während bei den Anhängern desselben, in der
Regel, jeder Schlag ein tödlicher wird. Aber ich will näher darauf eingehen.
Ich habe mich oft genug bemüht, für die unter einem Teil der menschlichen
Gesellschaft so feststehende Ueberzeugung von der Entsetzlichkeit eines
Schlages, entweder in der tierischen, oder in der vernünftigen Natur
des Menschen, irgend einen haltbaren, oder wenigstens plausibeln, nur
nicht in bloßen Redensarten bestehenden, sondern auf deutliche Begriffe
zurückführbaren Grund zu finden; jedoch vergeblich. Ein Schlag ist und
bleibt ein kleines physisches Uebel, welches jeder Mensch dem andern verursachen
kann, dadurch aber weiter nichts beweist, als daß er stärker, oder gewandter
sei, oder daß der andere nicht auf seiner Hut gewesen. Weiter ergibt
die Analyse nichts. Sodann sehe ich denselben Ritter, welchem ein Schlag
von Menschenhand der Uebel größtes dünkt, einen zehnmal stärkern Schlag
von seinem Pferde erhalten und, mit verbissenem Schmerz davonhinkend,
versichern, es habe nichts zu bedeuten. Da habe ich gedacht, es läge
an der Menschenhand. Allein ich sehe unsern Ritter von dieser Degenstiche
und Säbelhiebe im Kampfe erhalten und versichern, es sei Kleinigkeit,
nicht der Rede wert. Sodann vernehme ich, daß selbst Schläge mit der
flachen Klinge bei weitem nicht so schlimm seien, wie die mit dem Stocke,
daher, vor nicht langer Zeit, die Kadetten wohl jenen, aber nicht diesen
ausgesetzt waren: und nun gar der Ritterschlag, mit der Klinge, ist die
größte Ehre. Da bin ich denn mit meinen psychologischen und moralischen
Gründen zu Ende, und mir bleibt nichts übrig, als die Sache für einen
alten, festgewurzelten Aberglauben zu halten, für ein Beispiel mehr,
zu so vielen, was alles man den Menschen einreden kann. Dies bestätigt
auch die bekannte Thatsache, daß in China Schläge mit dem Bambusrohr
eine sehr häufige bürgerliche Bestrafung, selbst für Beamte aller Klassen
sind; indem sie uns zeigt, daß die Menschennatur, und selbst die hoch
zivilisierte, dort nicht dasselbe aussagt *). Sogar aber lehrt ein unbefangener
Blick auf die Natur des Menschen, daß diesem das Prügeln so natürlich
ist, wie den reißenden Tieren das Beißen und dem Hornvieh das Stoßen:
er ist eben ein prügelndes Tier. Daher auch werden wir empört, wenn
wir, in seltenen Fällen, vernehmen, daß ein Mensch den andern gebissen
habe; hingegen ist, daß er Schläge gebe und empfange, ein so natürliches,
wie leicht eintretendes Ereignis. Daß höhere Bildung sich auch diesem,
durch gegenseitige Selbstbeherrschung, gern entzieht, ist leicht erklärlich.
Aber einer Nation, oder auch nur einer Klasse, aufzubinden, ein gegebener
Schlag sei ein entsetzliches Unglück, welches Mord und Totschlag zur
Folge haben müsse, ist eine Grausamkeit. Es gibt der wahren Uebel zu
viele auf der Welt, als daß man sich erlauben dürfte, sie durch imaginäre,
welche die wahren herbeiziehn, zu vermehren: das thut aber jener dumme
und boshafte Aberglaube. Ich muß daher sogar mißbilligen, daß Regierungen
und gesetzgebende Körper demselben dadurch Vorschub leisten, daß sie
mit Eifer auf Abstellung aller Prügelstrafen, beim Zivil und Militär,
dringen. Sie glauben dabei im Interesse der Humanität zu handeln; während
gerade das Gegenteil der Fall ist, indem sie dadurch an der Befestigung
jenes widernatürlichen und heillosen Wahnes, dem schon so viele Opfer
gefallen sind, arbeiten. Bei allen Vergehungen, mit Ausnahme der schwersten,
sind Prügel die dem Menschen zuerst einfallende, daher die natürliche
Bestrafung: wer für Gründe nicht empfänglich war, wird es für Prügel
sein: und daß der, welcher am Eigentum, weil er keines hat, nicht gestraft
werden kann, und den man an der Freiheit, weil man seiner Dienste bedarf,
nicht ohne eigenen Nachteil strafen kann, durch mäßige Prügel gestraft
werde, ist so billig, wie natürlich. Auch werden gar keine Gründe dagegen
aufgebracht, sondern bloße Redensarten von der „Würde des Menschen“,
die sich nicht auf deutliche Begriffe, sondern eben nur wieder auf obigen
verderblichen Aberglauben stützen. Daß dieser der Sache zum Grunde liege
hat eine fast lächerliche Bestätigung daran, daß noch vor kurzem, in
manchen Ländern, beim Militär, die Prügelstrafe durch die Lattenstrafe
ersetzt worden war, welche doch, ganz und gar wie jene, die Verursachung
eines körperlichen Schmerzes ist, nun aber nicht ehrenrührig und entwürdigend
sein soll.
Durch dergleichen Beförderung des besagten Aberglaubens arbeitet man
aber dem ritterlichen Ehrenprinzip und damit dem Duell in die Hände,
während man dieses andrerseits durch Gesetze abzustellen bemüht ist,
oder doch es zu sein vorgibt **). Infolge davon treibt denn jenes Fragment
des Faustrechts, aus den Zeiten des rohesten Mittelalters bis in das 19.
Jahrhundert herabgeweht, sich in diesem, zum öffentlichen Skandal, noch
immer herum: es ist nachgerade an der Zeit, daß es mit Schimpf und Schande
hinausgeworfen werde. Ist es doch heutzutage nicht einmal erlaubt, Hunde,
oder Hähne, methodisch aufeinander zu hetzen (wenigstens werden in England
dergleichen Hetzen gestraft); aber Menschen werden, wider Willen, zum
tödlichen Kampf aufeinander gehetzt, durch den lächerlichen Aberglauben
des absurden Prinzips der ritterlichen Ehre und durch dessen bornierte
Vertreter und Verwalter, welche ihnen die Verpflichtung auflegen, wegen
irgend einer Lumperei, wie Gladiatoren miteinander zu kämpfen. Unseren
deutschen Puristen schlage ich daher, für das Wort Duell, welches wahrscheinlich
nicht vom lateinischen duellum, sondern vom Spanischen duelo, Leid, Klage,
Beschwerde, herkommt, — die Benennung Ritterhetze vor. Die Pedanterei,
mit der die Narrheit getrieben wird, gibt allerdings Stoff zum Lachen.
Indessen ist es empörend, daß jenes Prinzip und sein absurder Kodex
einen Staat im Staate begründet, welcher, kein anderes als das Faustrecht
anerkennend, die ihm unterworfenen Stände dadurch tyrannisiert, daß
er ein heiliges Femgericht offen hält, vor welches jeder jeden, mittelst
sehr leicht herbeizuführender Anlässe als Schergen, laden kann, um ein
Gericht auf Tod und Leben über ihn und sich ergehn zu lassen. Natürlich
wird nun dies der Schlupfwinkel, von welchem aus jeder Verworfenste, wenn
er nur jenen Ständen angehört, den Edelsten und Besten, der ihm als
solcher notwendig verhaßt sein muß, bedrohen, ja, aus der Welt schaffen
kann. Nachdem heutzutage Justiz und Polizei es so ziemlich dahin gebracht
haben, daß nicht mehr auf der Landstraße jeder Schurke uns zurufen kann
„die Börse oder das Leben“, sollte endlich auch die gesunde Vernunft
es dahin bringen, daß nicht mehr, mitten im friedlichen Verkehr, jeder
Schurke uns zurufen könne „die Ehre oder das Leben“. Und die Beklemmung
sollte den höhern Ständen von der Brust genommen werden, welche daraus
entsteht, daß jeder, jeden Augenblick, mit Leib und Leben verantwortlich
werden kann für die Roheit, Grobheit, Dummheit oder Bosheit irgend eines
andern, dem es gefällt, solche gegen ihn auszulassen. Daß, wenn zwei
junge, unerfahrne Hitzköpfe mit Worten aneinander geraten, sie dies mit
ihrem Blut, ihrer Gesundheit, oder ihrem Leben büßen sollen, ist himmelschreiend,
ist schändlich. Wie arg die Tyrannei jenes Staates im Staate und wie
groß die Macht jenes Aberglaubens sei, läßt sich daran ermessen, daß
schon öfter Leute, denen die Wiederherstellung ihrer verwundeten ritterlichen
Ehre, wegen zu hohen, oder zu niedrigen Standes, oder sonst unangemessener
Beschaffenheit des Beleidigers unmöglich war, aus Verzweiflung darüber
sich selbst das Leben genommen und so ein tragikomisches Ende gefunden
haben. — Da das Falsche und Absurde sich am Ende meistens dadurch entschleiert,
daß es, auf seinem Gipfel, den Widerspruch als seine Blüte hervortreibt;
so tritt dieser zuletzt auch hier in Form der schreiendesten Antinomie
hervor: nämlich dem Offizier ist das Duell verboten: aber er wird durch
Absetzung gestraft, wenn er es, vorkommenden Falls, unterläßt. [...]
*) Vingt ou trente coups de canne sur le derrière, c’est, pour ainsi
dire, le pain quotidien de Chinois. C’est une correction paternelle
du mandarin, laquelle n’a rien d`infamant, et qu`ils recoivent avec
action de gràces. — Lettres èdifiantes et curieuses, èdition de 1819
Vol. 11, p. 454.
**) Der eigentliche Grund, aus welchem die Regierungen scheinbar sich
beeifern das Duell zu unterdrücken und, während dies offenbar, zumal
auf Universitäten, sehr leicht wäre, sich stellen, als wolle es ihnen
nur nicht gelingen, scheint mir folgender: Der Staat ist nicht im stande
die Dienste seiner Offiziere und Zivilbeamten mit Geld zum Vollen zu bezahlen;
daher läßt er die andere Hälfte ihres Lohnes in der Ehre bestehn, welche
repräsentiert wird durch Titel, Uniformen und Orden. Um nun diese ideale
Vergütung ihrer Dienste im hohen Kurse zu erhalten, muß das Ehrgefühl
auf alle Weise genährt, geschärft, allenfalls etwas überspannt werden:
da aber zu diesem Zweck die bürgerliche Ehre nicht ausreicht, schon weil
man sie mit jedem teilt; so wird die ritterliche Ehre zu Hilfe genommen
und besagterweise aufrecht erhalten. In England, als wo Militär- und
Zivilbesoldungen sehr viel höher stehn, als auf dem Kontinent, ist die
besagte Aushilfe nicht nötig: daher eben ist daselbst, zumal in diesen
letzten zwanzig Jahren, das Duell fast ganz ausgerottet, kommt jetzt höchst
selten vor, und wird dann als eine Narrheit verlacht; gewiß hat die große
Anti-duelling-society, welche eine Menge Lords, Admiräle und Generäle
zu ihren Mitgliedern zählt, hiezu viel beigetragen, und der Moloch muß
sich ohne seine Opfer behelfen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Als die oberste Regel aller Lebensweisheit sehe ich einen Satz an, den
Aristoteles beiläufig ausgesprochen hat, in der Nikomachäischen Ethik
(VII, 12): δ φρονιμος το αλυπον διωκει, ου το
ήδυ (quod dolore vacat, non quod suave est, persequitur vir prudens.
Besser noch deutsch ließe sich dieser Satz etwan so wiedergeben: „Nicht
dem Vergnügen, der Schmerzlosigkeit geht der Vernünftige nach“; oder:
„Der Vernünftige geht auf Schmerzlosigkeit, nicht auf Genuß aus“).
Die Wahrheit desselben beruht darauf, daß aller Genuß und alles Glück
negativer, hingegen der Schmerz positiver Natur ist. Die Ausführung und
Begründung dieses letzteren Satzes findet man in der „Welt als Wille
und Vorst.“, Bd. 1, § 58 (Bd. 3, S. 178 ff. dieser Gesamtausg.). Doch
will ich denselben hier noch an einer täglich zu beobachtenden Thatsache
erläutern. Wenn der ganze Leib gesund und heil ist, bis auf irgend eine
kleine wunde, oder sonst schmerzende Stelle; so tritt jene Gesundheit
des Ganzen weiter nicht ins Bewußtsein, sondern die Aufmerksamkeit ist
beständig auf den Schmerz der verletzten Stelle gerichtet und das Behagen
der gesamten Lebensempfindung ist aufgehoben. — Ebenso, wenn alle unsere
Angelegenheiten nach unserm Sinne gehn, bis auf eine, die unsrer Absicht
zuwiderläuft, so kommt diese, auch wenn sie von geringer Bedeutung ist,
uns immer wieder in den Kopf: wir denken häufig an sie und wenig an alle
jene andern wichtigeren Dinge, die nach unserm Sinne gehn. — In beiden
Fällen nun ist das Beeinträchtigte der Wille, einmal, wie er sich im
Organismus, das andere, wie er sich im Streben des Menschen objektiviert,
und in beiden sehn wir, daß seine Befriedigung immer nur negativ wirkt
und daher gar nicht direkt empfunden wird, sondern höchstens auf dem
Wege der Reflexion ins Bewußtsein kommt. Hingegen ist seine Hemmung das
Positive und daher sich selbst Ankündigende. Jeder Genuß besteht bloß
in der Aufhebung dieser Hemmung, in der Befreiung davon, ist mithin von
kurzer Dauer.
Hierauf nun also beruht die oben belobte Aristotelische Regel, welche
uns anweist, unser Augenmerk nicht auf die Genüsse und Annehmlichkeiten
des Lebens zu richten, sondern darauf, daß wir den zahllosen Uebeln desselben,
soweit es möglich ist, entgehn. Wäre dieser Weg nicht der richtige;
so müßte auch Voltaires Ausspruch, le bonheur n’est qu’un rève,
et la douleur est rèelle, so falsch sein, wie er in der That wahr ist.
Demnach soll auch der, welcher das Resultat seines Lebens, in eudämonologischer
Rücksicht, ziehn will, die Rechnung nicht nach den Freuden, die er genossen,
sondern nach den Uebeln, denen er entgangen ist, aufstellen. Ja, die Eudämonologie
hat mit der Belehrung anzuheben, daß ihr Name selbst ein Euphemismus
ist und daß unter „glücklich leben“ nur zu verstehn ist „weniger
unglücklich“, also erträglich leben. Allerdings ist das Leben nicht
eigentlich da, um genossen, sondern um überstanden, abgethan zu werden;
dies bezeichnen auch manche Ausdrücke, wie degere vitam, vita defungi,
das italienische si scampa cosi, das deutsche, „man muß suchen durchzukommen“,
„er wird schon durch die Welt kommen“, u. dgl. m. Ja, es ist ein Trost
im Alter, daß man die Arbeit des Lebens hinter sich hat. Demnach nun
hat das glücklichste Los der, welcher sein Leben ohne übergroße Schmerzen,
sowohl geistige, als körperliche, hinbringt; nicht aber der, dem die
lebhaftesten Freuden, oder die größten Genüsse zu teil geworden. Wer
nach diesen letzteren das Glück eines Lebenslaufes bemessen will, hat
einen falschen Maßstab ergriffen. Denn die Genüsse sind und bleiben
negativ: daß sie beglücken ist ein Wahn, den der Neid, zu seiner eigenen
Strafe, hegt. Die Schmerzen hingegen werden positiv empfunden: daher ist
ihre Abwesenheit der Maßstab des Lebensglückes. Kommt zu einem schmerzlosen
Zustand noch die Abwesenheit der Langenweile; so ist das irdische Glück
im wesentlichen erreicht: denn das übrige ist Chimäre. Hieraus nun folgt,
daß man nie Genüsse durch Schmerzen, ja, auch nur durch die Gefahr derselben,
erkaufen soll; weil man sonst ein Negatives und daher Chimärisches mit
einem Positiven und Realen bezahlt. Hingegen bleibt man im Gewinn, wenn
man Genüsse opfert, um Schmerzen zu entgehn. In beiden Fällen ist es
gleichgültig, ob die Schmerzen den Genüssen nachfolgen, oder vorhergehn.
Es ist wirklich die größte Verkehrtheit, diesen Schauplatz des Jammers
in einen Lustort verwandeln zu wollen und, statt der möglichsten Schmerzlosigkeit,
Genüsse und Freuden sich zum Ziele zu stecken; wie doch so viele thun.
Viel weniger irrt wer, mit zu finsterm Blicke, diese Welt als eine Art
Hölle ansieht und demnach nur darauf bedacht ist, sich in derselben eine
feuerfeste Stube zu verschaffen. Der Thor läuft den Genüssen des Lebens
nach und sieht sich betrogen: der Weise vermeidet die Uebel. Sollte ihm
jedoch auch dieses mißglücken; so ist es dann die Schuld des Geschicks,
nicht die seiner Thorheit. Soweit es ihm aber glückt, ist er nicht betrogen:
denn die Uebel, denen er aus dem Wege ging, sind höchst real. Selbst
wenn er etwan ihnen zu weit aus dem Wege gegangen sein sollte und Genüsse
unnötigerweise geopfert hätte; so ist eigentlich doch nichts verloren:
denn alle Genüsse sind chimärisch, und über die Versäumnis derselben
zu trauern wäre kleinlich, ja lächerlich.
Das Verkennen dieser Wahrheit, durch den Optimismus begünstigt, ist die
Quelle vielen Unglücks. Während wir nämlich von Leiden frei sind, spiegeln
unruhige Wünsche uns die Chimären eines Glückes vor, das gar nicht
existiert, und verleiten uns sie zu verfolgen: dadurch bringen wir den
Schmerz, der unleugbar real ist, auf uns herab. Dann jammern wir über
den verlorenen schmerzlosen Zustand, der, wie ein verscherztes Paradies,
hinter uns liegt, und wünschen vergeblich, das Geschehene ungeschehn
machen zu können. So scheint es, als ob ein böser Dämon uns aus dem
schmerzlosen Zustande, der das höchste wirkliche Glück ist, stets herauslockte,
durch die Gaukelbilder der Wünsche. — Unbesehens glaubt der Jüngling,
die Welt sei da, um genossen zu werden, sie sei der Wohnsitz eines positiven
Glückes, welches nur die verfehlen, denen es an Geschick gebricht, sich
seiner zu bemeistern. Hierin bestärken ihn Romane und Gedichte, wie auch
die Gleisnerei, welche die Welt, durchgängig und überall, mit dem äußern
Scheine treibt und auf die ich bald zurückkommen werde. Von nun an ist
sein Leben eine, mit mehr oder weniger Ueberlegung angestellte Jagd nach
dem positiven Glück, welches, als solches, aus positiven Genüssen bestehn
soll. Die Gefahren, denen man sich dabei aussetzt, müssen in die Schanze
geschlagen werden. Da führt denn diese Jagd nach einem Wilde, welches
gar nicht existiert, in der Regel, zu sehr realem, positivem Unglück.
Dies stellt sich ein als Schmerz, Leiden, Krankheit, Verlust, Sorge, Armut,
Schande und tausend Nöte. Die Enttäuschung kommt zu spät. — Ist hingegen,
durch Befolgung der hier in Betracht genommenen Regel, der Plan des Lebens
auf Vermeidung der Leiden, also auf Entfernung des Mangels, der Krankheit
und jeder Not, gerichtet; so ist das Ziel ein reales: da läßt sich etwas
ausrichten, und um so mehr, je weniger dieser Plan gestört wird durch
das Streben nach der Chimäre des positiven Glücks. Hiezu stimmt auch
was Goethe, in den Wahlverwandtschaften, den, für das Glück der andern
stets thätigen Mittler sagen läßt: „Wer ein Uebel los sein will,
der weiß immer was er will: wer was Besseres will, als er hat, der ist
ganz starblind.“ Und dieses erinnert an den schönen französischen
Ausspruch: le mieux est l’ennemi du bien. Ja, hieraus ist sogar der
Grundgedanke des Kynismus abzuleiten, wie ich ihn dargelegt habe, in den
Ergänzungen zur „Welt als Wille und Vorst.“, Kap. 16 (Bd. 4, S. 302
ff. dieser Gesamtausg.). Denn, was bewog die Kyniker zur Verwerfung aller
Genüsse, wenn es nicht eben der Gedanke an die mit ihnen, näher oder
ferner, verknüpften Schmerzen war, welchen aus dem Wege zu gehn ihnen
viel wichtiger schien, als die Erlangung jener. Sie waren tief ergriffen
von der Erkenntnis der Negativität des Genusses und der Positivität
des Schmerzes; daher sie, konsequent, alles thaten für die Vermeidung
der Uebel, hiezu aber die völlige und absichtliche Verwerfung der Genüsse
nötig erachteten; weil sie in diesen nur Fallstricke sahen, die uns dem
Schmerze überliefern.
In Arkadien geboren, wie Schiller sagt, sind wir freilich alle: d. h.
wir treten in die Welt, voll Ansprüche auf Glück und Genuß, und hegen
die thörichte Hoffnung, solche durchzusetzen. In der Regel jedoch kommt
bald das Schicksal, packt uns unsanft an und belehrt uns, daß nichts
unser ist, sondern alles sein, indem es ein unbestrittenes Recht hat,
nicht nur auf allen unsern Besitz und Erwerb und auf Weib und Kind, sondern
sogar auf Arm und Bein, Auge und Ohr, ja, auf die Nase mitten im Gesicht.
Jedenfalls aber kommt, nach einiger Zeit, die Erfahrung und bringt die
Einsicht, daß Glück und Genuß eine Fata Morgana sind, welche, nur aus
der Ferne sichtbar, verschwindet, wenn man herangekommen ist; daß hingegen
Leiden und Schmerz Realität haben, sich selbst unmittelbar vertreten
und keiner Illusion, noch Erwartung bedürfen. Fruchtet nun die Lehre;
so hören wir auf, nach Glück und Genuß zu jagen, und sind vielmehr
darauf bedacht, dem Schmerz und Leiden möglichst den Zugang zu versperren.
Wir erkennen alsdann, daß das Beste, was die Welt zu bieten hat, eine
schmerzlose, ruhige, erträgliche Existenz ist und beschränken unsere
Ansprüche auf diese, um sie desto sicherer durchzusetzen. Denn, um nicht
sehr unglücklich zu werden, ist das sicherste Mittel, daß man nicht
verlange, sehr glücklich zu sein. Dies hatte auch Goethes Jugendfreund
Merck erkannt, da er schrieb: „Die garstige Prätension an Glückseligkeit,
und zwar an das Maß, das wir uns träumen, verdirbt alles auf dieser
Welt. Wer sich davon losmachen kann und nichts begehrt, als was er vor
ich hat, kann sich durchschlagen.“ (Briefe an und von Merck, S. 100.)
Demnach ist es geraten, seine Ansprüche auf Genuß, Besitz, Rang, Ehre
u. s. f. auf ein ganz Mäßiges herabzusetzen; weil gerade das Streben
und Ringen nach Glück, Glanz und Genuß es ist, was die großen Unglücksfälle
herbeizieht. Aber schon darum ist jenes weise und ratsam, weil sehr unglücklich
zu sein gar leicht ist; sehr glücklich hingegen nicht etwan schwer, sondern
ganz unmöglich. Mit großem Rechte also singt der Dichter der Lebensweisheit:
Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus tecti, caret invidenda
Sobrius aula.
Saevius ventis agitatur ingens
Pinus: et celsae graviore casu
Decidunt turres: feriuntque summos
Fulgura montes.
Wer aber vollends die Lehre meiner Philosophie in sich aufgenommen hat
und daher weiß, daß unser ganzes Dasein etwas ist, das besser nicht
wäre und welches zu verneinen und abzuweisen die größte Weisheit ist,
der wird auch von keinem Dinge, oder Zustand große Erwartungen hegen,
nach nichts auf der Welt mit Leidenschaft streben, noch große Klagen
erheben über sein Verfehlen irgend einer Sache; sondern er wird von Platos
„ούτε τι των άνϑρωπινων άξιον μεγαλης
σπουϐης“ (rep. X, 604) durchdrungen sein, sowie auch hievon:
Ist einer Welt Besitz für dich zerronnen,
Sei nicht in Leid darüber, es ist nichts;
Und hast du einer Welt Besitz gewonnen,
Sei nicht erfreut darüber, es ist nichts.
Vorüber gehn die Schmerzen und die Wonnen
Geh an der Welt vorüber, es ist nichts.
Anwari Soheili.
(Siehe das Motto zu Sadis Gulistan, übers. von Graf.)
Was jedoch die Erlangung dieser heilsamen Einsichten besonders erschwert,
ist die schon oben erwähnte Gleisnerei der Welt, welche man daher der
Jugend früh aufdecken sollte. Die allermeisten Herrlichkeiten sind bloßer
Schein, wie die Theaterdekoration, und das Wesen der Sache fehlt. Z. B.
bewimpelte und bekränzte Schiffe, Kanonenschüsse, Illumination, Pauken
und Trompeten, Jauchzen und Schreien u. s. w., dies alles ist das Aushängeschild,
die Andeutung, die Hieroglyphe der Freude: aber die Freude ist daselbst
meistens nicht zu finden: sie allein hat beim Feste abgesagt. Wo sie sich
wirklich einfindet, da kommt sie, in der Regel, ungeladen und ungemeldet,
von selbst und sans facon, ja, still herangeschlichen, oft bei den unbedeutendesten,
futilsten Anlässen, unter den alltäglichsten Umständen, ja, bei nichts
weniger als glänzenden, oder ruhmvollen Gelegenheiten: sie ist, wie das
Gold in Australien, hierhin und dorthin gestreuet, nach der Laune des
Zufalls, ohne alle Regel und Gesetz, meist nur in ganz kleinen Körnchen,
höchst selten in großen Massen. Bei allen jenen oben erwähnten Dingen
hingegen ist auch der Zweck bloß, andere glauben zu machen, hier wäre
die Freude eingekehrt: dieser Schein, im Kopfe anderer, ist die Absicht.
Nicht anders als mit der Freude verhält es sich mit der Trauer. Wie schwermütig
kommt jener lange und langsame Leichenzug daher! der Reihe der Kutschen
ist kein Ende. Aber seht nur hinein: sie sind alle leer, und der Verblichene
wird eigentlich bloß von sämtlichen Kutschern der ganzen Stadt zu Grabe
geleitet. Sprechendes Bild der Freundschaft und Hochachtung dieser Welt!
Dies also ist die Falschheit, Hohlheit und Gleisnerei des menschlichen
Treibens. — Ein anderes Beispiel wieder geben viele geladene Gäste
in Feierkleidern, unter festlichem Empfange; sie sind das Aushängeschild
der edelen, erhöhten Geselligkeit: aber statt ihrer ist, in der Regel,
nur Zwang, Pein und Langeweile gekommen: denn schon wo viele Gäste sind,
ist viel Pack, — und hätten sie auch sämtlich Sterne auf der Brust.
Die wirklich gute Gesellschaft nämlich ist, überall und notwendig, sehr
klein. Ueberhaupt aber tragen glänzende, rauschende Feste und Lustbarkeiten
stets eine Leere, wohl gar einen Mißton im Innern; schon weil sie dem
Elend und der Dürftigkeit unsers Daseins laut widersprechen, und der
Kontrast erhöht die Wahrheit. Jedoch von außen gesehn wirkt jenes alles:
und das war der Zweck. Ganz allerliebst sagt daher Chamfort: La sociètè,
les cercles, les salons, ce qu’on appelle le monde, est une pièce misèrable,
un mauvais opèra, sans intèrèt, qui se soutient un peu par les machines,
les costumes, et les dècorations. — Desgleichen sind nun auch Akademien
und philosophische Katheder das Aushängeschild, der äußere Schein der
Weisheit: aber auch sie hat meistens abgesagt und ist ganz wo anders zu
finden. — Glockengebimmel, Priesterkostüme, fromme Gebärden und fratzenhaftes
Thun ist das Aushängeschild, der falsche Schein der Andacht u. s. w.
— So ist denn fast alles in der Welt hohle Nüsse zu nennen: der Kern
ist an sich selten, und noch seltener steckt er in der Schale. Er ist
ganz wo anders zu suchen und wird meistens nur zufällig gefunden.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Man sollte beständig die Wirkung der Zeit und die Wandelbarkeit der Dinge
vor Augen haben und daher bei allem, was jetzt stattfindet, sofort das
Gegenteil davon imaginieren; also im Glücke das Unglück, in der Freundschaft
die Feindschaft, im schönen Wetter das schlechte, in der Liebe den Haß,
im Zutrauen und Eröffnen den Verrat und die Reue, und so auch umgekehrt,
sich lebhaft vergegenwärtigen. Dies würde eine bleibende Quelle wahrer
Weltklugheit abgeben, indem wir stets besonnen bleiben und nicht so leicht
getäuscht werden würden. Meistens würden wir dadurch nur die Wirkung
der Zeit anticipiert haben. — Aber vielleicht ist zu keiner Erkenntnis
die Erfahrung so unerläßlich, wie zur richtigen Schätzung des Unbestandes
und Wechsels der Dinge. Weil eben jeder Zustand, für die Zeit seiner
Dauer, notwendig und daher mit vollstem Rechte vorhanden ist; so sieht
jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag aus, als ob nun endlich er Recht behalten
wollte, für alle Ewigkeit. Aber keiner behält es, und der Wechsel allein
ist das Beständige. Der Kluge ist der, welchen die scheinbare Stabilität
nicht täuscht und der noch dazu die Richtung, welche der Wechsel zunächst
nehmen wird, vorhersieht *). Daß hingegen die Menschen den einstweiligen
Zustand der Dinge, oder die Richtung ihres Laufes, in der Regel für bleibend
halten, kommt daher, daß sie die Wirkungen vor Augen haben, aber die
Ursachen nicht verstehn, diese es jedoch sind, welche den Keim der künftigen
Veränderungen in sich tragen; während die Wirkung, welche für jene
allein da ist, hievon nichts enthält. An diese halten sie sich und setzen
voraus, daß die ihnen unbekannten Ursachen, welche solche hervorzubringen
vermochten, auch im stande sein werden, sie zu erhalten. Sie haben dabei
den Vorteil, daß wenn sie irren, es immer unisono geschieht; daher denn
die Kalamität, welche infolge davon sie trifft, stets eine allgemeine
ist, während der denkende Kopf, wenn er geirrt hat, noch dazu allein
steht. — Beiläufig haben wir daran eine Bestätigung meines Satzes,
daß der Irrtum stets aus dem Schluß von der Folge auf den Grund entsteht.
Siehe „Welt als Wille und Vorst.“ Bd. 1, S. 90. (Bd. 2, S. 118 f.
dieser Gesamtausgabe.)
Jedoch nur theoretisch und durch Vorhersehn ihrer Wirkung soll man die
Zeit anticipieren, nicht praktisch, nämlich nicht so, daß man ihr vorgreife,
indem man vor der Zeit verlangt was erst die Zeit bringen kann. Denn wer
dies thut wird erfahren, daß es keinen schlimmeren, unnachlassendern
Wucherer gibt, als eben die Zeit, und daß sie, wenn zu Vorschüssen gezwungen,
schwerere Zinsen nimmt, als irgend ein Jude. Z. B. man kann durch ungelöschten
Kalk und Hitze einen Baum dermaßen treiben, daß er binnen weniger Tage,
Blätter, Blüten und Früchte treibt: dann aber stirbt er ab. — Will
der Jüngling die Zeugungskraft des Mannes schon jetzt, wenn auch nur
auf etliche Wochen ausüben, und im neunzehnten Jahre leisten was er im
dreißigsten sehr wohl könnte; so wird allenfalls die Zeit den Vorschuß
leisten, aber ein Teil der Kraft seiner künftigen Jahre, ja, ein Teil
seines Lebens selbst, ist der Zins. — Es gibt Krankheiten, von denen
man gehörig und gründlich nur dadurch genest, daß man ihnen ihren natürlichen
Verlauf läßt, nach welchem sie von selbst verschwinden, ohne eine Spur
zu hinterlassen. Verlangt man aber sogleich und jetzt, nur gerade jetzt,
gesund zu sein; so muß auch hier die Zeit Vorschuß leisten: die Krankheit
wird vertrieben: aber der Zins ist Schwäche und chronische Uebel, zeitlebens.
— Wenn man in Zeiten des Krieges, oder der Unruhen, Geld gebraucht und
zwar sogleich, gerade jetzt; so ist man genötigt liegende Gründe, oder
Staatspapiere, für ein Drittel und noch weniger ihres Wertes zu verkaufen,
den man zum Vollen erhalten würde, wenn man der Zeit ihr Recht widerfahren
lassen, also einige Jahre warten wollte: aber man zwingt sie, Vorschuß
zu leisten. — Oder auch man bedarf einer Summe zu einer weiten Reise:
binnen eines oder zweier Jahre könnte man sie von seinem Einkommen zurückgelegt
haben. Aber man will nicht warten: sie wird also geborgt, oder einstweilen
vom Kapital genommen: d. h. die Zeit muß vorschießen. Da ist ihr Zins
eingerissene Unordnung in der Kasse, ein bleibendes und wachsendes Defizit,
welches man nie mehr los wird. — Dies also ist der Wucher der Zeit:
seine Opfer werden alle, die nicht warten können. Den Gang der gemessen
ablaufenden Zeit beschleunigen zu wollen, ist das kostspieligste Unternehmen.
Also Hüte man sich, der Zeit Zinsen schuldig zu werden.
*) Der Zufall hat bei allen menschlichen Dingen so großen Spielraum,
daß wenn wir einer von ferne drohenden Gefahr gleich durch Aufopferungen
vorzubeugen suchen, diese Gefahr oft durch einen unvorhergesehenen Stand,
den die Dinge annehmen, verschwindet, und jetzt nicht nur die gebrachten
Opfer verloren sind, sondern die durch sie herbeigeführte Veränderung
nunmehr, beim veränderten Stande der Dinge, gerade ein Nachteil ist.
Wir müssen daher in unsern Vorkehrungen nicht zu weit in die Zukunft
greifen, sondern auch auf den Zufall rechnen und mancher Gefahr kühn
entgegen sehn, hoffend, daß sie, wie so manche schwarze Gewitterwolke,
vorüberzieht.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Frägt man, welches der Weg der magischen Wirkung, dergleichen uns
in der sympathetischen Kur, wie auch in dem Einfluß des entfernten Magnetiseurs
gegeben ist, sei; so sage ich: es ist der Weg, den das Insekt zurücklegt,
das hier stirbt und aus jedem Ei, welches überwintert hat, wieder in
voller Lebendigkeit hervorgeht. Es ist der Weg, auf welchem es geschieht,
daß, in einer gegebenen Volksmenge, nach außerordentlicher Vermehrung
der Sterbefälle, auch die Geburten sich vermehren. Es ist der Weg, der
nicht am Gängelbande der Kausalität durch Zeit und Raum geht. Es ist
der Weg durch das Ding an sich.
Wir nun aber wissen aus meiner Philosophie, daß dieses Ding an sich,
also auch das innere Wesen des Menschen, sein Wille ist, und daß der
ganze Organismus eines jeden, wie er sich empirisch darstellt, bloß die
Objektivation desselben, näher, das im Gehirn entstehende Bild dieses
seines Willens ist. Der Wille als Ding an sich liegt aber außerhalb des
principii individuationis (Zeit Und Raum), durch welches die Individuen
gesondert sind: die durch dasselbe entstehenden Schranken sind also für
ihn nicht da. Hieraus erklärt sich, so weit, wenn wir dieses Gebiet betreten,
noch unsere Einsicht reichen kann, die Möglichkeit unmittelbarer Einwirkung
der Individuen aufeinander, unabhängig von ihrer Nähe oder Ferne im
Raum, welche sich in einigen der oben aufgezählten neun Arten der wachenden
Anschauung durch das Traumorgan, und öfter in der schlafenden, faktisch
kundgibt; und ebenso erklärt sich, aus dieser unmittelbaren, im Wesen
an sich der Dinge gegründeten Kommunikation, die Möglichkeit des Wahrträumens,
des Bewußtwerdens der nächsten Umgebung im Somnambulismus und endlich
die des Hellsehns. Indem der Wille des einen, durch keine Schranken der
Individuation gehemmt, also unmittelbar und in distans, auf den Willen
des andern wirkt, hat er eben damit auf den Organismus desselben, als
welcher nur dessen räumlich angeschauter Wille selbst ist, eingewirkt.
Wenn nun eine solche, auf diesem Wege, das Innere des Organismus treffende
Einwirkung sich auf dessen Lenker und Vorstand, das Gangliensystem, erstreckt,
und dann von diesem aus, mittelst Durchbrechung der Isolation, sich bis
ins Gehirn fortpflanzt, so kann sie von diesem doch immer nur auf Gehirnweise
verarbeitet werden, d. h. sie wird Anschauungen hervorbringen, denen vollkommen
gleich, welche auf äußere Anregung der Sinne entstehn, also Bilder im
Raum, nach dessen drei Dimensionen, mit Bewegung in der Zeit, gemäß
dem Gesetze der Kausalität u. s. w.: denn die einen wie die andern sind
eben Produkte der anschauenden Gehirnfunktion, und das Gehirn kann immer
nur seine eigene Sprache reden. Inzwischen wird eine Einwirkung jener
Art noch immer den Charakter, das Gepräge, ihres Ursprungs, also desjenigen,
von dem sie ausgegangen ist, an sich tragen und dieses demnach der Gestalt,
die sie, nach so weitem Umwege, im Gehirn hervorruft, aufdrücken, so
verschieden ihr Wesen an sich auch von dieser sein mag. Wirkt z. B. ein
Sterbender durch starke Sehnsucht, oder sonstige Willensintention, auf
einen Entfernten; so wird, wenn die Einwirkung sehr energisch ist, die
Gestalt desselben sich im Gehirn des andern darstellen, d. h. ganz so
wie ein Körper in der Wirklichkeit ihm erscheinen. Offenbar aber wird
eine solche, durch das Innere des Organismus geschehende Einwirkung auf
ein fremdes Gehirn leichter, wenn dieses schläft, als wenn es wacht,
statthaben; weil im erstern Fall die Fibern desselben gar keine, im letztern
eine der, die sie jetzt annehmen sollen, entgegengesetzte Bewegung haben.
Demnach wird eine schwächere Einwirkung der in Rede stehenden Art sich
bloß im Schlafe kundgeben können, durch Erregung von Träumen; im Wachen
aber allenfalls Gedanken, Empfindungen und Unruhe erregen; jedoch alles
immer noch ihrem Ursprunge gemäß und dessen Gepräge tragend: daher
kann sie z. B. einen unerklärlichen, aber unwiderstehlichen Trieb, oder
Zug, den, von dem sie ausgegangen ist, aufzusuchen, hervorbringen; und
ebenso, umgekehrt, den, der kommen will, durch den Wunsch ihn nicht zu
sehn, noch von der Schwelle des Hauses wieder zurückscheuchen, selbst
wenn er gerufen und bestellt war (experto crede Ruperto). Auf dieser Einwirkung,
deren Grund die Identität des Dinges an sich in allen Erscheinungen ist,
beruht auch die faktisch erkannte Kontagiosität der Visionen, des zweiten
Gesichts und des Geistersehns, welche eine Wirkung hervorbringt, die im
Resultat derjenigen gleich kommt, welche ein körperliches Objekt auf
die Sinne mehrerer Individuen zugleich ausübt, indem auch infolge jener
mehrere zugleich dasselbe sehn, welches alsdann sich ganz objektitv konstituiert.
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Nächst der Klugheit aber ist Mut eine für unser Glück sehr wesentliche
Eigenschaft. Freilich kann man weder die eine noch die andere sich geben,
sondern ererbt jene von der Mutter und diesen vom Vater: jedoch läßt
sich durch Vorsatz und Uebung dem davon Vorhandenen nachhelfen. Zu dieser
Welt, wo „die Würfel eisern fallen“, gehört ein eiserner Sinn, gepanzert
gegen das Schicksal und gewaffnet gegen die Menschen. Denn das ganze Leben
ist ein Kampf, jeder Schritt wird uns streitig gemacht und Voltaire sagt
mit Recht: On ne rèussit dans ce monde, qu’à la pointe de l'èpèe,
et on meurt les armes à la main. Daher ist es eine feige Seele, die,
sobald Wolken sich zusammenziehn oder wohl gar nur am Horizont sich zeigen,
zusammenschrumpft, verzagen will und jammert. Vielmehr sei unser Wahlspruch:
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.
Solange der Ausgang einer gefährlichen Sache nur noch zweifelhaft ist,
solange nur noch die Möglichkeit, daß er ein glücklicher werde, vorhanden
ist, darf an kein Zagen gedacht werden, sondern bloß an Widerstand; wie
man am Wetter nicht verzweifeln darf, solange noch ein blauer Fleck am
Himmel ist. Ja, man bringe es dahin zu sagen:
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.
Das ganze Leben selbst, geschweige seine Güter, sind noch nicht so ein
feiges Beben und Einschrumpfen des Herzens wert:
Quocirca vivite fortes,
Fortiaque adversis opponite pectora rebus.
Und doch ist auch hier ein Exceß möglich: denn der Mut kann in Verwegenheit
ausarten. Sogar ist ein gewisses Maß von Furchtsamkeit zu unserm Bestande
in der Welt notwendig: die Feigheit ist bloß das Ueberschreiten desselben.
Dies hat Baco von Verulam gar treffend ausgedrückt, in seiner etymologischen
Erklärung des terror Panicus, welche die ältere, vom Plutarch (De Iside
et Osir. c. 14) uns erhaltene, weit hinter sich läßt. Er leitet nämlich
denselben ab vom Pan, als der personifizierten Natur und sagt: Natura
enim rerum omnibus viventibus indidit metum, ac formidinem, vitae atque
essentiae suae conservatricem, ac mala ingruentia vitantem et depellentem.
Verumtamen eadem natura modum tenere nescia est: sed timoribus salutaribus
semper vanos et inanes admiscet; adeo ut omnia (si intus conspici darentur)
Panicis terroribus plenissima sint, praesertim humana. (De sapientia veterum
VI.) Uebrigens ist das Charakteristische des panischen Schreckens, daß
er seiner Gründe sich nicht deutlich bewußt ist, sondern sie mehr voraussetzt,
als kennt, ja, zur Not geradezu die Furcht selbst als Grund der Furcht
geltend macht.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Was aber die Leute gemeiniglich das Schicksal nennen sind meistens nur
ihre eigenen dummen Streiche. Man kann daher nicht genugsam die schöne
Stelle im Homer (II. XXIII, 313 sqq.) beherzigen, wo er die μητις,
d. i. die kluge Ueberlegung, empfiehlt. Denn wenn auch die schlechten
Streiche erst in jener Welt gebüßt werden; so doch die dummen schon
in dieser; — wiewohl hin und wieder einmal Gnade für Recht ergehen
mag.
Nicht wer grimmig, sondern wer klug dareinschaut sieht furchtbar und gefährlich
aus: — so gewiß des Menschen Gehirn eine furchtbarere Waffe ist, als
die Klaue des Löwen. —
Der vollkommene Weltmann wäre der, welcher nie in Unschlüssigkeit stockte
und nie in Uebereilung geriete.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In einem gewissen Sinne könnte man allerdings, mit Kant, den Theismus
ein praktisches Postulat nennen, jedoch mit einem ganz andern, als den
er gemeint hat. Der Theismus nämlich ist in der That kein Erzeugnis der
Erkenntnis, sondern des Willens. Wenn er ursprünglich theoretisch wäre,
wie könnten denn alle seine Beweise so unhaltbar sein? Aus dem Willen
aber entspringt er folgendermaßen. Die beständige Not, welche das Herz
(Willen) des Menschen bald schwer beängstigt, bald heftig bewegt und
ihn fortwährend im Zustande des Fürchtens und Hoffens erhält, während
die Dinge, von denen er hofft und fürchtet, nicht in seiner Gewalt stehn,
ja, der Zusammenhang der Kausalketten, an denen solche herbeigeführt
werden, nur eine kurze Spanne weit von seiner Erkenntnis erreicht werden
kann; — diese Not, dies stete Fürchten und Hoffen, bringt ihn dahin,
daß er die Hypostase persönlicher Wesen macht, von denen alles abhinge.
Von solchen nun läßt sich voraussetzen, daß sie, gleich andern Personen,
für Bitte und Schmeichelei, Dienst und Gabe, empfänglich, also traktabler
sein werden, als die starre Notwendigkeit, die unerbittlichen, gefühllosen
Naturkräfte und die dunkeln Mächte des Weltlaufs. Sind nun anfangs,
wie es natürlich ist und die Alten es sehr zweckmäßig durchgeführt
hatten, dieser Götter, nach Verschiedenheit der Angelegenheiten, mehrere;
so werden sie später, durch das Bedürfnis, Konsequenz, Ordnung und Einheit
in die Erkenntnis zu bringen, einem unterworfen, oder gar auf einen reduziert
werden, — der nun freilich, wie mir Goethe einmal bemerkt hat, sehr
undramatisch ist; weil mit einer Person sich nichts anfangen läßt. Das
Wesentliche jedoch ist der Drang des geängsteten Menschen, sich niederzuwerfen
und Hilfe anzuflehen, in seiner häufigen, kläglichen und großen Not
und auch hinsichtlich seiner ewigen Seligkeit. Der Mensch verläßt sich
lieber auf fremde Gnade, als auf eigenes Verdienst: dies ist eine Hauptstütze
des Theismus. Damit also sein Herz (Wille) die Erleichterung des Betens
und den Trost des Hoffens habe, muß sein Intellekt ihm einen Gott schaffen;
nicht aber umgekehrt, weil sein Intellekt auf einen Gott logisch richtig
geschlossen hat, betet er. Laßt ihn ohne Not, Wünsche und Bedürfnisse
sein, etwan ein bloß intellektuelles, willenloses Wesen; so braucht er
keinen Gott und macht auch keinen. Das Herz, d. i. der Wille, hat in seiner
schweren Bedrängnis das Bedürfnis, allmächtigen, folglich übernatürlichen
Beistand anzurufen: weil also gebetet werden soll, wird ein Gott hypostasiert;
nicht umgekehrt. Daher ist das Theoretische der Theologie aller Völker
sehr verschieden, an Zahl und Beschaffenheit der Götter: aber daß sie
helfen können und es thun, wenn man ihnen dient und sie anbetet, —
dies haben sie alle gemein; weil es der Punkt ist, darauf es ankommt.
Zugleich aber ist dieses das Muttermal, woran man die Abkunft aller Theologie
erkennt, nämlich, daß sie aus dem Willen, aus dem Herzen entsprungen
sei, nicht aus dem Kopf, oder der Erkenntnis; wie vorgegeben wird. Diesem
entspricht auch, daß der wahre Grund, weshalb Konstantin der Große und
ebenso Chlodowig der Frankenkönig ihre Religion gewechselt haben, dieser
war, daß sie von dem neuen Gott bessere Unterstützung im Kriege hofften.
Einige wenige Völker gibt es, welche, gleichsam das Moll dem Dur vorziehend,
statt der Götter, bloß böse Geister haben, von denen durch Opfer und
Gebete erlangt wird, daß sie nicht schaden. Im Resultat ist, der Hauptsache
nach, kein großer Unterschied. Dergleichen Völker scheinen auch die
Urbewohner der Indischen Halbinseln und Ceylons, vor Einführung des Brahmanismus
und Buddhaismus, gewesen zu sein, und deren Abkömmlinge sollen zum Teil
noch eine solche kakodömonologische Religion haben; wie auch manche wilde
Völker. Daher stammt auch der dem singalesischen Buddhaismus beigemischte
Kappuismus. Imgleichen gehören hieher die von Layard besuchten Teufelsanbeter
in Mesopotamien. — Mit dem dargelegten wahren Ursprung alles Theismus
genau verwandt und ebenso aus der Natur des Menschen ist der Drang, seinen
Göttern Opfer zu bringen, um ihre Gunst zu erkaufen, oder, wenn sie solche
schon bewiesen haben, die Fortdauer derselben zu sichern, oder um Uebel
ihnen abzukaufen. (S. Sanchoniathonis fragmenta, ed. Orelli, Lips. 1826,
p. 42.) Dies ist der Sinn jedes Opfers und eben dadurch der Ursprung und
die Stütze des Daseins aller Götter; so daß man mit Wahrheit sagen
kann, die Götter lebten vom Opfer. Denn eben weil der Drang, den Beistand
übernatürlicher Wesen anzurufen und zu erkaufen, wiewohl ein Kind der
Not und der intellektuellen Beschränktheit, dem Menschen natürlich und
seine Befriedigung ein Bedürfnis ist, schafft er sich Götter. Daher
die Allgemeinheit des Opfers, in allen Zeitaltern und bei den allerverschiedensten
Völkern, und die Identität der Sache, beim größten Unterschiede der
Verhältnisse und Bildungsstufe. So z. B. erzählt Herodot (IV, 152),
daß ein Schiff aus Samos, durch den überaus vorteilhaften Verkauf seiner
Ladung in Tartessos einen unerhört großen Gewinn gehabt habe, worauf
diese Samier den zehnten Teil desselben, der sechs Talente betrug, auf
eine große eherne und sehr kunstvoll gearbeitete Vase verwandt und solche
der Here in ihrem Tempel geschenkt haben. Und als Gegenstück zu diesen
Griechen sehen wir, in unsern Tagen, den armseligen, zur Zwerggestalt
eingeschrumpften, nomadisierenden Renntierlappen sein erübrigtes Geld
an verschiedenen heimlichen Stellen der Felsen und Schlüchte verstecken,
die er keinem bekannt macht, als nur in der Todesstunde seinem Erben,
— bis auf eine, die er auch diesem verschweigt, weil er das dort Hingelegte
dem Genio loci, dem Schutzgott seines Reviers, zum Opfer gebracht hat.
(S. Albrecht Pancritius, Hägringar, Reise durch Schweden, Lappland, Norwegen
und Dänemark im Jahre 1850, Königsberg 1852, S. 162.) — So wurzelt
der Götterglaube im Egoismus. Bloß im Christentum ist das eigentliche
Opfer weggefallen, wiewohl es in Gestalt von Seelenmessen, Kloster-, Kirchen-
und Kapellenbauten noch da ist. Im übrigen aber, und zumal bei den Protestanten,
muß als Surrogat des Opfers Lob, Preis und Dank dienen, die daher zu
den äußersten Superlativen getrieben werden, sogar bei Anlässen, welche
dem Unbefangenen wenig dazu geeignet scheinen: übrigens ist dies dem
analog, daß auch der Staat das Verdienst nicht allemal mit Gaben, sondern
auch mit bloßen Ehrenbezeugungen belohnt und so sich seine Fortwirkung
erhält. In dieser Hinsicht verdient wohl in Erinnerung gebracht zu werden,
was der große David Hume darüber sagt: Whether this god, therefore,
be considered as their peculiar patron, or as the general sovereign of
heaven, his votaries will endeavour, by every art, to insinuate themselves
into his favour; and supposing him to be pleased, like themselves, with
praise and flattery, there is no eulogy or exaggeration, which will be
spared in their addresses to him. ln proportion as men’s fears or distresses
become more urgent, they still invent new strains of adulation; and even
he who outdoes his predecessors in swelling up the titles of his divinity,
is sure tho be outdone bi his successors in newer and more pompous epithets
of praise. Thus they proceed; till at last they arrive at infinity itself,
beyond which there is no farther progress. (Essays and Treatises on several
subjects, London 1777, Vol. II, p. 429.) Ferner: lt appears certain, that,
though the original notions of the vulgar represent de Divinity as a limited
being, and consider him only as the particular cause of health or sickness;
plenty or want; prosperity or adversity; yet when more magnificent ideas
are urged upon them, they esteem it dangerous to refuse their assent.
Will you say, that your deity is finite and bounded in his perfections;
may be overcome by a greater force; is subject to human passions, pains
and infirmities; has a beginning and may have an end? This they dare not
affirm; but thinking it safest to comply with the higher encomiums, they
endeavour, by an affected ravishment and devotion to ingratiate themselves
with him. As a confirmation of this, we may observe, that the assent of
the vulgar is, in this case, merely verbal, and that they are incapablie
of conceiving those sublime qualities which they seemingly attribute to
the Deity. Their real idea of him, notwithstanding their pompous language,
is still as poor and frivolous as ever. (Daselbst p. 432.) [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Nachdem nun Kant, durch seine Kritik der spekulativen Theologie,
dieser den Todesstoß gegeben hatte, mußte er den Eindruck hievon zu
mildern suchen, also ein Besänftigungsmittel, als Anodynon, darauf legen;
analog dem Verfahren Humes, der, im letzten seiner so lesenswerten, wie
unerbittlichen Dialogues on natural religion, uns eröffnet, das alles
wäre nur Spaß gewesen, ein bloßes Exercitium logicum. Dem also entsprechend
gab Kant, als Surrogat der Beweise des Daseins Gottes, sein Postulat der
praktischen Vernunft und die daraus entstehende Moraltheologie, welche,
ohne allen Anspruch auf objektive Gültigkeit für das Wissen, oder die
theoretische Vernunft, volle Gültigkeit in Beziehung auf das Handeln,
oder für die praktische Vernunft, haben sollte, wodurch denn ein Glauben
ohne Wissen begründet wurde, — damit die Leute doch nur etwas in die
Hand kriegten. Seine Darstellung, wenn wohl verstanden, besagt nichts
anderes, als daß die Annahme eines nach dem Tode vergeltenden, gerechten
Gottes ein brauchbares und ausreichendes regulatives Schema sei, zum Behuf
der Auslegung der gefühlten, ernsten, ethischen Bedeutsamkeit unsers
Handelns, wie auch der Leitung dieses Handelns selbst; also gewissermaßen
eine Allegorie der Wahrheit, so daß, in dieser Hinsicht, auf welche allein
es doch zuletzt ankommt, jene Annahme die Stelle der Wahrheit vertreten
könne, wenn sie auch theoretisch, oder objektiv, nicht zu rechtfertigen
sei. — Ein analoges Schema, von gleicher Tendenz, aber viel größerm
Wahrheitsgehalt, stärkerer Plausibilität und demnach unmittelbarerem
Wert, ist das Dogma des Brahmanismus von der vergeltenden Metempsychose,
wonach wir in der Gestalt eines jeden von uns verletzten Wesens einst
müssen wiedergeboren werden, um alsdann dieselbe Verletzung zu erleiden.
— Im angegebenen Sinne also hat man Kants Moraltheologie zu nehmen,
indem man dabei berücksichtigt, daß er selbst nicht so unumwunden, wie
hier geschieht, über das eigentliche Sachverhältnis sich ausdrücken
durfte, sondern, indem er das Monstrum einer theoretischen Lehre von bloß
praktischer Gültigkeit aufstellte, bei den Klügeren auf das Granum salis
gerechnet hat. Die theologischen und philosophischen Schriftsteller dieser
letzteren, der Kantischen Philosophie entfremdeten Zeit haben daher meistens
gesucht, der Sache das Ansehn zu geben, als sei Kants Moraltheologie ein
wirklicher dogmatischer Theismus, ein neuer Beweis des Daseins Gottes.
Das ist sie aber durchaus nicht; sondern sie gilt ganz allein innerhalb
der Moral, bloß zum Behuf der Moral und kein Strohbreit weiter.
Auch ließen nicht einmal die Philosophieprofessoren sich lange daran
genügen; obwohl sie durch Kants Kritik der spekulativen Theologie in
bedeutende Verlegenheit gesetzt waren. Denn von alters her hatten sie
ihren speziellen Beruf darin erkannt, das Dasein und die Eigenschaften
Gottes darzulegen und ihn zum Hauptgegenstand ihres Philosophierens zu
machen; daher, wenn die Schrift lehrt, daß Gott die Raben auf dem Felde
ernährt, ich hinzusetzen muß: und die Philosophieprofessoren auf ihren
Kathedern. Ja, sogar noch heutigestags versichern sie ganz dreist, das
Absolutum (bekanntlich der neumodische Titel für den lieben Gott) und
dessen Verhältnis zur Welt sei das eigentliche Thema der Philosophie,
und dieses näher zu bestimmen, auszumalen und durchzuphantasieren sind
sie nach wie vor beschäftigt. Denn allerdings möchten die Regierungen,
welche für ein dergleichen Philosophieren Geld hergeben, aus den philosophischen
Hörsälen auch gute Christen und fleißige Kirchgänger hervorgehn sehn.
Wie mußte also den Herren von der lukrativen Philosophie zu Mute werden,
als, durch den Beweis, daß alle Beweise der spekulativen Theologie unhaltbar
und daß alle, ihr auserwähltes Thema betreffenden Erkenntnisse unserm
Intellekt schlechterdings unzugänglich seien, Kant ihnen das Konzept
so sehr weit verrückt hatte? Sie hatten sich anfänglich durch ihr bekanntes
Hausmittel, das Ignorieren, dann aber durch Bestreiten zu helfen gesucht:
aber das hielt auf die Länge nicht Stich. Da haben sie denn sich auf
die Behauptung geworfen, das Dasein Gottes sei zwar keines Beweises fähig,
bedürfe aber auch desselben nicht; denn es verstände sich von selbst,
wäre die ausgemachteste Sache von der Welt, wir könnten es gar nicht
bezweifeln, wir hätten ein „Gottesbewußtsein“, unsre Vernunft wäre
das Organ für unmittelbare Erkenntnisse von überweltlichen Dingen, die
Belehrung über diese würde unmittelbar von ihr vernommen, und darum
eben heiße sie Vernunft! (Ich bitte freundlichst, hier meine Abhandlung
über den Satz vom Grunde in der 2. Aufl. § 34, desgleichen meine Grundprobleme
der Ethik S. 148—154 (2. Aufl. S. 146—151), endlich auch meine Kritik
der Kantischen Philosophie S. 584—585, 3. Aufl. S. 617—618 nachzusehn.)
Von der Genesis dieses Gottesbewußtseins haben wir kürzlich eine, in
dieser Hinsicht merkwürdige bildliche Darstellung erhalten, nämlich
einen Kupferstich, der uns eine Mutter zeigt, die ihr dreijähriges, mit
gefalteten Händen auf dem Bette knieendes Kind zum Beten abrichtet; gewiß
ein häufiger Vorgang, der eben die Genesis des Gottesbewußtseins ausmacht;
denn es ist nicht zu bezweifeln, daß nachdem, im zartesten Alter, das
im ersten Wachstum begriffene Gehirn so zugerichtet worden, ihm das Gottesbewußtsein
so fest eingewachsen ist, als wäre es wirklich angeboren. — *) Nach
andern lieferte die Vernunft jedoch bloße Ahndungen; hingegen wieder
andere hatten gar intellektuale Anschauungen! Abermals andere erfanden
das absolute Denken, d. i. ein solches, bei welchen der Mensch sich nicht
nach den Dingen umzusehn braucht, sondern, in göttlicher Allwissenheit,
bestimmt, wie sie ein für allemal seien. Dies ist unstreitig die bequemste
unter allen jenen Erfindungen. Sämtlich aber griffen sie zum Wort „Absolutum“,
welches eben nichts anderes ist, als der kosmologische Beweis in nuce,
oder vielmehr in einer so starken Zusammenziehung, daß er, mikroskopisch
geworden, sich den Augen entzieht, so unerkannt durchschlüpft und nun
für etwas sich von selbst Verstehendes ausgegeben wird: denn in seiner
wahren Gestalt darf er seit dem Kantischen Examen rigorosum, sich nicht
mehr blicken lassen; wie ich dies in der 2. Aufl. meiner Abhandlung über
den Satz vom Grunde S. 36 ff. und auch in meiner Kritik der Kantischen
Philosophie S. 544 (3. Aufl. S. 574) näher ausgeführt habe. Wer zuerst,
vor ungefähr 50 Jahren, den Pfiff gebraucht habe, unter diesem alleinigen
Wort Absolutum den explodierten und proskribierten kosmologischen Beweis
inkognito einzuschwärzen, weiß ich nicht mehr anzugeben: aber der Pfiff
war den Fähigkeiten des Publikums richtig angemessen: denn bis auf den
heutigen Tag kursiert Absolutum als bare Münze. Kurzum, es hat den Philosophieprofessoren,
trotz der Kritik der Vernunft und ihren Beweisen, noch nie an authentischen
Nachrichten vom Dasein Gottes und seinem Verhältnis zur Welt gefehlt,
in deren ausführlicher Mitteilung, nach ihnen, das Philosophieren ganz
eigentlich bestehen soll. Allein, wie man sagt, „kupfernes Geld kupferne
Ware“, so ist dieser bei ihnen sich von selbst verstehende Gott eben
auch danach: er hat weder Hand, noch Fuß. Darum halten sie mit ihm so
hinterm Berge, oder vielmehr hinter einem schallenden Wortgebäude, daß
man kaum einen Zipfel von ihm gewahr wird. Wenn man sie nur zwingen könnte,
sich deutlich darüber zu erklären, was bei dem Worte Gott so eigentlich
zu denken sei; dann würden wir sehn, ob er sich von selbst versteht.
Nicht einmal eine Natura naturans (in die ihr Gott oft überzugehn droht)
versteht sich von selbst; da wir den Leukipp, Demokrit, Epikur und Lukrez
ohne eine solche die Welt aufbauen sehn: diese Männer aber waren, bei
allen ihren Irrtümern, immer noch mehr wert, als eine Legion Wetterfahnen,
deren Erwerbsphilosophie sich nach dem Winde dreht. Eine Natura naturans
wäre aber noch lange kein Gott. Im Begriffe derselben ist vielmehr bloß
die Einsicht enthalten, daß hinter den so sehr vergänglichen und rastlos
wechselnden Erscheinungen der Natura naturata eine unvergängliche und
unermüdliche Kraft verborgen liegen müsse, vermöge deren jene sich
stets erneuerten, indem vom Untergange derselben sie selbst nicht mitgetroffen
würde. Wie die Natura naturata der Gegenstand der Physik ist, so die
Natura naturans der der Metaphysik. Diese wird zuletzt uns darauf führen,
daß auch wir selbst zur Natur gehören, und folglich sowohl von Natura
naturata als von Natura naturans nicht nur das nächste und deutlichste,
sondern sogar das einzige uns auch von innen zugängliche Spezimen an
uns selbst besitzen. Da sodann die ernste und genaue Reflexion auf uns
selbst uns als den Kern unsres Wesens den Willen erkennen läßt; so haben
wir daran eine unmittelbare Offenbarung der Natura naturans, die wir danach
auf alle übrigen, uns nur einseitig bekannten Wesen zu übertragen befugt
sind. So gelangen wir dann zu der großen Wahrheit, daß die Natura naturans,
oder das Ding an sich, der Wille in unserm Herzen; die Natura naturata
aber, oder die Erscheinung, die Vorstellung in unserm Kopfe ist. Von diesem
Resultate jedoch auch abgesehn, ist so viel offenbar, daß die bloße
Unterscheidung der Natura naturans und naturata noch lange kein Theismus,
ja noch nicht einmal Pantheismus ist; da zu diesem (wenn er nicht bloße
Redensart sein soll) die Hinzufügung gewisser moralischer Eigenschaften
erfordert wäre, die der Welt offenbar nicht zukommen, z. B. Güte, Weisheit,
Glückseligkeit u. s. w. Ueberdies ist Pantheismus ein sich selbst aufhebender
Begriff; weil der Begriff eines Gottes eine von ihm verschiedene Welt,
als wesentliches Korrelat desselben, voraussetzt. Soll hingegen die Welt
selbst seine Rolle übernehmen, so bleibt eben eine absolute Welt, ohne
Gott; daher Pantheismus nur eine Euphemie für Atheismus ist. Dieser letztere
Ausdruck aber enthält seinerseits eine Erschleichung, indem er vorweg
annimmt, der Theismus verstehe sich von selbst, wodurch er das Affirmanti
incumbit probatio schlau umgeht; während vielmehr der sogenannte Atheismus
das Jus primi occupantis hat und erst vom Theismus aus dem Felde geschlagen
werden muß. [...]
*) Ueberhaupt aber ist ein dergleichen Verfahren, gleichviel worauf es
angewandt wird, anzusehn als die Inokulation einer fixen Idee: welche
es auch sein möge, und wäre sie noch so toll; sie wird haften, bis an
sein Ende, und ihm für angeboren gelten, für unmittelbare Offenbarung
und Gott weiß was.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In der That ist das Ding an sich auf diesem Wege nimmermehr zu erreichen,
und überhaupt nicht auf dem der rein objektiven Erkenntnis, als welche
immer Vorstellung bleibt, als solche aber im Subjekt wurzelt und nie etwas
von der Vorstellung wirklich Verschiedenes liefern kann. Sondern nur dadurch
kann man zum Dinge an sich gelangen, daß man einmal den Standpunkt verlegt,
nämlich statt wie bisher immer nur von dem auszugehn, was vorstellt,
einmal ausgeht von dem was vorgestellt wird. Dies ist jedem aber nur bei
einem einzigen Dinge möglich, als welches ihm auch von innen zugänglich
und dadurch ihm auf zweifache Weise gegeben ist: es ist sein eigener Leib,
der, in der objektiven Welt, eben auch als Vorstellung im Raume dasteht,
zugleich aber sich dem eigenen Selbstbewußtsein als Wille kundgibt. Dadurch
aber liefert er den Schlüssel aus, zunächst zum Verständnis aller seiner
durch äußere Ursachen (hier Motive) hervorgerufenen Aktionen und Bewegungen,
als welche, ohne diese innere und unmittelbare Einsicht in ihr Wesen,
uns ebenso unverständlich und unerklärbar bleiben würden, wie die nach
Naturgesetzen und als Aeußerungen der Naturkräfte eintretenden Veränderungen
der uns in objektiver Anschauung allein gegebenen übrigen Körper; und
sodann zu dem des bleibenden Substrats aller dieser Aktionen, in welchem
die Kräfte zu denselben wurzeln, — also dem Leibe selbst. Diese unmittelbare
Erkenntnis, welche jeder vom Wesen seiner eigenen, ihm außerdem ebenfalls
nur in der objektiven Anschauung, gleich allen andern, gegebenen Erscheinung
hat, muß nachher auf die übrigen, in letzterer Weise allein gegebenen
Erscheinungen analogisch übertragen werden und wird alsdann der Schlüssel
zur Erkenntnis des innern Wesens der Dinge, d. h. der Dinge an sich selbst.
Zu dieser also kann man nur gelangen auf einem, von der rein objektiven
Erkenntnis, welche bloße Vorstellung bleibt, ganz verschiedenen Wege,
indem man nämlich das Selbstbewußtsein des immer nur als animalisches
Individuum auftretenden Subjekts der Erkenntnis zur Hilfe nimmt und es
zum Ausleger des Bewußtseins andrer Dinge, d. i. des anschauenden Intellekts
macht. Dies ist der Weg, den ich gegangen bin, und es ist der allein rechte,
die enge Pforte zur Wahrheit. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] So bildet sich demnach schon in den Kinderjahren die feste Grundlage
unserer Weltansicht, mithin auch das Flache, oder Tiefe, derselben: sie
wird später ausgeführt und vollendet; jedoch nicht im wesentlichen verändert.
Also infolge dieser rein objektiven und dadurch poetischen Ansicht, die
dem Kindesalter wesentlich ist und davon unterstützt wird, daß der Wille
noch lange nicht mit seiner vollen Energie auftritt, verhalten wir uns,
als Kinder, bei weitem mehr rein erkennend als wollend. Daher der ernste,
schauende Blick mancher Kinder, welchen Raphael zu seinen Engeln, zumal
denen der Sixtinischen Madonna, so glücklich benutzt hat. Eben dieserhalb
sind denn auch die Kinderjahre so selig, daß die Erinnerung an sie stets
von Sehnsucht begleitet ist. — Während wir nun, mit solchem Ernst,
dem ersten anschaulichen Verständnis der Dinge obliegen, ist andrerseits
die Erziehung bemüht, uns Begriffe beizubringen. Allein Begriffe liefern
nicht das eigentlich Wesentliche: vielmehr liegt dieses, also der Fonds
und echte Gehalt aller unserer Erkenntnisse, in der anschaulichen Auffassung
der Welt. Diese aber kann nur von uns selbst gewonnen, nicht auf irgend
eine Weise uns beigebracht werden. Daher kommt, wie unser moralischer,
so auch unser intellektueller Wert nicht von außen in uns, sondern geht
aus der Tiefe unsers eigenen Wesens hervor, und können keine Pestalozzische
Erziehungskünste aus einem geborenen Tropf einen denkenden Menschen bilden:
nie! er ist als Tropf geboren und muß als Tropf sterben. — Aus der
beschriebenen, tiefsinnigen Auffassung der ersten anschaulichen Außenwelt
erklärt sich denn auch, warum die Umgebungen und Erfahrungen unserer
Kindheit sich so fest dem Gedächtnis einprägen. Wir sind nämlich ihnen
ungeteilt hingegeben gewesen, nichts hat uns dabei zerstreut und wir haben
die Dinge, welche vor uns standen, angesehn, als wären sie die einzigen
ihrer Art, ja, überhaupt allein vorhanden. Später nimmt uns die dann
bekannte Menge der Gegenstände Mut und Geduld. — Wenn man nun hier
sich zurückrufen will, was ich S. 372 ff. der Ergänzungen zur „Welt
als Wille und Vorst.“ (Bd. 5, S. 212 ff. dieser Gesamtausg.) dargethan
habe, daß nämlich das objektive Dasein aller Dinge, d. h. ihr Dasein
in der bloßen Vorstellung, ein durchweg erfreuliches, hingegen ihr subjektives
Dasein, als welches im Wollen besteht, mit Schmerz und Trübsal stark
versetzt ist; so wird man als kurzen Ausdruck der Sache auch wohl den
Satz gelten lassen: alle Dinge sind herrlich zu sehn, aber schrecklich
zu sein. Dem obigen nun zufolge sind, in der Kindheit, die Dinge uns viel
mehr von der Seite des Sehns, also der Vorstellung, der Objektivität,
bekannt, als von der Seite des Seins, welche die des Willens ist. Weil
nun jene die erfreuliche Seite der Dinge ist, die subjektive und schreckliche
uns aber noch unbekannt bleibt; so hält der junge Intellekt alle jene
Gestalten, welche Wirklichkeit und Kunst ihm vorführen, für ebenso viele
glückselige Wesen: er meint, so schön sie zu sehn sind, und noch viel
schöner, wären sie zu sein. Demnach liegt die Welt vor ihm, wie ein
Eden: dies ist das Arkadien, in welchem wir alle geboren sind. Daraus
entsteht etwas später der Durst nach dem wirklichen Leben, der Drang
nach Thaten und Leiden, welcher uns ins Weltgetümmel treibt. In diesem
lernen wir dann die andere Seite der Dinge kennen, die des Seins, d. i.
des Wollens, welches bei jedem Schritte durchkreuzt wird. Dann kommt allmählich
die große Enttäuschung heran, nach deren Eintritt heißt es l’àge
des illusions est passè: und doch geht sie noch immer weiter, wird immer
vollständiger. Demzufolge kann man sagen, daß in der Kindheit das Leben
sich uns darstellt wie eine Theaterdekoration von weitem gesehn; im Alter,
wie dieselbe in der größten Nähe. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Zum Glücke der Kindheit trägt endlich noch folgendes bei. Wie
im Anfange des Frühlings alles Laub die gleiche Farbe und fast die gleiche
Gestalt hat; so sind auch wir, in früher Kindheit, alle einander ähnlich,
harmonieren daher vortrefflich. Aber mit der Pubertät fängt die Divergenz
an und wird, wie die der Radien eines Zirkels, immer größer.
Was nun den Rest der ersten Lebenshälfte, die so viele Vorzüge vor der
zweiten hat, also das jugendliche Alter, trübt, ja unglücklich macht,
ist das Jagen nach Glück, in der festen Voraussetzung, es müsse im Leben
anzutreffen sein. Daraus entspringt die fortwährend getäuschte Hoffnung
und aus dieser die Unzufriedenheit. Gaukelnde Bilder eines geträumten,
unbestimmten Glückes schweben, unter kaprizios gewählten Gestalten,
uns vor, und wir suchen vergebens ihr Urbild. Daher sind wir in unsern
Jünglingsjahren mit unserer Lage und Umgebung, welche sie auch sei, meistens
unzufrieden; weil wir ihr zuschreiben, was der Leerheit und Armseligkeit
des menschlichen Lebens überall zukommt, und mit der wir jetzt die erste
Bekanntschaft machen, nachdem wir ganz andere Dinge erwartet hatten. —
Man hätte viel gewonnen, wenn man, durch zeitige Belehrung, den Wahn,
daß in der Welt viel zu holen sei, in den Jünglingen ausrotten könnte.
Aber das Umgekehrte geschieht dadurch, daß meistens uns das Leben früher
durch die Dichtung, als durch die Wirklichkeit bekannt wird. Die von jener
geschilderten Scenen prangen, im Morgenrot unserer eigenen Jugend, vor
unserm Blick, und nun peinigt uns die Sehnsucht, sie verwirklicht zu sehn,
— den Regenbogen zu fassen. Der Jüngling erwartet seinen Lebenslauf
in Form eines interessanten Romans. So entsteht die Täuschung, welche
ich S. 374 des schon erwähnten Bandes (Bd. 5, S. 215 f. dieser Gesamtausg.)
bereits geschildert habe. Denn was allen jenen Bildern ihren Reiz verleiht,
ist gerade dies, daß sie bloße Bilder und nicht wirklich sind, und wir
daher, bei ihrem Anschauen, uns in der Ruhe und Allgenugsamkeit des reinen
Erkennens befinden. Verwirklicht werden heißt mit dem Wollen ausgefüllt
werden, welches Wollen unausweichbare Schmerzen herbeiführt. Auch noch
auf die Stelle S. 427 (Bd. 5, S. 275 dieser Gesamtausg.) des erwähnten
Bandes sei der teilnehmende Leser hier hingewiesen.
Ist sonach der Charakter der ersten Lebenshälfte unbefriedigte Sehnsucht
nach Glück; so ist der der zweiten Besorgnis vor Unglück. Denn mit ihr
ist, mehr oder weniger deutlich, die Erkenntnis eingetreten, daß alles
Glück chimärisch, hingegen das Leiden real sei. Jetzt wird daher, wenigstens
von den vernünftigeren Charakteren, mehr bloße Schmerzlosigkeit und
ein unangefochtener Zustand, als Genuß angestrebt *). — Wenn, in meinen
Jünglingsjahren, es an meiner Thür schellte, wurde ich vergnügt: denn
ich dachte, nun käme es. Aber in spätern Jahren hatte meine Empfindung,
bei demselben Anlaß, vielmehr etwas dem Schrecken Verwandtes: ich dachte:
„da kommt’s“. — Hinsichtlich der Menschenwelt gibt es, für ausgezeichnete
und begabte Individuen, die, eben als solche, nicht so ganz eigentlich
zu ihr gehören und demnach, mehr oder weniger, je nach dem Grad ihrer
Vorzüge, allein stehn, ebenfalls zwei entgegengesetzte Empfindungen:
in der Jugend hat man häufig die, von ihr verlassen zu sein; in spätern
Jahren hingegen die, ihr entronnen zu sein. Die erstere, eine unangenehme,
beruht auf Unbekanntschaft, die zweite, eine angenehme, auf Bekanntschaft
mit ihr. — Infolge davon enthält die zweite Hälfte des Lebens, wie
die zweite Hälfte einer musikalischen Periode, weniger Strebsamkeit,
aber mehr Beruhigung, als die erste, welches überhaupt darauf beruht,
daß man in der Jugend denkt, in der Welt sei wunder was für Glück und
Genuß anzutreffen, nur schwer dazu zu gelangen; während man im Alter
weiß, daß da nichts zu holen ist, also, vollkommen darüber beruhigt,
eine erträgliche Gegenwart genießt, und sogar an Kleinigkeiten Freude
hat. — Was der gereifte Mann durch die Erfahrung seines Lebens erlangt
hat und wodurch er die Welt anders sieht, als der Jüngling und Knabe,
ist zunächst Unbefangenheit. Er allererst sieht die Dinge ganz einfach
und nimmt sie für das, was sie sind; während dem Knaben und Jüngling
ein Trugbild, zusammengesetzt aus selbstgeschaffenen Grillen, überkommenen
Vorurteilen und seltsamen Phantasien, die wahre Welt bedeckte, oder verzerrte.
Denn das erste, was die Erfahrung zu thun vorfindet, ist uns von den Hirngespinsten
und falschen Begriffen zu befreien, welche sich in der Jugend angesetzt
haben. Vor diesen das jugendliche Alter zu bewahren, wäre allerdings
die beste Erziehung, wenngleich nur eine negative; ist aber sehr schwer.
Man müßte, zu diesem Zwecke, den Gesichtskreis des Kindes anfangs möglichst
enge halten, innerhalb desselben jedoch ihm lauter deutliche und richtige
Begriffe beibringen, und erst nachdem es alles darin Gelegene richtig
erkannt hätte, denselben allmählich erweitern, stets dafür sorgend,
daß nichts Dunkeles, auch nichts halb oder schief Verstandenes, zurückbliebe.
Infolge hievon würden seine Begriffe von Dingen und menschlichen Verhältnissen,
immer noch beschränkt und sehr einfach, dafür aber deutlich und richtig
sein, so daß sie stets nur der Erweiterung, nicht der Berichtigung bedürften;
und so fort bis ins Jünglingsalter hinein. Diese Methode erfordert insbesondere,
daß man keine Romane zu lesen erlaube, sondern sie durch angemessene
Biographien ersetze, wie z. B. die Franklins, den Anton Reiser von Moritz
u. dgl. —
Wann wir jung sind, vermeinen wir, daß die in unserm Lebenslauf wichtigen
und folgenreichen Begebenheiten und Personen mit Pauken und Trompeten
auftreten werden: im Alter zeigt jedoch die retrospektive Betrachtung,
daß sie alle ganz still, durch die Hinterthür und fast unbeachtet hereingeschlichen
sind.
Man kann ferner, in der bis hieher betrachten Hinsicht, das Leben mit
einem gestickten Stoffe vergleichen, von welchem jeder, in der ersten
Hälfte seiner Zeit, die rechte, in der zweiten aber die Kehrseite zu
sehn bekäme: letztere ist nicht so schön, aber lehrreicher; weil sie
den Zusammenhang der Fäden erkennen läßt. —
Die geistige Ueberlegenheit, sogar die größte, wird, in der Konversation,
ihr entschiedenes Uebergewicht erst nach dem vierzigsten Jahre geltend
machen. Denn die Reife der Jahre und die Frucht der Erfahrung kann durch
jene wohl vielfach übertroffen, jedoch nie ersetzt werden: sie aber gibt
auch dem gewöhnlichsten Menschen ein gewisses Gegengewicht gegen die
Kräfte des größten Geistes, solange dieser jung ist. Ich meine hier
bloß das Persönliche, nicht die Werke. — [...]
*) Im Alter versteht man besser die Unglücksfälle zu verhüten; in der
Jugend sie zu ertragen.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Jeder irgend vorzügliche Mensch, jeder, der nur nicht zu den von
der Natur so traurig dotierten fünf Sechstel der Menschheit gehört,
wird, nach dem vierzigsten Jahre, von einem gewissen Anfluge von Misanthropie
schwerlich frei bleiben. Denn er hatte, wie es natürlich ist, von sich
auf andere geschlossen und ist allmählich enttäuscht worden, hat eingesehn,
daß sie entweder von der Seite des Kopfes, oder des Herzens, meistens
sogar beider, ihm in Rückstand bleiben und nicht quitt mit ihm werden;
weshalb er sich mit ihnen einzulassen gern vermeidet; wie denn überhaupt
jeder nach Maßgabe seines inneren Wertes die Einsamkeit, d. h. seine
eigene Gesellschaft, lieben oder hassen wird. Von dieser Art der Misanthropie
handelt auch Kant, in der Kritik der Urteilskraft, gegen das Ende der
allgemeinen Anmerkung zum § 29 des ersten Teils.
An einem jungen Menschen ist es, in intellektueller und auch in moralischer
Hinsicht, ein schlechtes Zeichen, wenn er im Thun und Treiben der Menschen
sich recht früh zurechtzufinden weiß, sogleich darin zu Hause ist, und,
wie vorbereitet, in dasselbe eintritt: es kündigt Gemeinheit an. Hingegen
deutet, in solcher Beziehung, ein befremdetes, stutziges, ungeschicktes
und verkehrtes Benehmen auf eine Natur edlerer Art.
Die Heiterkeit und der Lebensmut unserer Jugend beruht zum Teil darauf,
daß wir, bergauf gehend, den Tod nicht sehn; weil er am Fuß der andern
Seite des Berges liegt. Haben wir aber den Gipfel überschritten, dann
werden wir den Tod, welchen wir bis dahin nur von Hörensagen kannten,
wirklich ansichtig, wodurch, da zu derselben Zeit die Lebenskraft zu ebben
beginnt, auch der Lebensmut sinkt; so daß jetzt ein trüber Ernst den
jugendlichen Uebermut verdrängt und auch dem Gesichte sich aufdrückt.
Solange wir jung sind, man mag uns sagen, was man will, halten wir das
Leben für endlos und gehn danach mit der Zeit um. Je älter wir werden,
desto mehr ökonomisieren wir unsere Zeit. Denn im spätern Alter erregt
jeder verlebte Tag eine Empfindung, welche der verwandt ist, die bei jedem
Schritt ein zum Hochgericht geführter Delinquent hat.
Vom Standpunkte der Jugend aus gesehn, ist das Leben eine unendlich lange
Zukunft; vom Standpunkt des Alters aus, eine sehr kurze Vergangenheit;
so daß es anfangs sich uns darstellt wie die Dinge, wann wir das Objektivglas
des Opernguckers ans Auge legen, zuletzt aber wie wann das Okular. Man
muß alt geworden sein, also lange gelebt haben, um zu erkennen, wie kurz
das Leben ist. — Je älter man wird, desto kleiner erscheinen die menschlichen
Dinge samt und sonders: das Leben, welches in der Jugend als fest und
stabil vor uns stand, zeigt sich uns jetzt als die rasche Flucht ephemerer
Erscheinungen: die Nichtigkeit des Ganzen tritt hervor. — Die Zeit selbst
hat in unserer Jugend einen viel langsameren Schritt; daher das erste
Viertel unsers Lebens nicht nur das glücklichste, sondern auch das längste
ist, so daß es viel mehr Erinnerungen zurückläßt, und jeder, wenn
es darauf ankäme, aus demselben mehr zu erzählen wissen würde, als
aus zweien der folgenden. Sogar werden, wie im Frühling des Jahres, so
auch in dem des Lebens, die Tage zuletzt von einer lästigen Länge. Im
Herbste beider werden sie kurz, aber heiterer und beständiger.
Warum nun aber erblickt man, im Alter, das Leben, welches man hinter sich
hat, so kurz? Weil man es für so kurz hält, wie die Erinnerung desselben
ist. Aus dieser nämlich ist alles Unbedeutende und viel Unangenehmes
herausgefallen, daher wenig übrig geblieben. Denn, wie unser Intellekt
überhaupt sehr unvollkommen ist, so auch das Gedächtnis: das Erlernte
muß geübt, das Vergangene ruminiert werden, wenn nicht beides allmählich
in den Abgrund der Vergessenheit versinken soll. Nun aber pflegen wir
nicht das Unbedeutende, auch meistens nicht das Unangenehme zu ruminieren;
was doch nötig wäre, um es im Gedächtnis aufzubewahren. Des Unbedeutenden
wird aber immer mehr: denn durch die öftere und endlich zahllose Wiederkehr
wird vielerlei, das anfangs uns bedeutend erschien, allmählich unbedeutend;
daher wir uns der früheren Jahre besser, als der späteren erinnern.
Je länger wir nun leben, desto weniger Vorgänge scheinen uns wichtig,
oder bedeutend genug, um hinterher noch ruminiert zu werden, wodurch allein
sie im Gedächtnis sich fixieren könnten: sie werden also vergessen,
sobald sie vorüber sind. So läuft denn die Zeit immer spurloser ab.
— Nun ferner das Unangenehme ruminieren wir nicht gern, am wenigsten
aber dann, wann es unsere Eitelkeit verwundet, welches sogar meistens
der Fall ist; weil wenige Leiden uns ganz ohne unsere Schuld getroffen
haben. Daher also wird ebenfalls viel Unangenehmes vergessen. Beide Ausfälle
nun sind es, die unsere Erinnerung so kurz machen, und verhältnismäßig
immer kürzer, je länger ihr Stoff wird. Wie die Gegenstände auf dem
Ufer, von welchem man zu Schiffe sich entfernt, immer kleiner, unkenntlicher
und schwerer zu unterscheiden werden; so unsere vergangenen Jahre, mit
ihren Erlebnissen und ihrem Thun. Hiezu kommt, daß bisweilen Erinnerung
und Phantasie uns eine längst vergangene Scene unseres Lebens so lebhaft
vergegenwärtigen, wie den gestrigen Tag; wodurch sie dann ganz nahe an
uns herantritt; dies entsteht dadurch, daß es unmöglich ist, die lange
zwischen jetzt und damals verstrichene Zeit uns ebenso zu vergegenwärtigen,
indem sie sich nicht so in einem Bilde überschauen läßt, und überdies
auch die Vorgänge in derselben größtenteils vergessen sind, und bloß
eine allgemeine Erkenntnis in abstracto von ihr übrig geblieben ist,
ein bloßer Begriff, keine Anschauung. Daher nun also erscheint das längst
Vergangene im einzelnen uns so nahe, als wäre es erst gestern gewesen,
die dazwischen liegende Zeit aber verschwindet und das ganze Leben stellt
sich als unbegreiflich kurz dar. Sogar kann bisweilen im Alter die lange
Vergangenheit, die wir hinter uns haben, und damit unser eigenes Alter,
im Augenblick uns beinahe fabelhaft vorkommen; welches hauptsächlich
dadurch entsteht, daß wir zunächst noch immer dieselbe, stehende Gegenwart
vor uns sehn. Dergleichen innere Vorgänge beruhen aber zuletzt darauf,
daß nicht unser Wesen an sich selbst, sondern nur die Erscheinung desselben
in der Zeit liegt, und daß die Gegenwart der Berührungspunkt zwischen
Objekt und Subjekt ist. — Und warum nun wieder erblickt man in der Jugend
das Leben, welches man noch vor sich hat, so unabsehbar lang? Weil man
Platz haben muß für die grenzenlosen Hoffnungen, mit denen man es bevölkert,
und zu deren Verwirklichung Methusalem zu jung stürbe; sodann weil man
zum Maßstabe desselben die wenigen Jahre nimmt, welche man schon hinter
sich hat, und deren Erinnerung stets stoffreich, folglich lang ist, indem
die Neuheit alles bedeutend erscheinen ließ, weshalb es hinterher noch
ruminiert, also oft in der Erinnerung wiederholt und dadurch ihr eingeprägt
wurde.
Bisweilen glauben wir, uns nach einem fernen Orte zurückzusehnen, während
wir eigentlich uns nur nach der Zeit zurücksehnen, die wir dort verlebt
haben, da wir jünger und frischer waren. So täuscht uns alsdann die
Zeit unter der Maske des Raumes. Reisen wir hin, so werden wir der Täuschung
inne. — [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Ein hohes Alter zu erreichen, gibt es, bei fehlerfreier Konstitution,
als conditio sine qua non, zwei Wege, die man am Brennen zweier Lampen
erläutern kann: die eine brennt lange, weil sie, bei wenigem Oel, einen
sehr dünnen Docht hat; die andere, weil sie, zu einem starken Docht,
auch viel Oel hat: das Oel ist die Lebenskraft, der Docht der Verbrauch
derselben, auf jede Art und Weise.
Hinsichtlich der Lebenskraft sind wir, bis zum sechsunddreißigsten Jahre,
denen zu vergleichen, welche von ihren Zinsen leben: was heute ausgegeben
wird ist morgen wieder da. Aber von jenem Zeitpunkt an ist unser Analogon
der Rentenier, welcher anfängt, sein Kapital anzugreifen. Im Anfang ist
die Sache gar nicht merklich: der größte Teil der Ausgabe stellt sich
immer noch von selbst wieder her: ein geringes Deficit dabei wird nicht
beachtet. Dieses aber wächst allmählich, wird merklich, seine Zunahme
selbst nimmt mit jedem Tage zu: sie reißt immer mehr ein, jedes Heute
ist ärmer, als das Gestern, ohne Hoffnung auf Stillstand. So beschleunigt
sich, wie der Fall der Körper, die Abnahme immer mehr, — bis zuletzt
nichts mehr übrig ist. Ein gar trauriger Fall ist es, wenn beide hier
Verglichene, Lebenskraft und Eigentum wirklich zusammen im Wegschmelzen
begriffen sind: daher eben wächst mit dem Alter die Liebe zum Besitze.
— Hingegen anfangs, bis zur Volljährigkeit und noch etwas darüber
hinaus, gleichen wir, hinsichtlich der Lebenskraft, denen, welche von
den Zinsen noch etwas zum Kapitale legen: nicht nur das Ausgegebene stellt
sich von selbst wieder ein, sondern das Kapital wächst. Und wieder ist
auch dieses bisweilen, durch die Fürsorge eines redlichen Vormundes,
zugleich mit dem Gelde der Fall. O glückliche Jugend! o trauriges Alter!
— Nichtsdestoweniger soll man die Jugendkräfte schonen. Aristoteles
bemerkt (Polit. L. ult. c. 5), daß von den olympischen Siegern nur zwei
oder drei einmal als Knaben und dann wieder als Männer gesiegt hätten;
weil durch die frühe Anstrengung, welche die Vorübung erfordert, die
Kräfte so erschöpft werden, daß sie nachmals, im Mannesalter, fehlen.
Wie dies von der Muskelkraft gilt, so noch mehr von der Nervenkraft, deren
Aeußerung alle intellektuelle Leistungen sind: daher werden die ingenia
praecocia, die Wunderkinder, die Früchte der Treibhauserziehung, welche
als Knaben Erstaunen erregen, nachmals sehr gewöhnliche Köpfe. Sogar
mag die frühe, erzwungene Anstrengung zur Erlernung der alten Sprachen
schuld haben an der nachmaligen Lahmheit und Urteilslosigkeit so vieler
gelehrter Köpfe. —
Ich habe die Bemerkung gemacht, daß der Charakter fast jedes Menschen
einem Lebensalter vorzugsweise angemessen zu sein scheint; so daß er
in diesem sich vorteilhafter ausnimmt. Einige sind liebenswürdige Jünglinge,
und dann ist`s vorbei; andere kräftige, thätige Männer, denen das Alter
allen Wert raubt; manche stellen sich am vorteilhaftesten im Alter dar,
als wo sie milder, weil erfahrener und gelassener sind: dies ist oft bei
Franzosen der Fall. Die Sache muß darauf beruhen, daß der Charakter
selbst etwas Jugendliches, Männliches, oder Aeltliches an sich hat, womit
das jedesmalige Lebensalter übereinstimmt, oder als Korrektiv entgegenwirkt.
Wie man, auf einem Schiffe befindlich, sein Vorwärtskommen nur am Zurückweichen
und demnach Kleinerwerden der Gegenstände auf dem Ufer bemerkt; so wird
man sein Alt-und-älter-werden daran inne, daß Leute von immer höhern
Jahren einem jung vorkommen.
Schon oben ist erörtert worden, wie und warum alles, was man sieht, thut
und erlebt, je älter man wird, desto wenigere Spuren im Geiste zurückläßt.
In diesem Sinne ließe sich behaupten, daß man allein in der Jugend mit
vollem Bewußtsein lebte; im Alter nur noch mit halbem. Je älter man
wird, mit desto wenigerem Bewußtsein lebt man: die Dinge eilen vorüber,
ohne Eindruck zu machen; wie das Kunstwerk, welches man tausendmal gesehn
hat, keinen macht: man thut was man zu thun hat, und weiß hinterher nicht,
ob man es gethan. Indem nun also das Leben immer unbewußter wird, je
mehr es der gänzlichen Bewußtlosigkeit zueilt, so wird eben dadurch
der Lauf der Zeit auch immer schleuniger. In der Kindheit bringt die Neuheit
aller Gegenstände und Begebenheiten jegliches zum Bewußtsein: daher
ist der Tag unabsehbar lang. Dasselbe widerfährt uns auf Reisen, wo deshalb
ein Monat länger erscheint, als vier zu Hause. Diese Neuheit der Dinge
verhindert jedoch nicht, daß die, in beiden Fällen, länger scheinende
Zeit uns auch in beiden oft wirklich „lang wird“, mehr als im Alter,
oder mehr als zu Hause. Allmählich aber wird, durch die lange Gewohnheit
derselben Wahrnehmungen, der Intellekt so abgeschliffen, daß immer mehr
alles wirkungslos darüber hingleitet; wodurch dann die Tage immer unbedeutender
und dadurch kürzer werden: die Stunden des Knaben sind länger, als die
Tage des Alten. Demnach hat die Zeit unsers Lebens eine beschleunigte
Bewegung, wie die einer herabrollenden Kugel; und wie auf einer sich drehenden
Scheibe jeder Punkt um so schneller läuft, als er weiter vom Centro abliegt;
so verfließt jedem, nach Maßgabe seiner Entfernung vom Lebensanfange,
die Zeit schneller und immer schneller. Man kann demzufolge annehmen,
daß, in der unmittelbaren Schätzung unsers Gemütes, die Länge eines
Jahres im umgekehrten Verhältnisse des Quotienten desselben in unser
Alter steht: wann z. B. das Jahr ein Fünftel unsers Alters beträgt,
erscheint es uns zehnmal so lang, als wann es nur ein Fünfzigstel desselben
ausmacht. Diese Verschiedenheit in der Geschwindigkeit der Zeit hat auf
die ganze Art unsers Daseins in jedem Lebensalter den entschiedensten
Einfluß. Zunächst bewirkt sie, daß das Kindesalter, wenn auch nur etwan
fünfzehn Jahre umfassend, doch die längste Zeit des Lebens, und daher
die reichste an Erinnerungen ist; sodann daß wir durchweg der Langenweile
im umgekehrten Verhältnis unsers Alters unterworfen sind: Kinder bedürfen
beständig des Zeitvertreibs, sei er Spiel oder Arbeit; stockt er, so
ergreift sie augenblicklich entsetzliche Langeweile. Auch Jünglinge sind
ihr noch sehr unterworfen und sehn mit Besorgnis auf unausgefüllte Stunden.
Im männlichen Alter schwindet die Langeweile mehr und mehr: Greisen wird
die Zeit stets zu kurz und die Tage fliegen pfeilschnell vorüber. Versteht
sich, daß ich von Menschen, nicht von altgewordenem Vieh rede. Durch
diese Beschleunigung des Laufes der Zeit, fällt also in spätern Jahren
meistens die Langeweile weg, und da andrerseits auch die Leidenschaften,
mit ihrer Qual, verstummen; so ist, wenn nur die Gesundheit sich erhalten
hat, im ganzen genommen, die Last des Lebens wirklich geringer, als in
der Jugend: daher nennt man den Zeitraum, welcher dem Eintritt der Schwäche
und der Beschwerden des höheren Alters vorhergeht, „die besten Jahre“.
In Hinsicht auf unser Wohlbehagen mögen sie es wirklich sein: hingegen
bleibt den Jugendjahren, als wo alles Eindruck macht und jedes lebhaft
ins Bewußtsein tritt, der Vorzug, die befruchtende Zeit für den Geist,
der blütenansetzende Frühling desselben zu sein. Tiefe Wahrheiten nämlich
lassen sich nur erschauen, nicht errechnen, d. h. ihre erste Erkenntnis
ist eine unmittelbare und wird durch den momentanen Eindruck hervorgerufen:
sie kann folglich nur eintreten, solange dieser stark, lebhaft und tief
ist. Demnach hängt, in dieser Hinsicht, alles von der Benutzung der Jugendjahre
ab. In den späteren können wir mehr auf andere, ja, auf die Welt einwirken:
weil wir selbst vollendet und abgeschlossen sind und nicht mehr dem Eindruck
angehören: aber die Welt wirkt weniger auf uns. Diese Jahre sind daher
die Zeit des Thuns und Leistens; jene aber die des ursprünglichen Auffassens
und Erkennens. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] In der Jugend herrscht die Anschauung, im Alter das Denken vor:
daher ist jene die Zeit für Poesie; dieses mehr für Philosophie. Auch
praktisch läßt man sich in der Jugend durch das Angeschaute und dessen
Eindruck, im Alter nur durch das Denken bestimmen. Zum Teil beruht dies
darauf, daß erst im Alter anschauliche Fälle in hinlänglicher Anzahl
dagewesen und den Begriffen subsumiert worden sind, um diesen volle Bedeutung,
Gehalt und Kredit zu verschaffen und zugleich den Eindruck der Anschauung,
durch die Gewohnheit, zu mäßigen. Hingegen ist in der Jugend, besonders
auf lebhafte und phantasiereiche Köpfe, der Eindruck des Anschaulichen,
mithin auch der Außenseite der Dinge, so überwiegend, daß sie die Welt
ansehn als ein Bild; daher ihnen hauptsächlich angelegen ist, wie sie
darauf figurieren und sich ausnehmen, — mehr, als wie ihnen innerlich
dabei zu Mute sei. Dies zeigt sich schon in der persönlichen Eitelkeit
und Putzsucht der Jünglinge.
Die größte Energie und höchste Spannung der Geisteskräfte findet,
ohne Zweifel, in der Jugend statt, spätestens bis ins fünfunddreißigste
Jahr: von dem an nimmt sie, wiewohl sehr langsam, ab. Jedoch sind die
späteren Jahre, selbst das Alter, nicht ohne geistige Kompensation dafür.
Erfahrung und Gelehrsamkeit sind erst jetzt eigentlich reich geworden:
man hat Zeit und Gelegenheit gehabt, die Dinge von allen Seiten zu betrachten
und zu bedenken, hat jedes mit jedem zusammengehalten und ihre Berührungspunkte
und Verbindungsglieder herausgefunden; wodurch man sie allererst jetzt
so recht im Zusammenhange versteht. Alles hat sich abgeklärt. Deshalb
weiß man selbst das, was man schon in der Jugend wußte, jetzt viel gründlicher;
da man zu jedem Begriffe viel mehr Belege hat. Was man in der Jugend zu
wissen glaubte, das weiß man im Alter wirklich, überdies weiß man auch
wirklich viel mehr und hat eine nach allen Seiten durchdachte und dadurch
ganz eigentlich zusammenhängende Erkenntnis; während in der Jugend unser
Wissen stets lückenhaft und fragmentarisch ist. Nur wer alt wird erhält
eine vollständige und angemessene Vorstellung vom Leben, indem er es
in seiner Ganzheit und seinem natürlichen Verlauf, besonders aber nicht
bloß, wie die übrigen, von der Eingangs-, sondern auch von der Ausgangsseite
übersieht, wodurch er dann besonders die Nichtigkeit desselben vollkommen
erkennt; während die übrigen stets noch in dem Wahne befangen sind,
das Rechte werde noch erst kommen. Dagegen ist in der Jugend mehr Konzeption;
daher man alsdann aus dem wenigen, was man kennt, mehr zu machen im stande
ist: aber im Alter ist mehr Urteil, Penetration und Gründlichkeit. Den
Stoff seiner selbsteigenen Erkenntnisse, seiner originalen Grundansichten,
also das, was ein bevorzugter Geist der Welt zu schenken bestimmt ist,
sammelt er schon in der Jugend ein: aber seines Stoffes Meister wird er
erst in späten Jahren. Demgemäß wird man meistenteils finden, daß
die großen Schriftsteller ihre Meisterwerke um das fünfzigste Jahr herum
geliefert haben. Dennoch bleibt die Jugend die Wurzel des Baumes der Erkenntnis;
wenngleich erst die Krone die Früchte trägt. Wie aber jedes Zeitalter,
auch das erbärmlichste, sich für viel weiser hält, als das ihm zunächst
vorhergegangene, nebst früheren; ebenso jedes Lebensalter des Menschen:
doch irren beide sich oft. In den Jahren des leiblichen Wachstums, wo
wir auch an Geisteskräften und Erkenntnissen täglich zunehmen, gewöhnt
sich das Heute mit Geringschätzung auf das Gestern herabzusehn. Diese
Gewohnheit wurzelt ein und bleibt auch dann, wenn das Sinken der Geisteskräfte
eingetreten ist und das Heute vielmehr mit Verehrung auf das Gestern blicken
sollte; daher wir dann sowohl die Leistungen, wie die Urteile, unserer
jungen Jahre oft zu gering anschlagen.
Ueberhaupt ist hier zu bemerken, daß, ob zwar, wie der Charakter, oder
das Herz des Menschen, so auch der Intellekt, der Kopf, seinen Grundeigenschaften
nach, angeboren ist, dennoch dieser keineswegs so unveränderlich bleibt,
wie jener, sondern gar manchen Umwandelungen unterworfen ist, die sogar,
im ganzen, regelmäßig eintreten; weil sie teils darauf beruhen, daß
er eine physische Grundlage, teils darauf, daß er einen empirischen Stoff
hat. So hat seine eigene Kraft ihr allmähliches Wachsthum, bis zur Akme,
und dann ihre allmähliche Dekadenz, bis zur Imbecillität. Dabei nun
aber ist andrerseits der Stoff, der alle diese Kräfte beschäftigt und
in Thätigkeit erhält, also der Inhalt des Denkens und Wissens, die Erfahrung,
die Kenntnisse, die Uebung und dadurch die Vollkommenheit der Einsicht,
eine stets wachsende Größe, bis etwan zum Eintritt entschiedener Schwäche,
die alles fallen läßt. Dies Bestehn des Menschen aus einem schlechthin
Unveränderlichen und einem regelmäßig, auf zweifache und entgegengesetzte
Weise, Veränderlichen erklärt die Verschiedenheit seiner Erscheinung
und Geltung in verschiedenen Lebensaltern.
Im weitern Sinne kann man auch sagen: die ersten vierzig Jahre unsers
Lebens liefern den Text, die folgenden dreißig den Kommentar dazu, der
uns den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes, nebst der Moral und allen
Feinheiten desselben, erst recht verstehn lehrt.
Gegen das Ende des Lebens nun gar geht es wie gegen das Ende eines Maskenballs,
wann die Larven abgenommen werden. Man sieht jetzt, wer diejenigen, mit
denen man, während seines Lebenslaufes, in Berührung gekommen war, eigentlich
gewesen sind. Denn die Charaktere haben sich an den Tag gelegt, die Thaten
haben ihre Früchte getragen, die Leistungen ihre gerechte Würdigung
erhalten und alle Trugbilder sind zerfallen. Zu diesem allen nämlich
war Zeit erfordert. — Das seltsamste aber ist, daß man sogar sich selbst,
sein eigenes Ziel und Zwecke, erst gegen das Ende des Lebens eigentlich
erkennt und versteht, zumal in seinem Verhältnis zur Welt, zu den Andern.
Zwar oft, aber nicht immer, wird man dabei sich eine niedrigere Stelle
anzuweisen haben, als man früher vermeint hatte; sondern bisweilen auch
eine höhere, welches dann daher kommt, daß man von der Niedrigkeit der
Welt keine ausreichende Vorstellung gehabt hatte und demnach sein Ziel
höher steckte, als sie. Man erfährt beiläufig was an einem ist. —
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Man pflegt die Jugend die glückliche Zeit des Lebens zu nennen,
und das Alter die traurige. Das wäre wahr, wenn die Leidenschaften glücklich
machten. Von diesen wird die Jugend hin und her gerissen, mit wenig Freude
und vieler Pein. Dem kühlen Alter lassen sie Ruhe, und alsbald erhält
es einen kontemplativen Anstrich: denn die Erkenntnis wird frei und erhält
die Oberhand. Weil nun diese, an sich selbst, schmerzlos ist, so wird
das Bewußtsein, je mehr sie darin vorherrscht, desto glücklicher. Man
braucht nur zu erwägen, daß aller Genuß negativer, der Schmerz positiver
Natur ist, um zu begreifen, daß die Leidenschaften nicht beglücken können
und daß das Alter deshalb, daß manche Genüsse ihm versagt sind, nicht
zu beklagen ist. Denn jeder Genuß ist immer nur die Stillung eines Bedürfnisses:
daß nun mit diesem auch jener wegfällt, ist so wenig beklagenswert,
wie daß einer nach Tische nicht mehr essen kann und nach ausgeschlafener
Nacht wach bleiben muß. Viel richtiger schätzt Plato (im Eingang zur
Republik) das Greisenalter glücklich, sofern es den bis dahin uns unablässig
beunruhigenden Geschlechtstrieb endlich los ist. Sogar ließe sich behaupten,
daß die mannigfaltigen und endlosen Grillen, welche der Geschlechtstrieb
erzeugt, und die aus ihnen entstehenden Affekte, einen beständigen, gelinden
Wahnsinn im Menschen unterhalten, solange er unter dem Einfluß jenes
Triebes oder jenes Teufels, von dem er stets besessen ist, steht; so daß
er erst nach Erlöschen desselben ganz vernünftig würde. Gewiß aber
ist, daß, im allgemeinen und abgesehn von allen individuellen Umständen
und Zuständen, der Jugend eine gewisse Melancholie und Traurigkeit, dem
Alter eine gewisse Heiterkeit eigen ist: und der Grund hievon ist kein
anderer, als daß die Jugend noch unter der Herrschaft, ja dem Frondienst
jenes Dämons steht, der ihr nicht leicht eine freie Stunde gönnt und
zugleich der unmittelbare oder mittelbare Urheber fast alles und jedes
Unheils ist, das den Menschen trifft oder bedroht: das Alter aber hat
die Heiterkeit dessen, der eine lange getragene Fessel los ist und sich
nun frei bewegt. — Andrerseits jedoch ließe sich sagen, daß nach erloschenem
Geschlechtstrieb der eigentliche Kern des Lebens verzehrt und nur noch
die Schale desselben vorhanden sei, ja, daß es einer Komödie gliche,
die von Menschen angefangen, nachher von Automaten, in deren Kleidern,
zu Ende gespielt werde.
Wie dem auch sei, die Jugend ist die Zeit der Unruhe; das Alter die der
Ruhe: schon hieraus ließe sich auf ihr beiderseitiges Wohlbehagen schließen.
Das Kind streckt seine Hände begehrlich aus, ins Weite, nach allem, was
es da so bunt und vielgestaltet vor sich sieht: denn es wird dadurch gereizt;
weil sein Sensorium noch so frisch und jung ist. Dasselbe tritt, mit größerer
Energie, beim Jüngling ein. Auch er wird gereizt von der bunten Welt
und ihren vielfältigen Gestalten: sofort macht seine Phantasie mehr daraus,
als die Welt je verleihen kann. Daher ist er voll Begehrlichkeit und Sehnsucht
ins Unbestimmte: diese nehmen ihm die Ruhe, ohne welche kein Glück ist.
Im Alter hingegen hat sich das alles gelegt; teils weil das Blut kühler
und die Reizbarkeit des Sensoriums minder geworden ist; teils weil Erfahrung
über den Wert der Dinge und den Gehalt der Genüsse aufgeklärt hat,
wodurch man die Illusionen, Chimären und Vorurteile, welche früher die
freie und reine Ansicht der Dinge verdeckten und entstellten, allmählich
losgeworden ist; so daß man jetzt alles richtiger und klarer erkennt
und es nimmt für das, was es ist, auch, mehr oder weniger, zur Einsicht
in die Nichtigkeit aller irdischen Dinge gekommen ist. Dies eben ist es,
was fast jedem Alten, selbst dem von sehr gewöhnlichen Fähigkeiten,
einen gewissen Anstrich von Weisheit gibt, der ihn vor den Jüngern auszeichnet.
Hauptsächlich aber ist durch dies alles Geistesruhe herbeigeführt worden:
diese aber ist ein großer Bestandteil des Glücks; eigentlich sogar die
Bedingung und das Wesentliche desselben. Während demnach der Jüngling
meint, daß wunder was in der Welt zu holen sei, wenn er nur erfahren
könnte, wo; ist der Alte vom Kohelethischen „Es ist alles eitel“
durchdrungen und weiß, daß alle Nüsse hohl sind, wie sehr sie auch
vergoldet sein mögen. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Erst im spätern Alter erlangt der Mensch ganz eigentlich das horazische
nil admirari, d. h. die unmittelbare, aufrichtige und feste Ueberzeugung
von der Eitelkeit aller Dinge und der Hohlheit aller Herrlichkeiten der
Welt: die Chimären sind verschwunden. Er wähnt nicht mehr, daß irgendwo,
sei es im Palast oder der Hütte, eine besondere Glückseligkeit wohne,
eine größere, als im wesentlichen auch er überall genießt, wenn er
von leiblichen oder geistigen Schmerzen eben frei ist. Das Große und
das Kleine, das Vornehme und das Geringe, nach dem Maßstab der Welt,
sind für ihn nicht mehr unterschieden. Dies gibt dem Alten eine besondere
Gemütsruhe, in welcher er lächelnd auf die Gaukeleien der Welt herabsieht.
Er ist vollkommen enttäuscht und weiß, daß das menschliche Leben, was
man auch thun mag es herauszuputzen und zu behängen, doch bald durch
allen solchen Jahrmarktsflitter, in seiner Dürftigkeit durchscheint,
und, wie man es auch färbe und schmücke, doch überall im wesentlichen
dasselbe ist, ein Dasein, dessen wahrer Wert jedesmal nur nach der Abwesenheit
der Schmerzen, nicht nach der Anwesenheit der Genüsse, noch weniger des
Prunkes, zu schätzen ist. (Hor. epist. L. I, 12, v. 1—4.) Der Grundcharakterzug
des höhern Alters ist das Enttäuschtsein: die Illusionen sind verschwunden,
welche bis dahin dem Leben seinen Reiz und der Thätigkeit ihren Sporn
verliehen; man hat das Nichtige und Leere aller Herrlichkeiten der Welt,
zumal des Prunkes, Glanzes und Hoheitsscheins erkannt; man hat erfahren,
daß hinter den meisten gewünschten Dingen und ersehnten Genüssen gar
wenig steckt und ist so allmählich zu der Einsicht in die große Armut
und Leere unsers ganzen Daseins gelangt. Erst im siebzigsten Jahre versteht
man ganz den ersten Vers des Koheleth. Dies ist es aber auch, was dem
Alter einen gewissen grämlichen Anstrich gibt. —
Gewöhnlich meint man, das Los des Alters sei Krankheit und Langeweile.
Erstere ist dem Alter gar nicht wesentlich, zumal nicht, wenn dasselbe
hoch gebracht werden soll: denn crescente vita, crescit sanitas et morbus.
Und was die Langeweile betrifft, so habe ich oben gezeigt, warum das Alter
ihr sogar weniger, als die Jugend, ausgesetzt ist: auch ist dieselbe durchaus
keine notwendige Begleiterin der Einsamkeit, welcher, aus leicht abzusehenden
Ursachen, das Alter uns allerdings entgegenführt; sondern sie ist es
nur für diejenigen, welche keine anderen, als sinnliche und gesellschaftliche
Genüsse gekannt, ihren Geist unbereichert und ihre Kräfte unentwickelt
gelassen haben. Zwar nehmen, im höheren Alter, auch die Geisteskräfte
ab: aber wo viel war, wird zur Bekämpfung der Langenweile immer noch
genug übrig bleiben. Sodann nimmt, wie oben gezeigt worden, durch Erfahrung,
Kenntnis, Uebung und Nachdenken, die richtige Einsicht immer noch zu,
das Urteil schärft sich und der Zusammenhang wird klar; man gewinnt,
in allen Dingen, mehr und mehr eine zusammenfassende Uebersicht des Ganzen:
so hat dann, durch immer neue Kombinationen der aufgehäuften Erkenntnisse
und gelegentliche Bereicherung derselben, die eigene innerste Selbstbildung,
in allen Stücken, noch immer ihren Fortgang, beschäftigt, befriedigt
und belohnt den Geist. Durch dieses alles wird die erwähnte Abnahme in
gewissem Grade kompensiert. Zudem läuft, wie gesagt, im Alter die Zeit
viel schneller; was der Langenweile entgegenwirkt. Die Abnahme der Körperkräfte
schadet wenig, wenn man ihrer nicht zum Erwerbe bedarf. Armut im Alter
ist ein großes Unglück. Ist diese gebannt und die Gesundheit geblieben;
so kann das Alter ein sehr erträglicher Teil des Lebens sein. Bequemlichkeit
und Sicherheit sind seine Hauptbedürfnisse: daher liebt man im Alter,
noch mehr als früher, das Geld; weil es den Ersatz für die fehlenden
Kräfte gibt. Von der Venus entlassen, wird man gern eine Aufheiterung
beim Bacchus suchen. An die Stelle des Bedürfnisses zu sehn, zu reisen
und zu lernen ist das Bedürfnis zu lehren und zu sprechen getreten. Ein
Glück aber ist es, wenn dem Greise noch die Liebe zu seinem Studium,
auch zur Musik, zum Schauspiele und überhaupt eine gewisse Empfänglichkeit
für das Aeußere geblieben ist; wie diese allerdings bei einigen bis
ins späteste Alter fortdauert. Was einer „an sich hat“, kommt ihm
nie mehr zu gute, als im Alter. Die meisten freilich, als welche stets
stumpf waren, werden im höhern Alter mehr und mehr zu Automaten: sie
denken, sagen und thun immer dasselbe, und kein äußerer Eindruck vermag
mehr etwas daran zu ändern, oder etwas Neues aus ihnen hervorzurufen.
Zu solchen Greisen zu reden, ist wie in den Sand zu schreiben: der Eindruck
verlischt fast unmittelbar darauf. Ein Greisentum dieser Art ist denn
freilich nur das caput mortuum des Lebens. — Den Eintritt der zweiten
Kindheit im hohen Alter scheint die Natur durch das, in seltenen Fällen,
alsdann sich einstellende dritte Zahnen symbolisieren zu wollen.
Das Schwinden aller Kräfte im zunehmenden Alter, und immer mehr und mehr,
ist allerdings sehr traurig; doch ist es notwendig, ja wohlthätig: weil
sonst der Tod zu schwer werden würde, dem es vorarbeitet. Daher ist der
größte Gewinn, den das Erreichen eines sehr hohen Alters bringt, die
Euthanasie, das überaus leichte, durch keine Krankheit eingeleitete,
von keiner Zuckung begleitete und gar nicht gefühlte Sterben; von welchem
man in den Ergänzungen zur „Welt als Wille und Vorstellung“ (Kap.
41, S. 470 [Bd. 6, S. 15 dieser Gesamtausg.]) eine Schilderung findet
*). [...]
*) Im A. T. wird (Psalm 90, 10) die menschliche Lebensdauer auf 70 und,
wenn es hoch kommt, 80 Jahre gesetzt, und, was mehr auf sich hat, Herodot
(I, 32 und III, 22) sagt dasselbe. Es ist aber doch falsch und ist bloß
das Resultat einer rohen und oberflächlichen Auffassung der täglichen
Erfahrung. Denn, wenn die natürliche Lebensdauer 70-80 Jahre wäre; so
müßten die Leute zwischen 70 und 80 Jahren vor Alter sterben: dies aber
ist gar nicht der Fall: sie sterben, wie die jüngeren, an Krankheiten;
die Krankheit aber ist wesentlich eine Abnormität: also ist dies nicht
das natürliche Ende. Erst zwischen 90 und 100 Jahren sterben die Menschen,
dann aber in der Regel, vor Alter, ohne Krankheit, ohne Todeskampf, ohne
Röcheln, ohne Zuckung, bisweilen ohne zu erblassen; welches die Euthanasie
heißt. Daher hat auch hier der Upanischad recht, als welcher (Vol. II,
p. 53) die natürliche Lebensdauer auf 100 Jahre setzt.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Der Grundunterschied zwischen Jugend und Alter bleibt immer, daß
jene das Leben im Prospekt hat, dieses den Tod; daß also jene eine kurze
Vergangenheit und lange Zukunft besitzt; dieses umgekehrt. Allerdings
hat man, wann man alt ist, nur noch den Tod vor sich; aber wann man jung
ist, hat man das Leben vor sich; und es frägt sich, welches von beiden
bedenklicher sei, und ob nicht, im ganzen genommen, das Leben eine Sache
sei, die es besser ist hinter sich, als vor sich zu haben: sagt doch schon
Koheleth (7, 2): „Der Tag des Todes ist besser denn der Tag der Geburt.“
Ein sehr langes Leben zu begehren, ist jedenfalls ein verwegener Wunsch.
Denn quien larga vida vive mucho mal vive sagt das spanische Sprichwort.
—
Das menschliche Leben ist eigentlich weder lang, noch kurz zu nennen;
weil es im Grunde das Maß ist, wonach wir alle anderen Zeitlängen abschätzen.
Denn, wenn man auch noch so lange lebt, hat man doch nie mehr inne, als
die unteilbare Gegenwart: die Erinnerung aber verliert täglich mehr durch
die Vergessenheit, als sie durch den Zuwachs gewinnt.
Zwar ist nicht, wie die Astrologie es wollte, der Lebenslauf der Einzelnen
in den Planeten vorgezeichnet; wohl aber der Lebenslauf des Menschen überhaupt,
sofern jedem Alter desselben ein Planet, der Reihenfolge nach, entspricht
und sein Leben demnach successive von allen Planeten beherrscht wird.
— Im zehnten Lebensjahre regiert Merkur. Wie dieser bewegt der Mensch
sich schnell und leicht, im engsten Kreise: er ist durch Kleinigkeiten
umzustimmen; aber er lernt viel und leicht, unter der Herrschaft des Gottes
der Schlauheit und Beredsamkeit. — Mit dem zwanzigsten Jahre tritt die
Herrschaft der Venus ein: Liebe und Weiber haben ihn ganz im Besitze.
Im dreißigsten Lebensjahre herrscht Mars: der Mensch ist jetzt heftig,
stark, kühn, kriegerisch und trotzig. — Im vierzigsten regieren die
vier Planetoiden: sein Leben geht demnach in die Breite: er ist frugi,
d.h. frönt dem Nützlichen, kraft der Ceres: er hat seinen eigenen Herd,
kraft der Vesta: er hat gelernt was er zu wissen braucht, kraft der Pallas:
und als Juno regiert die Herrin des Hauses, seine Gattin *). — Im fünfzigsten
Jahre aber herrscht Jupiter. Schon hat der Mensch die meisten überlebt,
und dem jetzigen Geschlechte fühlt er sich überlegen. Noch im vollen
Genuß seiner Kraft, ist er reich an Erfahrung und Kenntnis: er hat (nach
Maßgabe seiner Individualität und Lage) Autorität über alle, die ihn
umgeben. Er will demnach sich nicht mehr befehlen lassen, sondern selbst
befehlen. Zum Lenker und Herrscher, in seiner Sphäre, ist er jetzt am
geeignetsten. So kulminiert Jupiter und mit ihm der Fünfzigjährige.
Dann aber folgt, im sechzigsten Jahre, Saturn und mit ihm die Schwere,
Langsamkeit und Zähigkeit des Bleies:
But old folks, many feign as they were dead;
Unwieldy, slow, heavy and pale as lead. **)
Rom. et Jul. A. 2. sc. 5.
Zuletzt kommt Uranus: da geht man, wie es heißt, in den Himmel. Den Neptun
(so hat ihn leider die Gedankenlosigkeit getauft) kann ich hier nicht
in Rechnung ziehn; weil ich ihn nicht bei seinem wahren Namen nennen darf,
der Eros ist. Sonst wollte ich zeigen, wie sich an das Ende der Anfang
knüpft, wie nämlich der Eros mit dem Tode in einem geheimen Zusammenhange
steht, vermöge dessen der Orkus, oder Amenthes der Aegypter (nach Plutarch
De Iside et Os. C. 59), der λαμβανων και διδους,
also nicht nur der Nehmende, sondern auch der Gebende und der Tod das
große Reservoir des Lebens ist. Daher also, daher, aus dem Orkus, kommt
alles, und dort ist schon jedes gewesen, das jetzt Leben hat: — wären
wir nur fähig, den Taschenspielerstreich zu begreifen, vermöge dessen
das geschieht; dann wäre alles klar.
*) Die circa 60 seitdem noch hinzu entdeckten Planetoiden sind eine Neuerung,
von der ich nichts wissen will. Ich mache es daher mit ihnen, wie mit
mir die Philosophieprofessoren: ich ignoriere sie; weil sie nicht in meinen
Kram passen.
**) Viel Alte scheinen schon den Toten gleich:
Wie Blei, schwer, zähe, ungelenk und bleich.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Fast alle Menschen bedenken unablässig, daß sie der und der Mensch (τις
ανϑρωπος) sind, nebst den Korollarien, die sich daraus ergeben:
hingegen, daß sie überhaupt ein Mensch (ό ανϑρωπος) sind und
welche Korollarien hieraus folgen, das fällt ihnen kaum ein und ist doch
die Hauptsache. Die wenigen, welche mehr dem letztern, als dem erstern
Satze nachhängen, sind Philosophen. Die Richtung der andern aber ist
darauf zurückzuführen, daß sie überhaupt in den Dingen stets nur das
Einzelne und Individuelle sehn, nicht das Allgemeine derselben. Bloß
die höher Begabten sehn, mehr und mehr, je nach dem Grad ihrer Eminenz,
in den einzelnen Dingen das Allgemeine derselben. Dieser wichtige Unterschied
durchdringt das ganze Erkenntnisvermögen dermaßen, daß er sich auf
die Anschauung der alltäglichsten Gegenstände herab erstreckt; daher
schon diese im eminenten Kopfe eine andere ist, als im gewöhnlichen.
Dieses Auffassen des Allgemeinen in dem sich jedesmal darstellenden Einzelnen
fällt auch zusammen mit dem, was ich das reine, willenslose Subjekt des
Erkennens genannt und als das subjektive Korrelat der platonischen Idee
aufgestellt habe; weil nur, wenn auf das Allgemeine gerichtet, die Erkenntnis
willenslos bleiben kann, in den einzelnen Dingen hingegen die Objekte
des Wollens liegen; daher denn auch die Erkenntnis der Tiere streng auf
dies Einzelne beschränkt ist und demgemäß ihr Intellekt ausschließlich
im Dienste ihres Willens bleibt. Hingegen ist jene Richtung des Geistes
auf das Allgemeine die unumgängliche Bedingung zu echten Leistungen in
der Philosophie, Poesie, überhaupt in den Künsten und Wissenschaften.
Für den Intellekt im Dienste des Willens, also im praktischen Gebrauch
gibt es nur einzelne Dinge; für den Intellekt, der Kunst und Wissenschaft
treibt, also für sich selbst thätig ist, gibt es nur Allgemeinheiten,
ganze Arten, Spezies, Klassen, Ideen von Dingen; da selbst der bildende
Künstler im Individuo die Idee, also die Gattung darstellen will. Dieses
beruht darauf, daß der Wille direkt bloß auf einzelne Dinge gerichtet
ist: diese sind seine eigentlichen Objekte: denn sie haben nur empirische
Realität. Begriffe, Klassen, Arten hingegen können nur sehr mittelbar
seine Objekte werden. Daher hat der rohe Mensch für allgemeine Wahrheiten
keinen Sinn; das Genie hingegen übersieht und versäumt das Individuelle:
die erzwungene Beschäftigung mit dem Einzelnen als solchem, wie sie den
Stoff des praktischen Lebens ausmacht, ist ihm ein lästiger Frondienst.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der Dichter bringt Bilder des Lebens, menschliche Charaktere und Situationen
vor die Phantasie, setzt das alles in Bewegung, und überläßt nun jedem,
bei diesen Bildern so weit zu denken, wie seine Geisteskraft reicht. Dieserhalb
kann er Menschen von den verschiedensten Fähigkeiten, ja, Thoren und
Weisen zugleich genügen. Der Philosoph hingegen bringt nicht, in jener
Weise, das Leben selbst, sondern die fertigen, von ihm daraus abstrahierten
Gedanken, und fordert nun, daß sein Leser ebenso und ebenso weit denke,
wie er selbst. Dadurch wird sein Publikum sehr klein. Der Dichter ist
demnach dem zu vergleichen, der die Blumen, der Philosoph dem, der die
Quintessenz derselben bringt. Ein andrer großer Vorteil, den poetische
Leistungen vor philosophischen haben, ist dieser, daß alle Dichterwerke,
ohne sich zu hindern, nebeneinander bestehn, ja, sogar die heterogensten
unter ihnen von einem und demselben Geiste genossen und geschätzt werden
können; während jedes philosophische System, kaum zur Welt gekommen,
schon auf den Untergang aller seiner Brüder bedacht ist, gleich einem
asiatischen Sultan bei seinem Regierungsantritt. Denn, wie im Bienenstocke
nur eine Königin sein kann, so nur eine Philosophie an der Tagesordnung.
Die Systeme sind nämlich so ungeselliger Natur, wie die Spinnen, deren
jede allein in ihrem Netze sitzt und nun zusieht, wie viele Fliegen sich
darin werden fangen lassen, aber einer andern Spinne nur um mit ihr zu
kämpfen, sich nähert. Also während die Dichterwerke friedlich nebeneinander
weiden, wie Lämmer, sind die philosophischen geborene reißende Tiere,
und sogar in ihrer Zerstörungssucht, gleich den Skorpionen, Spinnen und
einigen Insektenlarven, vorzüglich gegen die eigene Spezies gerichtet.
Sie treten in der Welt auf, gleich den geharnischten Männern aus der
Saat der Drachenzähne des Jason, und haben bis jetzt, gleich diesen,
sich alle wechselseitig aufgerieben. Schon dauert dieser Kampf über zweitausend
Jahre: wird je aus ihm ein letzter Sieg und bleibender Frieden hervorgehn?
Infolge dieser wesentlich polemischen Natur, dieses bellum omnium contra
omnes der philosophischen Systeme ist es unendlich schwerer als Philosoph
Geltung zu erlangen, denn als Dichter. Verlangt doch des Dichters Werk
vom Leser nichts weiter, als einzutreten in die Reihe der ihn unterhaltenden,
oder erhebenden Schriften, und eine Hingebung auf wenige Stunden. Das
Werk des Philosophen hingegen will seine ganze Denkungsart umwälzen,
verlangt von ihm, daß er alles, was er bisher, in dieser Gattung, gelernt
und geglaubt hat, für Irrtum, die Zeit und die Mühe für verloren erkläre
und von vorn anfange: höchstens läßt es einige Rudera eines Vorgängers
stehn, um seine Grundlage daraus zu machen. Dazu kommt, daß es in jedem
Lehrer eines schon bestehenden Systems einen Gegner von Amts wegen hat,
ja, daß bisweilen sogar der Staat ein ihm beliebiges philosophisches
System in Schutz nimmt und, mittelst seiner mächtigen materiellen Mittel,
das Aufkommen jedes andern verhütet. Jetzt nehme man noch hinzu, daß
die Größe des philosophischen Publikums zu der des dichterischen sich
verhält wie die Zahl der Leute, die belehrt, zu der, die unterhalten
sein wollen, und man wird ermessen können, quibus auspiciis ein Philosoph
auftritt. — Dagegen nun freilich ist es der Beifall der Denker, der
Auserwählten aus langen Zeiträumen und allen Ländern, ohne Nationalunterschied,
der dem Philosophen lohnt: die Menge lernt allmählich seinen Namen auf
Auktorität verehren. Demgemäß und wegen der langsamen, aber tiefen
Einwirkung des Ganges der Philosophie auf den des ganzen Menschengeschlechts
geht, seit Jahrtausenden, die Geschichte der Philosophen neben der der
Könige her und zählt hundertmal weniger Namen, als diese: daher es ein
Großes ist, dem seinigen eine bleibende Stelle darin zu verschaffen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Weder unsere Kenntnisse, noch unsere Einsichten werden jemals durch Vergleichen
und Diskutieren des von Andern Gesagten sonderlich vermehrt werden: denn
das ist immer nur, wie wenn man Wasser aus einem Gefäß in ein anderes
gießt. Nur durch eigene Betrachtung der Dinge selbst kann Einsicht und
Kenntnis wirklich bereichert werden: denn sie allein ist die stets bereite
und stets nahe liegende lebendige Quelle. Demnach ist es seltsam anzusehn,
wie seinwollende Philosophen stets auf dem ersteren Wege beschäftigt
sind und den andern gar nicht zu kennen scheinen, wie sie immer es vorhaben
mit dem, was dieser gesagt hat, und was wohl jener gemeint haben mag;
so daß sie gleichsam, stets von neuem, alte Gefäße umstülpen, um zu
sehn, ob nicht irgend ein Tröpfchen darin zurückgeblieben sei; während
die lebendige Quelle vernachlässigt zu ihren Füßen fließt. Nichts
verrät so sehr, wie dieses, ihre Unfähigkeit und zeiht ihre angenommene
Miene von Wichtigkeit, Tiefsinn und Originalität der Lüge.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Jedes angeblich voraussetzungslose Verfahren in der Philosophie ist Windbeutelei:
denn immer muß man irgend etwas als gegeben ansehen, um davon auszugehn.
Dies nämlich besagt das δος μοι που στω, welches die unumgängliche
Bedingung jedes menschlichen Thuns, selbst des Philosophierens, ist; weil
wir geistig so wenig, wie körperlich, im freien Aether schweben können.
Ein solcher Ausgangspunkt des Philosophierens, ein solches einstweilen
als gegeben Genommenes, muß aber nachmals wieder kompensiert und gerechtfertigt
werden. Dasselbe wird nämlich entweder ein Subjektives sein, also etwan
das Selbstbewußtsein, die Vorstellung, das Subjekt, der Wille; oder aber
ein Objektives, also das im Bewußtsein von andern Dingen sich Darstellende,
etwan die reale Welt, die Außendinge, die Natur, die Materie, Atome,
auch ein Gott, auch ein bloßer beliebig erdachter Begriff, wie die Substanz,
das Absolutum, oder was immer es nun sein soll. Um nun also die hierin
begangene Willkürlichkeit wieder auszugleichen und die Voraussetzung
zu Rektifizieren, muß man nachher den Standpunkt wechseln, und auf den
entgegengesetzten treten, von welchem aus man nun das anfangs als gegeben
Genommene, in einem ergänzenden Philosophem wieder ableitet: sic res
accendunt lumina rebus.
Geht man z. B. vom Subjektiven aus, wie Berkeley, Locke und Kant, in welchem
diese Betrachtungsweise ihren Gipfel erreichte, gethan haben; so wird
man, obwohl, wegen der wirklichen Unmittelbarkeit des Subjektiven, dieser
Weg die größten Vorzüge hat, dennoch eine teils sehr einseitige, teils
nicht ganz gerechtfertigte Philosophie erhalten, wenn man sie nicht dadurch
ergänzt, daß man das in ihr Abgeleitete ein andermal wieder als das
Gegebene zum Ausgangspunkte nimmt und also, vom entgegengesetzten Standpunkte
aus, das Subjektive aus dem Objektiven ableitet, wie vorhin das Objektive
aus dem Subjektiven. Diese Ergänzung der Kantischen Philosophie glaube
ich, der Hauptsache nach, geliefert zu haben im 22. Kapitel der Ergänzungen
zur „Welt als Wille und Vorstellung“ (Bd. 5, S. 97 ff. dieser Gesamtausgabe)
und im „Willen in der Natur“ unter der Rubrik Pflanzenphysiologie,
als wo ich, von der äußern Natur ausgehend, den Intellekt ableite.
Geht man nun aber umgekehrt vom Objektiven aus und nimmt gleich recht
viel als gegeben, etwan die Materie, nebst den in ihr sich manifestierenden
Kräften; so hat man bald die ganze Natur; indem eine solche Betrachtungsart
den reinen Naturalismus liefert, den ich genauer die absolute Physik benannt
habe. Da besteht denn also das Gegebene, mithin absolut Reale, allgemein
gefaßt, in Naturgesetzen und Naturkräften, nebst deren Träger, der
Materie; speziell betrachtet aber in einer Unzahl frei im unendlichen
Raume schwebender Sonnen und sie umkreisender Planeten. Es gibt demnach,
im Resultat, überall nichts, als Kugeln, teils leuchtende, teils beleuchtete.
Auf letzteren hat, infolge eines Fäulungsprozesses, sich auf der Oberfläche
das Leben entwickelt, welches, in stufenweiser Steigerung organische Wesen
liefert, die sich darstellen als Individuen, welche zeitlich anfangen
und enden, durch Zeugung und Tod, gemäß den die Lebenskraft lenkenden
Naturgesetzen, welche, wie alle andern, die herrschende und von Ewigkeit
zu Ewigkeit bestehende Ordnung der Dinge ausmachen, ohne Anfang und Ende,
und ohne von sich Rechenschaft zu geben. Den Gipfel jener Steigerung nimmt
der Mensch ein, dessen Dasein ebenfalls einen Anfang, in seinem Verlauf
viele und große Leiden, wenige und karg gemessene Freuden, und sodann,
wie jedes andere, ein Ende hat; nach welchem es ist, als wäre es nie
gewesen. Unsere, hier die Betrachtung leitende und die Rolle der Philosophie
spielende absolute Physik erklärt uns nun, wie, jenen absolut bestehenden
und geltenden Naturgesetzen zufolge, eine Erscheinung allezeit die andere
herbeiführt, oder auch verdrängt: alles geht dabei ganz natürlich zu
und ist daher völlig klar und verständlich; so daß man auf das Ganze
der so explizierten Welt eine Phrase anwenden könnte, welche Fichte,
wann er seine dramatischen Talente auf dem Katheder produzierte, mit tiefem
Ernst, imponierendem Nachdruck und überaus studentenverblüffender Miene,
so auszusprechen pflegte: „Es ist, weil es ist; und ist wie es ist,
weil es so ist.“ Demgemäß erscheint es, auf diesem Standpunkt, als
eine bloße Grille, wenn man zu einer so klar gemachten Welt noch andere
Erklärungen suchen wollte, in einer ganz imaginären Metaphysik, auf
die man wieder eine Moral setzte, welche, weil durch die Physik nicht
zu begründen, ihren einzigen Anhalt an jenen Fiktionen der Metaphysik
hätte. Hierauf beruht die merkliche Verachtung, mit welcher die Physiker
auf die Metaphysik herabsehn. — Allein, trotz aller Selbstgenügsamkeit
jenes rein objektiven Philosophierens, wird sich die Einseitigkeit des
Standpunkts und die Notwendigkeit ihn zu wechseln, also einmal das erkennende
Subjekt, nebst dessen Erkenntnisvermögen, in welchem allein alle jene
Welten denn doch zunächst vorhanden sind, zum Gegenstand der Untersuchung
zu machen, früher oder später kundgeben, unter mancherlei Formen und
bei mancherlei Anlässen. So liegt z. B. schon dem Ausdrucke der christlichen
Mystiker, die den menschlichen Intellekt das Licht der Natur benennen,
welches sie in höherer Instanz für imkompetent erklären, die Einsicht
zum Grunde, daß die Gültigkeit aller solcher Erkenntnisse nur eine relative
und bedingte sei, nicht aber eine unbedingte, wofür sie hingegen unsere
heutigen Rationalisten halten, welche eben deshalb die tiefen Mysterien
des Christentums, wie die Physiker die Metaphysik, verachten, z. B. das
Dogma von der Erbsünde für einen Aberglauben halten, weil ihr Pelagianischer
Hausmannsverstand glücklich herausgebracht hat, daß einer nicht für
das kann, was ein andrer, sechstausend Jahre vor ihm, gesündigt hat.
Denn der Rationalist geht getrost seinem Lichte der Natur nach und vermeint
daher wirklich und in vollem Ernst, daß er vor 40 oder 50 Jahren, ehe
nämlich sein Papa in der Schlafmütze ihn gezeugt und seine Mama Gans
ihn glücklich in diese Welt abgesetzt hatte, rein und absolut nichts
gewesen und dann geradezu aus nichts entstanden sei. Denn nur so kann
er für nichts. Der Sünder und Erbsünder!
Also, wie gesagt, auf mancherlei Wegen, zumeist aber auf dem nicht zu
vermeidenden philosophischen, wird die der objektiven Erkenntnis folgende
Spekulation, früher oder später, anfangen, Unrat zu merken, nämlich
einzusehn, daß alle ihre nach der objektiven Seite hin erlangte Weisheit
auf Kredit des menschlichen Intellekts, der doch seine eigenen Formen,
Funktionen und Darstellungsweise haben muß, angenommen, folglich durchweg
durch diesen bedingt sei; woraus die Notwendigkeit folgt, auch hier einmal
den Standpunkt zu wechseln und das objektive Verfahren mit dem subjektiven
zu vertauschen, also den Intellekt, der bis hierher, im vollsten Selbstvertrauen,
seinen Dogmatismus getrost aufgebaut und ganz dreist über die Welt und
alle Dinge in ihr, sogar über ihre Möglichkeit, a priori abgeurteilt
hat, jetzt selbst zum Gegenstand der Untersuchung zu machen und seine
Vollmachten der Prüfung zu unterziehn. Dies führt zunächst zum Locke;
dann führt es zur Kritik der reinen Vernunft und endlich zu der Erkenntnis,
daß das Licht der Natur ein allein nach außen gerichtetes ist, welches,
wenn es sich zurückbeugen und sein eigenes Inneres beleuchten möchte,
dies nicht vermag, also die Finsternis, die daselbst herrscht, unmittelbar
nicht zerstreuen kann; sondern bloß auf dem Umwege der Reflexion, den
jene Philosophen gegangen, und mit großer Schwierigkeit, eine mittelbare
Kunde von seinem eigenen Mechanismus und seiner eigenen Natur erhält.
Danach aber wird dem Intellekt klar, daß er, zur Auffassung bloßer Relationen,
als welche dem Dienst eines individuellen Willens genügt, von Haus aus
bestimmt, eben darum wesentlich nach außen gerichtet und selbst da eine
bloße Flächenkraft ist, gleich der Elektrizität, d. h. bloß die Oberfläche
der Dinge erfaßt, nicht aber in ihr Inneres eindringt und eben deshalb
wieder von allen jenen, ihm objektiv klaren und realen Wesen doch kein
einziges, auch nicht das geringste und einfachste, gänzlich und von Grund
aus zu verstehen, oder zu durchschauen vermag, vielmehr ihm, in allem
und jedem, die Hauptsache ein Geheimnis bleibt. Hiedurch aber wird er
dann zu der tiefern Einsicht geführt, welche der Name Idealismus bezeichnet,
daß nämlich jene objektive Welt und ihre Ordnung, wie er sie mit seinen
Operationen auffaßt, nicht unbedingt und an sich selbst also vorhanden
sei, sondern mittelst der Funktionen des Gehirns entstehe und daher zunächst
bloß in diesem existiere und folglich in dieser Form nur ein bedingtes
und relatives Dasein habe, also ein bloßes Phänomen, bloße Erscheinung
sei. Wenn bis dahin der Mensch nach den Gründen seines eigenen Daseins
geforscht hatte, wobei er voraussetzte, die Gesetze des Erkennens, Denkens
und der Erfahrung seien rein objektiv, an und für sich und absolut vorhanden
und bloß vermöge ihrer sei er und alles übrige; so erkennt er jetzt,
daß, umgekehrt, sein Intellekt, folglich auch sein Dasein, die Bedingung
aller jener Gesetze und was aus ihnen folgt ist. Dann endlich sieht er
auch ein, daß die ihm jetzt klar gewordene Idealität des Raumes, der
Zeit und der Kausalität Platz läßt für eine ganz andere Ordnung der
Dinge, als die der Natur ist, welche letztere er jedoch als das Resultat,
oder die Hieroglyphe, jener andern anzusehn genötigt ist.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Wie wenig geeignet zum philosophischen Nachdenken der menschliche Verstand
in der Regel sei, zeigt unter anderm sich darin, daß auch jetzt, nach
allem was seit Cartesius darüber gesagt worden, immer noch dem Idealismus
der Realismus getrost entgegentritt, mit der naiven Behauptung, die Körper
wären als solche nicht bloß in unserer Vorstellung, sondern auch wirklich
und wahrhaft vorhanden. Aber gerade diese Wirklichkeit selbst, diese Art
und Weise der Existenz, samt allem, was sie enthält, ist es ja, von der
wir behaupten, daß sie nur in der Vorstellung vorhanden und außerdem
nirgends anzutreffen sei; weil sie nur eine gewisse notwendige Ordnung
der Verknüpfung unsrer Vorstellungen ist. Bei allem, was frühere Idealisten,
zumal Berkeley, gelehrt haben, erhält man die recht gründliche Ueberzeugung
davon doch erst durch Kant; weil er die Sache nicht mit einem Schlage
abthut, sondern ins Einzelne geht, das Apriorische ausscheidet und dem
empirischen Element überall Rechnung trägt. Wer nun aber die Idealität
der Welt einmal begriffen hat, dem erscheint die Behauptung, daß solche,
auch wenn niemand sie vorstellte, doch vorhanden sein würde, wirklich
unsinnig; weil sie einen Widerspruch aussagt: denn ihr Vorhandensein bedeutet
eben nur ihr Vorgestelltwerden. Ihr Dasein selbst liegt in der Vorstellung
des Subjekts. Dies eben besagt der Ausdruck: sie ist Objekt *). Demgemäß
legen auch die edleren, älteren und besseren Religionen, also Brahmanismus
und Buddhaismus, ihren Lehren durchaus den Idealismus zum Grunde, dessen
Anerkennung sie mithin sogar dem Volke zumuten. Das Judentum hingegen
ist eine rechte Konzentration und Konsolidation des Realismus. —
Eine von Fichte eingeführte und seitdem habilitierte Erschleichung liegt
im Ausdruck das Ich. Hier wird nämlich, durch die substantive Redeform
und den vorgesetzten Artikel, das wesentlich und schlechthin Subjektive
zum Objekt umgewandelt. Denn in Wahrheit bezeichnet Ich das Subjektive
als solches, welches daher gar nie Objekt werden kann, nämlich das Erkennende
im Gegensatz und als Bedingung alles Erkannten. Dies hat die Weisheit
aller Sprachen dadurch ausgedrückt, daß sie Ich nicht als Substantiv
behandelt: daher eben Fichte der Sprache Gewalt anthun mußte, um seine
Absicht durchzusetzen. Eine noch dreistere Erschleichung eben dieses Fichte
ist der unverschämte Mißbrauch, den er mit dem Worte Setzen getrieben
hat, der aber, statt gerügt und explodiert worden zu sein, noch bis auf
den heutigen Tag, bei fast allen Philosophastern, nach seinem Vorgang
und auf seine Auktorität, als ein stehendes Hilfsmittel zu Sophismen
und Truglehren, in häufigem Gebrauch ist. Setzen, ponere, wovon propositio,
ist, von alters her, ein rein logischer Ausdruck, welcher besagt, daß
man, im logischen Zusammenhang einer Disputation, oder sonstigen Erörterung,
etwas vorderhand annehme, voraussetze, bejahe, ihm also logische Gültigkeit
und formale Wahrheit einstweilen erteile, — wobei seine Realität, materielle
Wahrheit und Wirklichkeit durchaus unberührt und unausgemacht bleibt
und dahinsteht. Fichte aber erschlich sich allmählich für dies Setzen
eine reale, aber natürlich dunkele und neblichte Bedeutung, welche die
Pinsel gelten ließen und die Sophisten fortwährend benutzen: seitdem
nämlich das Ich erst sich selbst und nachher das Nicht-Ich gesetzt hat,
heißt Setzen so viel wie Schaffen, Hervorbringen, kurz, in die Welt setzen,
man weiß nicht wie, und alles, was man ohne Gründe als daseiend annehmen
und anderen aufbinden möchte, wird eben gesetzt, und nun steht's und
ist da, ganz real. Das ist die noch geltende Methode der sogenannten Nachkantischen
Philosophie und ist Fichtes Werk.
*) Schaue ich irgend einen Gegenstand, etwan eine Aussicht, an, und denke
mir, daß in diesem Augenblick mir der Kopf abgeschlagen würde; so weiß
ich, daß der Gegenstand unverrückt und unerschüttert stehen bleiben
würde: — dies impliziert aber im tiefsten Grunde, daß auch ich ebenso
noch dasein würde. Dies wird wenigen einleuchten, aber für diese wenigen
sei es gesagt.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Die einfachste, unbefangene Selbstbeobachtung, zusammengehalten mit dem
anatomischen Ergebnis, führt zu dem Resultat, daß der Intellekt, wie
seine Objektivation, das Gehirn, nebst diesem anhängenden Sinnenapparat,
nichts anderes sei, als eine sehr gesteigerte Empfänglichkeit für Einwirkungen
von außen; nicht aber unser ursprüngliches und eigentlich inneres Wesen
ausmache; also, daß in uns der Intellekt nicht dasjenige sei, was in
der Pflanze die treibende Kraft, oder im Steine die Schwere, nebst chemischen
Kräften, ist: als dieses ergibt sich allein der Wille. Sondern der Intellekt
ist in uns das, was in der Pflanze die bloße Empfänglichkeit für äußere
Einflüsse, für physikalische und chemische Einwirkungen und was noch
sonst ihr Wachstum und Gedeihen fördern oder hindern mag; nur daß in
uns diese Empfänglichkeit so überaus hoch gesteigert ist, daß, vermöge
ihrer, die ganze objektive Welt, die Welt als Vorstellung, sich darstellt,
folglich solchermaßen ihren Ursprung, als Objekt, nimmt. Um sich dies
zu veranschaulichen, stelle man sich die Welt vor, ohne alle animalische
Wesen. Da ist sie ohne Wahrnehmung, also eigentlich gar nicht objektiv
vorhanden; indessen sei es so angenommen. Jetzt denke man sich eine Anzahl
Pflanzen dicht nebeneinander aus dem Boden emporgeschossen. Auf diese
wirkt nun mancherlei ein, wie Luft, Wind, Stoß einer Pflanze gegen die
andere, Nässe, Kälte, Licht, Wärme, elektrische Spannung u. s. w. Jetzt
steigere man, in Gedanken, mehr und mehr, die Empfänglichkeit dieser
Pflanzen für dergleichen Einwirkungen: da wird sie endlich zur Empfindung,
begleitet von der Fähigkeit diese auf ihre Ursachen zu beziehen, und
so am Ende zur Wahrnehmung: alsbald aber steht die Welt da, in Raum, Zeit
und Kausalität sich darstellend; bleibt aber dennoch ein bloßes Resultat
der äußern Einflüsse auf die Empfänglichkeit der Pflanzen. Diese bildliche
Betrachtung ist sehr geeignet, die bloß phänomenale Existenz der Außenwelt
faßlich zu machen. Denn, wem wird es danach wohl einfallen, zu behaupten,
daß die Verhältnisse, welche in einer solchen, aus bloßen Relationen
zwischen äußerer Einwirkung und lebendiger Empfänglichkeit entstehenden
Anschauung ihr Dasein haben, die wahrhaft objektive, innere und ursprüngliche
Beschaffenheit aller jener angenommenermaßen auf die Pflanze einwirkenden
Naturpotenzen, also die Welt der Dinge an sich darstellen. Wir können
also an diesem Bilde uns faßlich machen, warum der Bereich des menschlichen
Intellekts so enge Schranken hat, wie ihm Kant in der Kritik der reinen
Vernunft nachweist.
Das Ding an sich hingegen ist allein der Wille. Demnach ist er der Schöpfer
und Träger aller Eigenschaften der Erscheinung. Das Moralische wird ihm
unbedenklich zur Last gelegt: aber auch die Erkenntnis und ihre Kraft,
also der Intellekt, gehört seiner Erscheinung, also mittelbar ihm an.
— Daß beschränkte und dumme Menschen stets einige Verachtung erfahren,
mag, wenigstens zum Teil, darauf beruhen, daß in ihnen der Wille sich
die Last so leicht gemacht und, zum Behuf seiner Zwecke, nur zwei Quentchen
Erkenntniskraft geladen hat.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Wie das Gehirn als ein Parasit, der vom Organismus genährt wird, ohne
direkt zu dessen innerer Oekonomie beizutragen, da oben, in seiner festen,
wohlverwahrten Behausung ein selbständiges, unabhängiges Leben führt;
so führt der geistig hochbegabte Mensch außer dem Allen gemeinsamen,
individuellen Leben, noch ein zweites, rein intellektuelles, welches in
der steten Zunahme, Berichtigung und Vermehrung nicht des bloßen Wissens,
sondern der zusammenhängenden eigentlichen Erkenntnis und Einsicht besteht
und unberührt bleibt vom Schicksale der Person, sofern es nicht etwan
von diesem in seinem Treiben gestört wird; daher auch es den Menschen
über dasselbe und seinen Wechsel erhebt und hinaussetzt. Es besteht in
einem steten Denken, Lernen, Versuchen und Ueben, und wird allmählich
zur Hauptexistenz, der die persönliche sich als bloßes Mittel zum Zweck
unterordnet. Ein Beispiel der Unabhängigkeit und Absonderung dieses intellektuellen
Lebens gibt uns Goethe, wann er, mitten im Feldgetümmel des Champagnekrieges,
Phänomene zur Farbenlehre beobachtet und, sobald ihm, unter dem grenzenlosen
Elend jenes Feldzuges, eine kurze Rast, in der Festung Luxemburg, gegönnt
ist, sogleich die Hefte seiner Farbenlehre vornimmt. So hat er uns denn
ein Vorbild hinterlassen, dem wir sollen nachfolgen, die wir das Salz
der Erde sind, indem wir allezeit unserm intellektuellen Leben ungestört
obliegen, wie immer auch das persönliche vom Sturm der Welt ergriffen
und erschüttert werden möge, stets eingedenk, daß wir nicht der Magd
Söhne sind, sondern der Freien. Als unser Emblem und Familienwappen schlage
ich vor, einen vom Sturm heftig bewegten Baum, der dabei dennoch seine
roten Früchte auf allen Zweigen zeigt, mit der Umschrift: dum convellor
mitescunt; oder auch: conquassata, sed ferax.
Jenem rein intellektuellen Leben des Einzelnen entspricht ein eben solches
des Ganzen der Menschheit, deren reales Leben ja ebenfalls im Willen liegt,
sowohl seiner empirischen, als seiner transcendenten Bedeutung nach. Dieses
rein intellektuelle Leben der Menschheit besteht in ihrer fortschreitenden
Erkenntnis mittelst der Wissenschaften, und in der Vervollkommnung der
Künste, welche beide, Menschenalter und Jahrhunderte hindurch, sich langsam
fortsetzen, und zu denen ihren Beitrag liefernd, die einzelnen Geschlechter
vorübereilen. Dieses intellektuelle Leben schwebt, wie eine ätherische
Zugabe, ein sich aus der Gärung entwickelnder wohlriechender Duft über
dem weltlichen Treiben, dem eigentlich realen, vom Willen geführten Leben
der Völker, und neben der Weltgeschichte geht schuldlos und nicht blutbefleckt
die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaft und der Künste *).
*) Was eine Nation an Werken der schönen Künste, Poesie und Philosophie
aufzuweisen hat, ist der Ertrag des in ihr vorhanden gewesenen Ueberschusses
an Intellekt.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Wer von seinem Zeitalter Dank erleben will, muß mit demselben gleichen
Schritt halten. Dabei aber kommt nie etwas Großes zu stande. Wer dieses
beabsichtigt, muß daher seine Blicke auf die Nachwelt richten und, mit
fester Zuversicht, für diese sein Werk ausarbeiten; wobei es freilich
kommen kann, daß er seinen Zeitgenossen unbekannt bleibt und dann dem
zu vergleichen ist, der, genötigt sein Leben auf einer wüsten Insel
zuzubringen, daselbst mühsam ein Denkmal errichtet, künftigen Seefahrern
die Kunde von seinem Dasein zu überliefern. Scheint ihm dies hart; so
tröste er sich damit, daß sogar den gewöhnlichen, bloß praktischen
Menschen, der keine Kompensation dafür zu hoffen hat, oft das gleiche
Schicksal trifft. Ein solcher nämlich wird, wenn durch seine Lage begünstigt,
auf materiellem Wege produktiv thätig sein, wird erwerben, ankaufen,
bauen, urbar machen, anlegen, gründen, einrichten und verschönern, mit
täglichem Fleiße und unermüdlichem Eifer. Er wähnt dabei, für sich
zu arbeiten: jedoch kommt am Ende alles nur den Nachkommen zu gute, und
sehr oft nicht einmal seinen eigenen. Demnach kann auch er sagen nos,
non nobis, und hat zum Lohn seine Arbeit gehabt. Es geht ihm also nicht
besser, als dem Mann von Genie, der wohl auch für sich Lohn, wenigstens
Ehre, hoffte, am Ende aber alles bloß für die Nachwelt gethan hat. Freilich
haben dafür beide auch viel von den Vorfahren ererbt.
Die erwähnte Kompensation nun aber, welche das Genie voraus hat, liegt
in dem, was es nicht andern, sondern sich selber ist. Wer hat wohl mehr
eigentlich gelebt, als der, welcher Augenblicke hatte, deren bloßer Nachklang
durch die Jahrhunderte und ihren Lärm vernehmbar bleibt? — Ja, vielleicht
wäre es für einen solchen das klügste, wenn er, um ungestört und ungehudelt
er selbst zu sein, sich, solange er lebte, am Genusse seiner eigenen Gedanken
und Werke genügen ließe und die Welt nur zum Erben seines reichen Daseins
einsetzte, dessen bloßer Abdruck, gleichsam Ichnolith, ihr erst nach
seinem Tode zu teil würde. (Vergl. Byron, Prophecy of Dante, Eingang
zu C. IV).
Zudem aber ist was ein Mann von Genie vor den andern voraus hat nicht
auf die Thätigkeit seiner höchsten Kräfte beschränkt. Sondern, wie
ein außerordentlich wohlgebauter, gelenker und behender Mensch alle seine
Bewegungen mit ausnehmender Leichtigkeit, ja, mit Wohlbehagen vollzieht,
indem er an der Thätigkeit, zu der er so besonders glücklich ausgestattet
ist, unmittelbare Freude hat, dieselbe daher auch oft zwecklos ausübt;
wie er ferner, nicht bloß als Seil- oder Solotänzer, die Sprünge macht,
die keinem andern ausführbar sind, sondern auch in den leichtern Tanzschritten,
welche andere ebenfalls machen, ja selbst im bloßen Gange, durchweg seine
seltene Federkraft und Behendigkeit verrät; — so wird ein wahrhaft
überlegener Geist nicht bloß Gedanken und Werke hervorbringen, die von
keinem andern je ausgehn könnten, und wird nicht in diesen allein seine
Größe zeigen; sondern, indem das Erkennen und Denken selbst ihm eine
natürliche und leichte Thätigkeit ist, wird er sich in derselben allezeit
gefallen, wird daher selbst das Geringere, auch andern Erreichbare, doch
leichter, schneller, richtiger, als sie, auffassen, wird daher an jeder
erlangten Kenntnis, jedem gelösten Problem, jedem sinnreichen Gedanken,
sei er nun eigen oder fremd, unmittelbare, lebhafte Freude haben; weshalb
denn auch sein Geist, ohne weitern Zweck, fortwährend thätig ist und
ihm dadurch zu einer stets fließenden Quelle des Genusses wird; so daß
die Langeweile, dieser beständige Hausteufel der Gewöhnlichen, sich
ihm nicht nähern kann. Dazu kommt, daß die Meisterwerke der ihm vorhergegangenen,
oder gleichzeitigen großen Geister eigentlich nur für ihn ganz da sind.
Der gewöhnliche, d. h. schlechte, Kopf freut sich auf ein ihm anempfohlenes
großes Geistesprodukt etwan so, wie der Podagrist auf einen Ball; wenngleich
dieser aus Konvenienz hingeht und jener, um nicht zurückzubleiben, es
liest: denn Labruyère hat ganz recht, wenn er sagt: Tout l'esprit qui
est au monde est inutile à celui qui n'en a point. — Zudem verhalten
alle Gedanken der Geistreichen, oder gar Genialen, zu denen der Gewöhnlichen,
selbst da, wo sie im wesentlichen dieselben sind, sich wie mit lebhaften,
brennenden Farben ausgemalte Bilder zu bloßen Umrissen, oder mit schwachen
Wasserfarben illuminierten. — Dies alles also gehört zum Lohn des Genies,
zu seiner Entschädigung für ein einsames Dasein in einer ihm heterogenen
und nicht angemessenen Welt. Weil nämlich alle Größe relativ ist; so
ist es einerlei, ob ich sage, Cajus sei ein großer Mann gewesen; oder,
Cajus habe unter lauter erbärmlich kleinen Leuten leben müssen: denn
Brobdingnag und Liliput sind nur durch den Ausgangspunkt verschieden.
So groß daher, so bewunderungswürdig, so unterhaltend der Verfasser
unsterblicher Werke seiner langen Nachwelt erscheint; so klein, so erbärmlich,
so ungenießbar müssen ihm, während er lebte, die andern Menschen erschienen
sein. Dies habe ich gemeint, wo ich gesagt habe, daß, wenn vom Fuße
des Turmes bis zur Spitze 300 Fuß sind; zuverlässig von der Spitze bis
zum Fuß gerade auch 300 Fuß sein werden *).
Demzufolge hätte man sich nicht wundern sollen, wenn man die Leute von
Genie meistens ungesellig, mitunter abstoßend gefunden hat: denn nicht
Mangel an Geselligkeit ist daran schuld: sondern ihr Wandel durch diese
Welt gleicht dem eines Spaziergängers an einem schönen, frühen Morgen,
wo er, mit Entzücken, die Natur betrachtet, in ihrer ganzen Frische und
Pracht; jedoch an diese sich zu halten hat: denn Gesellschaft ist nicht
zu finden; sondern höchstens nur Bauern, die, zur Erde gebückt, das
Land bestellen. So kommt es denn oft, daß ein großer Geist seinem Monolog
vor den in der Welt zu haltenden Dialogen den Vorzug gibt: läßt er sich
dennoch einmal zu einem solchen herbei; so kann es kommen, daß die Leere
desselben ihn doch wieder in den Monolog zurückfallen läßt, indem er
den Interlokutor vergißt, oder wenigstens unbekümmert, ob dieser ihn
verstehe, oder nicht, zu ihm redet wie das Kind zur Puppe.
Bescheidenheit in einem großen Geiste würde den Leuten wohl gefallen:
nur ist sie leider eine contradictio in adjecto. Ein solcher nämlich
müßte den Gedanken, Meinungen und Ansichten, wie auch der Art und Manier
der andern, und zwar jener andern, deren Zahl Legio ist, Vorzug und Wert
vor seinen eigenen einräumen und diese, stets sehr davon abweichenden,
jenen unterordnen und anbequemen, oder auch sie ganz unterdrücken, um
jene walten zu lassen.
Dann aber würde er eben nichts, oder dasselbe, hervorbringen und leisten,
was auch die andern. Das Große, Echte und Außerordentliche, kann er
vielmehr nur hervorbringen, sofern er die Art und Weise, die Gedanken
und Ansichten, seiner Zeitgenossen für nichts achtet, ungestört schafft
was sie tadeln, und verachtet was sie loben. Ohne diese Arroganz wird
kein großer Mann. Sollte nun aber sein Leben und Wirken etwan in eine
Zeit gefallen sein, die ihn nicht erkennen und schätzen kann; so bleibt
er doch immer er selbst und gleicht dann einem vornehmen Reisenden, der
die Nacht in einer elenden Herberge zubringen muß: er reist am andern
Tage vergnügt weiter.
Allenfalls kann jedoch ein denkender, oder dichtender Kopf mit seinem
Zeitalter schon zufrieden sein, wenn es ihm nur vergönnt, in seinem Winkel
ungestört zu denken und zu dichten; und mit seinem Glück, wenn es ihm
einen Winkel schenkt, in welchem er denken und dichten kann, ohne sich
um die andern kümmern zu müssen.
Denn daß das Gehirn ein bloßer Arbeiter im Dienste des Bauches sei,
ist freilich das gemeinsame Los fast aller derer, die nicht von der Arbeit
ihrer Hände leben, und sie wissen sich recht gut darin zu finden. Aber
für die großen Köpfe, d. h. für die, deren cerebrale Kräfte über
das zum Dienste des Willens erforderliche Maß hinausgehn, ist es eine
Sache zum Verzweifeln. Daher wird ein solcher es vorziehn, nötigenfalls
in der beschränktesten Lage zu leben, wenn sie ihm den freien Gebrauch
seiner Zeit zur Entwickelung und Anwendung seiner Kräfte, also die für
ihn unschätzbare Muße, gewährt. Anders freilich steht es mit den gewöhnlichen
Leuten, deren Muße ohne objektiven Wert, sogar für sie nicht ohne Gefahr
ist: sie scheinen dies zu fühlen. Denn die zu beispielloser Höhe gestiegene
Technik unsrer Zeit gibt, indem sie die Gegenstände des Luxus vervielfältigt
und vermehrt, den vom Glücke Begünstigteren die Wahl zwischen mehr Muße
und Geistesbildung einerseits und mehr Luxus und Wohlleben, bei angestrengter
Thätigkeit, andrerseits: sie wählen, charakteristisch, in der Regel
das letztere, und ziehn den Champagner der Muße vor. Dies ist auch konsequent:
denn ihnen ist jede Geistesanstrengung, die nicht den Zwecken des Willens
dient, eine Thorheit, und die Neigung dazu nennen sie Excentrizität.
Danach wäre das Beharren bei den Zwecken des Willens und Bauches die
Koncentrizität: auch ist allerdings der Wille das Centrum, ja, und der
Kern der Welt.
Im ganzen jedoch sind dergleichen Alternativen kein gar häufiger Fall.
Denn, wie die meisten Menschen einerseits keinen Ueberfluß am Gelde haben,
sondern knapp das Notdürftige; so auch andererseits nicht am Verstand.
Sie haben dessen knapp so viel, wie zum Dienste ihres Willens, d. h. zur
Betreibung ihres Erwerbs, ausreicht. Dies gethan, sind sie froh, maulassen
zu dürfen, oder sich an sinnlichen Genüssen, auch wohl an kindischen
Spielen zu ergötzen, an Karten, an Würfeln, oder auch sie führen miteinander
die plattesten Diskurse, oder sie putzen sich heraus und machen dann einander
Bücklinge. Schon derer, die einen ganz kleinen Ueberschuß intellektueller
Kräfte haben, sind wenige. Wie nun die, welche einen kleinen Ueberschuß
am Gelde haben, sich ein Pläsir machen; so machen auch diese sich ein
intellektuelles Pläsir. Sie betreiben irgend ein liberales Studium, das
nichts abwirft, oder eine Kunst, und sind überhaupt schon eines objektiven
Interesses in irgend einer Art fähig; daher man auch einmal mit ihnen
konversieren kann. Mit den andern hingegen ist es besser, sich nicht einzulassen:
denn mit Ausnahme der Fälle, wo sie gemachte Erfahrungen erzählen, aus
ihrem Fache etwas berichten, oder allenfalls etwas von einem andern Gelerntes
beibringen, wird was sie sagen nicht des Anhörens wert sein; was man
aber ihnen sagt werden sie selten recht verstehen und fassen, auch wird
es meistens ihren Ansichten zuwiderlaufen. Balthasar Gracian bezeichnet
sie daher sehr treffend als hombres que no lo son, — Menschen, die keine
sind, und dasselbe sagt Giordano Bruno (Della Causa, Dial. l.) mit diesen
Worten: quanta differenza sia di contrattare e ritrovarsi tra gli uomini,
e tra color, che son fatti ad imagine e similitudine di quelli (S. Opp.
ed. Wagner, Vol. l, p. 224), welches letztere Wort wundervoll übereinstimmt
mit dem Ausspruch des Kural: „Das gemeine Volk sieht wie Menschen aus;
etwas diesem Gleiches hab’ ich nie gesehn.“ (S. den Kural des Tiruvalluver,
übersetzt von Graul, S. 140.) **) — Für das Bedürfnis aufheiternder
Unterhaltung und um der Einsamkeit die Oede zu benehmen, empfehle ich
hingegen die Hunde, an deren moralischen und intellektuellen Eigenschaften
man fast allemal Freude und Befriedigung erleben wird.
Indessen wollen wir überall uns hüten, ungerecht zu werden. Wie mich
oft die Klugheit und bisweilen wieder die Dummheit meines Hundes in Erstaunen
gesetzt hat; nicht anders ist es mir mit dem Menschengeschlechte gegangen.
Unzählige Male hat mich die Unfähigkeit, gänzliche Urteilslosigkeit
und Bestialität desselben in Entrüstung versetzt und habe ich in den
alten Stoßseufzer
Humani generis mater nutrixque profecto
Stultitia est,
einstimmen müssen. Allein zu andern Zeiten wieder bin ich darüber erstaunt,
wie bei einem solchen Geschlechte vielerlei nützliche und schöne Künste
und Wissenschaften, wenn auch stets von den Einzelnen, den Ausnahmen,
ausgegangen, doch haben entstehn, Wurzel fassen, sich erhalten und vervollkommnen
können, und wie dies Geschlecht, mit Treue und Ausdauer, die Werke großer
Geister, den Homer, den Plato, den Horaz u. s. w., zwei bis drei Jahrtausende
hindurch, mittelst Abschreiben und Aufbewahren sich erhalten und vor dem
Untergang geschützt hat, unter allen Plagen und Greueln seiner Geschichte;
wodurch es bewiesen hat, daß es den Wert derselben erkannte; imgleichen
über spezielle, einzelne Leistungen, mitunter auch über Züge von Geist,
oder Urteil, wie durch Inspiration, bei solchen, die übrigens zum großen
Haufen gehören, ja, bisweilen sogar bei diesem selbst, wann er, wie meistens,
sobald nur sein Chorus groß und vollständig geworden, sehr richtig urteilt:
wie der Zusammenklang auch ungeschulter Stimmen, wenn nur ihrer sehr viele
sind, stets harmonisch ausfällt. Die hierüber Hinausgehenden, welche
man als Genies bezeichnet, sind bloß die lucida intervalla des ganzen
Menschengeschlechts. Sie leisten demnach was den übrigen schlechthin
versagt ist. Demgemäß ist denn auch ihre Orginalität so groß, daß
nicht nur ihre Verschiedenheit von den übrigen Menschen augenfällig
wird, sondern selbst die Individualität eines jeden von ihnen so stark
ausgeprägt ist, daß zwischen allen je dagewesenen Genies ein gänzlicher
Unterschied des Charakters und Geistes stattfindet, vermöge dessen jedes
derselben an seinen Werken der Welt ein Geschenk dargebracht hat, welches
sie außerdem von gar keinem andern in der gesamten Gattung jemals hätte
erhalten können. Darum eben ist Ariostos natura lo fece, e poi ruppe
lo stampo ein so überaus treffendes und mit Recht berühmtes Gleichnis.
*) Die großen Geister sind den kleinen Geistern deshalb einige Schonung
schuldig; weil sie eben nur vermöge der Kleinheit dieser große Geister
sind; indem alles relativ ist.
**) Wenn man die große Uebereinstimmung des Gedankens, ja, des Ausdrucks,
bei so weit auseinander liegenden Ländern und Zeiten bedenkt, kann man
nicht zweifeln, daß sie aus dem Objekt entsprungen ist. Ich stand daher
gewiß nicht unter dem Einfluß dieser Stellen (von denen die eine noch
nicht gedruckt, die andere seit zwölf Jahren nicht in meinen Händen
gewesen war), als ich, vor etwa zwanzig Jahren, damit umging, mir eine
Tabaksdose machen zu lassen, auf deren Deckel, womöglich in Mosaik, zwei
schöne große Kastanien abgebildet wären, nebst einem Blatt, welches
verriet, daß sie Roßkastanien seien. Dieses Symbol sollte eben jenen
Gedanken jederzeit mir vergegenwärtigen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Man könnte aus der physischen Astronomie folgende teleologische Betrachtung
ableiten.
Die zum Erkalten oder Erwärmen eines Körpers in einem Medio von heterogener
Temperatur nötige Zeit steht in einem schnell anwachsenden Verhältnis
zu seiner Größe, welches danach in Hinsicht auf die als heiß angenommenen
verschiedenen Massen der Planeten zu berechnen schon Buffon bemüht gewesen
ist; jedoch mit mehr Gründlichkeit und Erfolg, in unsern Tagen, Fourier.
Im kleinen zeigen es uns die Gletscher, welche kein Sommer zu schmelzen
vermag, und sogar das Eis im Keller, als wo eine hinlänglich große Masse
desselben sich erhält. Hienach hätte, beiläufig gesagt, das divide
et impera seine beste Veranschaulichung an der Wirkung der Sonnenwärme
auf das Eis.
Die vier großen Planeten empfangen äußerst wenig Wärme von der Sonne;
da z. B. auf dem Uranus die Beleuchtung nur ¹⁄₃₆₈ derjenigen
beträgt, welche die Erde erhält. Folglich sind sie, zur Erhaltung des
Lebens auf ihrer Oberfläche, ganz auf ihre innere Wärme verwiesen; während
die Erde es fast ganz auf die äußere, von der Sonne kommende ist; wenn
nämlich wir den Berechnungen Fouriers trauen, nach welchen die Wirkung
der so intensen Hitze des Innern der Erde auf die Oberfläche nur noch
ein Minimum beträgt. Bei der Größe der vier großen Planeten, welche
die der Erde respektive 80 bis 1300mal übertrifft, ist nun die zu ihrer
Abkühlung erforderliche Zeit unberechenbar lang. Haben wir doch von der
Abkühlung der gegen sie so kleinen Erde nicht die geringste Spur in der
historischen Zeit; wie dies ein Franzose, höchst scharfsinnig, daraus
bewiesen hat, daß der Mond, im Verhältnis zur Rotation der Erde, nicht
langsamer geht, als in der frühesten Zeit, von der wir Kunde haben. Wäre
nämlich die Erde irgend kälter geworden; so müßte sie in eben dem
Maße sich zusammengezogen haben; wodurch eine Beschleunigung ihrer Rotation
entstanden sein würde, während der Gang des Mondes unverändert blieb.
Diesem nach erscheint es als höchst zweckmäßig, daß die großen Planeten
die von der Sonne weit entfernten, die kleinen hingegen die ihr nahestehenden
sind und der allerkleinste der allernächste. Denn diese werden allmählich
ihre innere Wärme verlieren, oder wenigstens sich so dick inkrustieren,
daß sie nicht mehr zur Oberfläche durchdringt: sie bedürfen daher der
äußeren Wärmequelle. Die Planetoiden sind, als bloße Fragmente eines
auseinandergesprengten Planeten, eine ganz zufällige Abnormität, kommen
also hier nicht in Betracht. Wohl aber ist dieses Accidenz an und für
sich ein bedenklich antiteleologisches. Wir wollen hoffen, daß die Katastrophe
stattgefunden hat, ehe der Planet bewohnt gewesen. Jedoch kennen wir die
Rücksichtslosigkeit der Natur: ich stehe für nichts. Daß aber diese
von Olbers aufgestellte und durchaus wahrscheinliche Hypothese jetzt wieder
bestritten wird, — hat vielleicht ebensoviel theologische, als astronomische
Gründe.
Damit jedoch die aufgestellte Teleologie vollkommen wäre, müßten die
vier großen Planeten so stehn, daß der größte unter ihnen der entfernteste,
der kleinste aber der nächste wäre: allein hiemit verhält es sich vielmehr
umgekehrt. Auch könnte man einwenden, daß ihre Masse viel leichter,
also auch lockerer ist, als die der kleinen Planeten: doch ist sie dies
lange nicht in dem Verhältnis, um den enormen Unterschied der Größe
zu kompensieren. Vielleicht ist sie es nur infolge ihrer inneren Wärme.
Ein Gegenstand ganz besonderer teleologischer Bewunderung ist die Schiefe
der Ekliptik; weil nämlich ohne sie kein Wechsel der Jahreszeiten eintreten,
sondern immerwährender Frühling auf der Erde herrschen würde, wobei
die Früchte nicht reifen und gedeihen könnten und folglich die Erde
nicht überall bis nahe an die Pole heran bewohnt sein könnte. Daher
sehn in der Schiefe der Ekliptik die Physikotheologen die weiseste aller
Vorkehrungen und die Materialisten den glücklichsten aller Zufälle.
Diese Bewunderung, bei der besonders Herder (Ideen zur Philosophie der
Geschichte I, 4) sich begeistert, ist jedoch, beim Lichte betrachtet,
ein wenig einfältig. Denn, wenn besagtermaßen ewiger Frühling herrschte;
so würde die Pflanzenwelt gewiß nicht verfehlt haben, ihre Natur auch
danach einzurichten, nämlich so, daß eine weniger intense, dagegen aber
stets anhaltende und gleichmäßige Wärme ihr angemessen wäre; eben
wie die jetzt fossile Flora der Vorwelt sich auf eine durchaus andere
Beschaffenheit des Planeten eingerichtet hatte, gleichviel wodurch diese
verursacht wurde, und bei derselben wundervoll gedieh.
Daß auf dem Monde keine Atmosphäre sich durch Refraktion kundgibt, ist
notwendige Folge seiner geringen Masse, die nur ¹⁄₈₈ der unsers
Planeten beträgt und demnach so geringe Anziehungskraft ausübt, daß
unsere Luft, dahin versetzt, nur ¹⁄₈₈ ihrer Dichtigkeit behalten
würde, folglich keine merkliche Refraktion bewirken könnte und ebenso
machtlos im übrigen sein muß. —
Hier mag nun auch eine Hypothese über die Mondoberfläche eine Stelle
finden; da ich sie zu verwerfen mich nicht entschließen kann; obwohl
ich die Schwierigkeiten, denen sie unterworfen ist, recht wohl einsehe,
sie auch nur als eine gewagte Konjektur betrachte und mitteile. Es ist
diese, daß das Wasser des Mondes nicht abwesend, sondern gefroren sei,
indem der Mangel einer Atmosphäre eine fast absolute Kälte herbeiführt,
welche sogar die, außerdem durch denselben begünstigte Verdünstung
des Eises nicht zuläßt. Nämlich bei der Kleinheit des Mondes, — an
Volumen ¹⁄₄₉, an Masse ¹⁄₈₈ der Erde, — müssen wir seine
innere Wärmequelle als erschöpft, oder wenigstens als nicht mehr auf
die Oberfläche wirkend, betrachten. Von der Sonne erhält er nicht mehr
Wärme, als die Erde. Denn, obgleich er, einmal im Monat, ihr um so viel,
als sein Abstand von uns beträgt, näher kommt, wobei er zudem stets
nur die allezeit von uns abgewandte Seite ihr zukehrt; so erhält diese
Seite dadurch, nach Mädler, doch nur eine im Verhältnis von 101 zu 100
hellere Beleuchtung (folglich auch Erwärmung), als die uns zugekehrte,
welche nie in diesen Fall und sogar in den entgegengesetzten kommt, wann
er nämlich, nach 14 Tagen, wieder um ebensoviel weiter, als wir von ihm
abstehn, von der Sonne sich entfernt hat. Wir haben also keinen stärkern
erwärmenden Einfluß der Sonne auf den Mond anzunehmen, als der ist,
den sie auf die Erde hat; ja, sogar einen schwächern, da derselbe für
jede Seite zwar 14 Tage dauert, dann aber durch eine ebensolange Nacht
unterbrochen wird, welche die Anhäufung seiner Wirkung verhindert. —
Nun aber ist jede Erwärmung durch das Sonnenlicht von der Gegenwart einer
Atmosphäre abhängig. Denn sie geschieht nur vermöge der Metamorphose
des Lichtes in Wärme, welche eintritt, wann dasselbe auf einen opaken,
d. h. ihm als Licht undurchdringlichen Körper trifft: einen solchen kann
es nämlich nicht, wie den durchsichtigen, durch welchen es zu ihm gelangte,
in seinem blitzschnellen geradlinigen Gange durchschießen: alsdann verwandelt
es sich in die sich nach allen Seiten verbreitende und aufsteigende Wärme.
Diese nun aber, als absolut leicht (imponderabel), muß kohibiert und
zusammengehalten werden, durch den Druck einer Atmosphäre, sonst verfliegt
sie schon im Entstehn. Denn so blitzschnell auch das Licht, in seiner
ursprünglichen, strahlenden Natur, die Luft durchschneidet, so langsam
ist hingegen sein Gang, wann es, in Wärme verwandelt, das Gewicht und
den Widerstand eben dieser Luft zu überwältigen hat, welche bekanntlich
der schlechteste aller Wärmeleiter ist. Ist hingegen dieselbe verdünnt,
so entweicht auch die Wärme leichter, und wenn dieselbe ganz fehlt, augenblicklich.
Dieserhalb sind die hohen Berge, wo der Druck der Atmosphäre doch erst
auf die Hälfte reduziert ist, mit ewigem Schnee bedeckt, hingegen tiefe
Thäler, wenn weit, die wärmsten: was muß es nun erst sein, wo die Atmosphäre
ganz fehlt! Hinsichtlich der Temperatur also hätten wir unbedenklich
alles Wasser auf dem Monde als gefroren anzunehmen. Allein jetzt entsteht
die Schwierigkeit, daß, wie die Verdünnung der Atmosphäre das Kochen
befördert und den Siedepunkt erniedrigt, die gänzliche Abwesenheit derselben
den Verdünstungsprozeß überhaupt sehr beschleunigen muß, wonach das
gefrorene Wasser des Mondes längst hätte verdünstet sein müssen. Dieser
Schwierigkeit nun begegnet die Erwägung, daß jede Verdünstung, selbst
die im luftleeren Raum, nur vermöge einer sehr bedeutenden, eben durch
sie latent werdenden, Quantität Wärme vor sich geht. Diese Wärme nun
aber fehlt auf dem Monde, als wo die Kälte beinahe eine absolute sein
muß; weil die, durch die unmittelbare Einwirkung der Sonnenstrahlen entwickelte
Wärme augenblicklich verfliegt und die geringe Verdünstung, die sie
etwan dabei dennoch bewirkt, alsbald durch die Kälte wieder niedergeschlagen
wird, gleich dem Reif *). Denn daß die Verdünnung der Luft, so sehr
sie, an sich selbst, die Verdünstung befördert, diese noch mehr dadurch
verhindert, daß sie die dazu nötige Wärme entweichen läßt, sehn wir
eben auch am Alpenschnee, der so wenig durch Verdünstung, wie durch Schmelzung,
verschwindet. Bei gänzlicher Abwesenheit der Luft nun wird, in gleichem
Verhältnis, das augenblickliche Entweichen der sich entwickelnden Wärme
der Verdünstung ungünstiger sein, als der Mangel des Luftdrucks, an
sich selbst, ihr günstig ist. — Dieser Hypothese zufolge hätten wir
alles Wasser auf dem Monde als in Eis verwandelt und namentlich den ganzen,
so rätselhaften, graueren Teil seiner Oberfläche, den man allezeit als
maria bezeichnet hat, als gefrorenes Wasser anzusehn, wo alsdann seine
vielen Unebenheiten keine Schwierigkeit mehr machen und die so auffallenden,
tiefen und meist geraden Rillen, die ihn durchschneiden, als weit klaffende
Spalte im geborstenen Eise zu erklären wären, welcher Auslegung ihre
Gestalt sehr günstig ist **).
Im allgemeinen ist übrigens der Schluß vom Mangel der Atmosphäre und
des Wassers auf Abwesenheit alles Lebens nicht ganz sicher; sogar könnte
man ihn kleinstädtisch nennen, sofern er auf der Voraussetzung partout
comme chez nous beruht. Das Phänomen des tierischen Lebens könnte wohl
noch auf andere Weise vermittelt werden, als durch Respiration und Blutumlauf;
denn das Wesentliche alles Lebens ist allein der beständige Wechsel der
Materie, beim Beharren der Form. Wir freilich können uns dies nur unter
Ver- mittelung des Flüssigen und Dunstförmigen denken. — Allein die
Materie ist überhaupt die bloße Sichtbarkeit des Willens. Dieser nun
aber strebt überall die Steigerung seiner Erscheinung, von Stufe zu Stufe,
an. Die Formen, Mittel und Wege dazu können gar mannigfaltig sein. —
Andrerseits wieder ist zu erwägen, daß höchst wahrscheinlich die chemischen
Elemente, nicht nur auf dem Monde, sondern auch auf allen Planeten dieselben,
wie auf der Erde sind; weil das ganze System aus demselben Ur-Licht-Nebel,
in den die jetzige Sonne ausgebreitet war, sich abgesetzt hat. Dies läßt
allerdings eine Aehnlichkeit auch der höhern Willenserscheinungen vermuten.
*) Dieser Hypothese ist das Lesliesche Experiment, vorgetragen von Pouillet,
Vol. I, p. 368, durchaus günstig. Wir sehn nämlich das Wasser im Luftleeren
gefrieren, weil die Verdünstung ihm selbst die Wärme geraubt hat, die
nötig war, es flüssig zu erhalten.
**) Der Pater Secchi in Rom schreibt, bei Uebersendung einer Photographie
des Mondes, am 6. April 1858: Très remarquable dans la pleine lune est
le fond noir des parties lisses, et le grand èclat des parties raboteuses:
doit on croire celles-ci couvertes de glaces ou de neige? (S. Comptes
rendus, 28. April 1858.)
(In einem ganz neuen Drama heißt es:
That l could clamber to the frozen moon,
And draw the ladder after me!
— ist Dichter Instinkt.)
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Bei den allerschwierigsten Problemen, an deren Lösung beinahe verzweifelt
wird, müssen wir die wenigen und geringen Data, welche wir haben, zum
möglichsten Vorteil benutzen, um, durch Kombination derselben, doch etwas
herauszubringen.
In der „Chronik der Seuchen“ von Schnurrer, 1825, finden wir, daß,
nachdem im 14. Jahrhundert der schwarze Tod ganz Europa, einen großen
Teil Asiens und auch Afrikas entvölkert hatte, gleich darauf eine ganz
außerordentliche Fruchtbarkeit des Menschengeschlechts eingetreten und
namentlich die Zwillingsgeburten sehr häufig geworden seien. In Uebereinstimmung
hiemit lehrt Casper („Ueber die wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen“,
1835), auf vielfach wiederholte Erfahrungen im großen gestützt, daß,
in der gegebenen Bevölkerung eines Distrikts, die Sterblichkeit und Lebensdauer
stets gleichen Schritt hält mit der Zahl der Zeugungen in derselben;
so daß die Sterbefälle und die Geburten allemal und allerorten sich
in gleichem Verhältnis vermehren und vermindern, welches er, durch aufgehäufte
Belege aus vielen Ländern und ihren verschiedenen Provinzen, außer Zweifel
setzt. Nur irrt er darin, daß er durchgängig Ursach und Wirkung verwechselt,
indem er die Vermehrung der Geburten für die Ursache der Vermehrung der
Todesfälle hält; nach meiner Ueberzeugung hingegen und in Uebereinstimmung
mit dem von Schnurrer beigebrachten Phänomen, welches ihm nicht bekannt
zu sein scheint, umgekehrt, die Vermehrung der Sterbefälle es ist, welche
die Vermehrung der Geburten, nicht durch physischen Einfluß, sondern
durch einen metaphysischen Zusammenhang nach sich zieht; wie ich dieses
schon erörtert habe in den Ergänzungen zur „Welt als Wille und Vorstellung“,
Kap. 41, S. 507 (Bd. 6, S. 55 dieser Gesamtausgabe). Also hängt, im ganzen
genommen, die Zahl der Geburten ab von der Zahl der Sterbefälle.
Hienach wäre es ein Naturgesetz, daß die prolifike Kraft des Menschengeschlechts,
welche nur eine besondere Gestalt der Zeugungskraft der Natur überhaupt
ist, durch eine ihr antagonistische Ursache erhöht wird, also mit dem
Widerstande wächst; — daher man, mutatis mutandis, dieses Gesetz dem
Mariottischen subsumieren könnte, daß mit der Kompression der Widerstand
ins Unendliche zunimmt. Nehmen wir nun an, jene, der prolifiken Kraft
antagonistische Ursache trete einmal, durch Verheerungen, mittelst Seuchen,
Naturrevolutionen u. s. w., in einer noch nie dagewesenen Größe und
Wirksamkeit auf; so müßte nachher auch wieder die prolifike Kraft auf
eine bis jetzt ganz unerhörte Höhe steigen. Gehn wir endlich in jener
Verstärkung der antagonistischen Ursache bis zum äußersten Punkt, also
der gänzlichen Ausrottung des Menschengeschlechts; so wird auch die so
eingezwängte prolifike Kraft eine dem Druck angemessene Gewalt erlangen,
mithin zu einer Anstrengung gebracht werden, die das jetzt unmöglich
Scheinende leistet, nämlich, da ihr die generatio univoca, d. h. die
Geburt des Gleichen vom Gleichen, versperrt wäre, sich dann auf die generatio
aequivoca werfen. Diese jedoch läßt sich auf den obern Stufen des Tierreichs
nicht mehr so denken, wie sie auf den alleruntersten sich uns darstellt:
nimmermehr kann die Gestalt des Löwen, des Wolfes, des Elefanten, des
Affen, oder gar des Menschen, nach Art der Infusionstierchen, der Entozoen
und Epizoen entstanden sein und etwan geradezu sich erhoben haben aus
zusammengerinnendem, sonnebebrüteten Meeresschlamm, oder Schleim, oder
aus faulender organischer Masse; sondern ihre Entstehung kann nur gedacht
werden als generatio in utero heterogeneo, folglich so, daß aus dem Uterus,
oder vielmehr dem Ei, eines besonders begünstigten tierischen Paares,
nachdem die durch irgend etwas gehemmte Lebenskraft seiner Spezies gerade
in ihm sich angehäuft und abnorm erhöht hatte, nunmehr einmal, zur glücklichen
Stunde, beim rechten Stande der Planeten und dem Zusammentreffen aller
günstigen atmosphärischen, tellurischen und astralischen Einflüsse,
ausnahmsweise nicht mehr seinesgleichen, sondern die ihm zunächst verwandte,
jedoch eine Stufe höher stehende Gestalt hervorgegangen wäre; so daß
dieses Paar, dieses Mal, nicht ein bloßes Individuum, sondern eine Spezies
erzeugt hätte. Vorgänge dieser Art konnten natürlich erst eintreten,
nachdem die alleruntersten Tiere sich, durch die gewöhnliche generatio
aequivoca, aus organischer Fäulnis, oder aus dem Zellengewebe lebender
Pflanzen ans Licht emporgearbeitet hatten, als erste Vorboten und Quartiermacher
der kommenden Tiergeschlechter. Ein solcher Hergang muß eingetreten sein
nach jeder jener großen Erdrevolutionen, welche schon wenigstens dreimal
alles Leben auf dem Planeten völlig ausgelöscht haben, so daß es sich
von neuem zu entzünden hatte, wonach es jedesmal in vollkommeneren, d.
h. der jetzigen Fauna näher stehenden Gestalten aufgetreten ist. Aber
erst in der, nach der letzten großen Katastrophe der Erdoberfläche auftretenden
Tierreihe hat jener Hergang sich bis zur Entstehung des Menschengeschlechtes
gesteigert, nachdem er schon bei der vorletzten es bis zum Affen gebracht
hatte. Die Batrachier führen vor unsern Augen ein Fischleben, ehe sie
ihre eigene, vollkommene Gestalt annehmen, und nach einer jetzt ziemlich
allgemein anerkannten Bemerkung, durchgeht ebenso jeder Fötus successive
die Formen der unter seiner Spezies stehenden Klassen, bis er zur eigenen
gelangt. Warum sollte nun nicht jede neue und höhere Art dadurch entstanden
sein, daß diese Steigerung der Fötusform einmal noch über die Form
der ihn tragenden Mutter um eine Stufe hinausgegangen ist? — Es ist
die einzige rationelle, d. h. vernünftigerweise denkbare Entstehungsart
der Spezies, die sich ersinnen läßt.
Wir haben aber diese Steigerung uns zu denken nicht als in einer einzigen
Linie, sondern in mehreren nebeneinander aufsteigenden. So z. B. ist einmal
aus dem Ei eines Fisches ein Ophidier, ein andermal aus dieses seinem
ein Saurier, zugleich aber aus dem eines andern Fisches ein Batrachier,
dann aber aus dieses seinem ein Chelonier hervorgegangen, aus dem eines
dritten ein Cetacee, etwan ein Delphin, später wieder hat ein Cetacee
eine Phoka geboren und endlich eine Phoka das Walroß; und vielleicht
ist aus dem Ei der Ente das Schnabeltier und aus dem eines Straußen irgend
ein größeres Säugetier entstanden. Ueberhaupt muß der Vorgang in vielen
Ländern der Erde zugleich und in gegenseitiger Unabhängigkeit stattgefunden
haben, überall jedoch in sogleich bestimmten, deutlichen Stufen, deren
jede eine feste, bleibende Spezies gab; nicht aber in allmählichen, verwischten
Uebergängen; also nicht nach Analogie eines von der untern Oktave bis
zur obersten allmählich steigenden, folglich heulenden Tones, sondern
nach der einer in bestimmten Absätzen aufsteigenden Tonleiter. Wir wollen
es uns nicht verhehlen, daß wir danach die ersten Menschen uns zu denken
hätten als in Asien vom Pongo (dessen Junges Orang - Utang heißt) und
in Afrika vom Schimpanse geboren, wiewohl nicht als Affen, sondern sogleich
als Menschen. Merkwürdig ist es, daß diesen Ursprung sogar ein buddhaistischer
Mythos lehrt, der zu finden ist in J. J. Schmidts „Forschungen über
die Mongolen und Tibeter“, S. 210—214, wie auch in Klaproths Fragments
Bouddhiques im Nouveau Journal asiatique, 1831 Mars, desgleichen in Köppens
„Die Lamaische Hierarchie“, S. 45.
Den hier ausgeführten Gedanken einer generatio aequivoca in utero heterogeneo
hat zuerst der anonyme Verfasser der Vestiges of the natural history of
Creation (6th edition, 1847) aufgestellt, wiewohl keineswegs mit gehöriger
Deutlichkeit und Bestimmtheit; weil er ihn eng verwebt hat mit unhaltbaren
Annahmen und großen Irrtümern; welches im letzten Grunde daraus entspringt,
daß bei ihm, als Engländern, jede die bloße Physik überschreitende,
also metaphysische Annahme sogleich Zusammenfällt mit dem hebräischen
Theismus, welchen eben vermeiden wollend er dann das Gebiet der Physik
ungebührlich ausdehnt. So ein Engländer in seiner Verwahrlosung und
völligen Roheit hinsichtlich aller spekulativen Philosophie, oder Metaphysik,
ist eben gar keiner geistigen Auffassung der Natur fähig: er kennt daher
kein Mittleres zwischen einer Auffassung ihres Wirkens, als nach strenger,
womöglich mechanischer Gesetzmäßigkeit vor sich gehend, oder aber als
das vorher wohlüberlegte Kunstfabrikat des Hebräergottes, den er seinen
maker nennt. — Die Pfaffen, die Pfaffen in England haben es zu verantworten,
diese verschmitztesten aller Obskuranten. Sie haben die Köpfe daselbst
so zugerichtet, daß sogar in den kenntnisreichsten und aufgeklärtesten
derselben das Grundgedankensystem ein Gemisch von krassestem Materialismus
mit plumpester Judensuperstition ist, die darin, wie Essig und Oel, durcheinander
gerüttelt werden, und sehn mögen, wie sie sich vertragen, und daß,
infolge der Oxforder Erziehung, Mylords und Gentlemen in der Hauptsache
zum Pöbel gehören. Aber es wird nicht besser werden, solange noch die
orthodoxen Ochsen in Oxford die Erziehung der gebildeten Stände vollenden.
Auf demselben Standpunkt finden wir noch im Jahre 1859 den amerikanisierten
Franzosen Agassiz, in seinem Essay on classification. Auch er steht noch
vor derselben Alternative, daß die organische Welt entweder das Werk
des reinsten Zufalls sei, der sie, als ein Naturspiel physikalischer und
chemischer Kräfte, zusammengewürfelt hätte; oder aber ein am Lichte
der Erkenntnis (dieser functio animalis) nach vorhergegangener Ueberlegung
und Berechnung klug gefertigtes Kunstwerk. Eines ist so falsch wie das
andere, und beides beruht auf einem naiven Realismus, der aber 80 Jahre
nach Kants Auftreten geradezu schimpflich ist. Agassiz also philosophiert
über die Entstehung der organischen Wesen, wie ein amerikanischer Schuster.
Wenn die Herren nichts weiter gelernt haben und lernen wollen, als ihre
Naturwissenschaft; so müssen sie in ihren Schriften keinen Schritt über
diese hinausgehn, sondern strictissime bei ihrer Empirie bleiben, damit
sie sich nicht, wie der Herr Agassiz, prostituieren und zum Spott machen
dadurch, daß sie vom Ursprung der Natur reden, wie die alten Weiber.
Eine Folgerung nach der andern Seite aus jenem von Schnurrer und Casper
aufgestellten Gesetze wäre nun diese. Es ist offenbar, daß in dem Maße,
als es uns gelänge, durch richtigste und sorgfältigste Benutzung aller
Naturkräfte und jedes Landstriches, das Elend der untersten Volksklassen
zu verringern, die Zahl dieser überaus treffend so genannten Proletarier
zunehmen und dadurch das Elend sich immer von neuem einstellen würde.
Denn der Geschlechtstrieb arbeitet stets dem Hunger in die Hände; wie
dieser, wann er befriedigt ist, dem Geschlechtstrieb. Das obige Gesetz
nun aber würde uns dafür bürgen, daß die Sache nicht bis zu einer
eigentlichen Uebervölkerung der Erde getrieben werden könne, einem Uebel,
dessen Entsetzlichkeit die lebhafteste Phantasie sich kaum auszumalen
vermag. Nämlich dem in Rede stehenden Gesetz zufolge würde, nachdem
die Erde so viele Menschen erhalten hätte, als sie zu ernähren höchstens
fähig ist, die Fruchtbarkeit des Geschlechts unterdessen bis zu dem Grade
abgenommen haben, daß sie knapp ausreichte, die Sterbefälle zu ersetzen,
wonach alsdann jede zufällige Vermehrung dieser die Bevölkerung wieder
unter das Maximum zurückbringen würde.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Mir hat die Ansicht gar sehr eingeleuchtet, daß die akuten Krankheiten,
von einigen Ausnahmen abgesehn, nichts anderes sind, als Heilungsprozesse,
welche die Natur selbst einleitet, zur Abstellung irgend einer im Organismus
eingerissenen Unordnung; zu welchem Zwecke nun die vis naturae medicatrix,
mit diktatorischer Gewalt bekleidet, außerordentliche Maßregeln ergreift,
und diese machen die fühlbare Krankheit aus. Den einfachsten Typus dieses
so allgemeinen Hergangs liefert uns der Schnupfen. Durch Erkältung ist
die Thätigkeit der äußern Haut paralysiert und hiedurch die so mächtige
Exkretion mittelst der Exhalation aufgehoben; welches den Tod des Individuums
herbeiführen könnte. Da tritt alsbald die innere Haut, die Schleimhaut,
für jene äußere vikarierend ein: hierin besteht der Schnupfen, eine
Krankheit: offenbar ist aber diese bloß das Heilmittel des eigentlichen,
aber nicht fühlbaren Uebels, des Stillstandes der Hautfunktion. Diese
Krankheit, der Schnupfen, durchläuft nun dieselben Stadien, wie jede
andere, den Eintritt, die Steigerung, die Akme, und die Abnahme: anfangs
akut, wird sie allmählich chronisch und hält nun als solche an, bis
das fundamentale, aber selbst nicht fühlbare Uebel, die Lähmung der
Hautfunktion vorüber ist. Daher ist es lebensgefährlich, den Schnupfen
zurückzutreiben. Derselbe Hergang macht das Wesen der allermeisten Krankheiten
aus, und diese sind eigentlich nur das Medikament der vis naturae medicatrix.
Einem solchen Prozeß arbeitet die Allopathie, oder Enantiopathie, aus
allen Kräften entgegen; die Homoiopathie ihrerseits trachtet ihn zu beschleunigen,
oder zu verstärken; wenn nicht etwan gar, durch Karikieren desselben,
ihn der Natur zu verleiden; jedenfalls um die, überall auf jedes Uebermaß
und jede Einseitigkeit folgende, Reaktion zu beschleunigen. Beide demnach
wollen es besser verstehn, als die Natur selbst, die doch gewiß sowohl
das Maß, als die Richtung ihrer Heilmethode kennt. — Daher ist vielmehr
die Physiatrik in allen den Fällen zu empfehlen, die nicht zu den besagten
Ausnahmen gehören. Nur die Heilungen, welche die Natur selbst und aus
eigenen Mitteln zu stande bringt, sind gründlich. Auch hier gilt das
Tout ce qui n’est pas naturel est imparfait. Die Heilmittel der Aerzte
sind meistens bloß gegen die Symptome gerichtet, als welche sie für
das Uebel selbst halten; daher wir nach einer solchen Heilung uns unbehaglich
fühlen. Läßt man hingegen der Natur nur Zeit; so vollbringt sie allmählich
selbst die Heilung, nach welcher wir alsdann uns besser befinden, als
vor der Krankheit, oder, wenn ein einzelner Teil litt, dieser sich stärkt.
Man kann dies an leichten Uebeln, wie sie uns oft heimsuchen, bequem und
ohne Gefahr beobachten. Daß es Ausnahmen, also Fälle gibt, wo nur der
Arzt helfen kann, gebe ich zu: namentlich ist die Syphilis der Triumph
der Medizin. Aber bei weitem die meisten Genesungen sind bloß das Werk
der Natur, für welches der Arzt die Bezahlung einstreicht, — sogar
wenn sie nur seinen Bemühungen zum Trotz gelungen sind; und es würde
schlecht um den Ruhm und die Rechnungen der Aerzte stehn, wenn nicht der
Schluß cum hoc, ergo propter hoc so allgemein üblich wäre. Dazu kommt,
daß medicus est animi consolatio. Die guten Kunden der Aerzte sehn ihren
Leib an, wie eine Uhr, oder sonstige Maschine, die, wenn etwas an ihr
in Unordnung geraten ist, nur dadurch wieder hergestellt werden kann,
daß der Mechanikus sie repariert. So ist es aber nicht: der Leib ist
eine sich selbst reparierende Maschine: die meisten sich einstellenden
größern und kleinern Unordnungen werden, nach längerer oder kürzerer
Zeit, durch die vis naturae medicatrix ganz von selbst gehoben. Also lasse
man diese gewähren, und peu de médecin, peu de médecine.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Ich habe in meiner Theorie dargethan, daß auch die Herstellung des Weißen
aus Farben ausschließlich auf dem physiologischen Grunde ruht, indem
sie allein dadurch zu stande kommt, daß ein Farbenpaar, also daß zwei
Ergänzungsfarben, d. h. zwei Farben, in welche die Thätigkeit der Retina,
sich halbierend, auseinander getreten ist, wieder zusammengebracht werden.
Dies aber kann nur dadurch geschehn, daß die zwei äußern, jede von
ihnen im Auge anregenden Ursachen zugleich auf eine und dieselbe Stelle
der Retina wirken. Ich habe mehrere Arten dies zuwege zu bringen angegeben:
am leichtesten und einfachsten erhält man es, wenn man das Violett des
prismatischen Spektrums auf gelbes Papier fallen läßt. Sofern man aber
sich nicht mit bloß prismatischen Farben begnügen will, wird es am besten
dadurch gelingen, daß man eine transparente und eine reflektierte Farbe
vereinigt, z. B. auf einen Spiegel aus blauem Glase das Licht durch ein
rotgelbes Glas fallen läßt. Der Ausdruck „komplementäre Farben“
hat nur, sofern er im physiologischen Sinne verstanden wird, Wahrheit
und Bedeutung; außerdem schlechterdings nicht.
Was aber die Deutschen betrifft, so entspricht ihr Urteil über Goethes
Farbenlehre den Erwartungen, die man sich zu machen hat von einer Nation,
welche einen geist- und verdienstlosen, Unsinn schmierenden, und durchaus
hohlen Philosophaster, wie Hegel, 30 Jahre lang als den größten aller
Denker und Weisen präkonisieren konnte, und zwar in einem solchen Tutti,
daß ganz Europa davon widerhallte. Wohl weiß ich, daß desipere est
juris gentium, d. h. daß jeder das Recht hat, zu urteilen, wie er’s
versteht und wie’s ihm beliebt: dafür aber wird er sich dann auch gefallen
lassen, von Nachkommen und zuvor noch von Nachbarn nach seinen Urteilen
beurteilt zu werden. Denn auch hier gibt es noch eine Nemesis.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Goethe hatte den treuen, sich hingebenden, objektiven Blick in die Natur
der Sachen; Newton war bloß Mathematiker, stets eilig nur zu messen und
zu rechnen, und zu dem Zweck eine aus der oberflächlich aufgefaßten
Erscheinung zusammengeflickte Theorie zum Grunde legend. Dies ist die
Wahrheit: schneidet Gesichter wie ihr wollt!
Hier mag nun noch ein Aufsatz dem größeren Publiko mitgeteilt werden,
mit welchem ich mein Blatt des, bei Gelegenheit des hundertjährigen Geburtstages
Goethes, im Jahr 1849, von der Stadt Frankfurt eröffneten und in ihrer
Bibliothek deponierten Albums auf beiden Seiten vollgeschrieben habe.
— Der Eingang desselben bezieht sich auf die höchst imposanten Feierlichkeiten,
mit denen jener Tag öffentlich daselbst begangen worden war.
In das Frankfurter Goethe-Album.
Nicht bekränzte Monumente, noch Kanonensalven, noch Glockengeläute,
geschweige Festmahle mit Reden, reichen hin, das schwere und empörende
Unrecht zu sühnen, welches Goethe erleidet in betreff seiner Farbenlehre.
Denn, statt daß die vollkommene Wahrheit und hohe Vortrefflichkeit derselben
gerechte Anerkennung gefunden hätte, gilt sie allgemein für einen verfehlten
Versuch, über welchen, wie jüngst eine Zeitschrift sich ausdrückte,
die Leute vom Fache nur lächeln, ja für eine mit Nachsicht und Vergessenheit
zu bedeckende Schwäche des großen Mannes. — Diese beispiellose Ungerechtigkeit,
diese unerhörte Verkehrung aller Wahrheit, ist nur dadurch möglich geworden,
daß ein stumpfes, träges, gleichgültiges, urteilsloses, folglich leicht
betrogenes Publikum in dieser Sache sich aller eigenen Untersuchung und
Prüfung, — so leicht auch, sogar ohne Vorkenntnisse, solche wäre,
— begeben hat, um sie den „Leuten von Fach“, d. h. den Leuten, welche
eine Wissenschaft nicht ihrer selbst, sondern des Lohnes wegen betreiben,
anheimzustellen, und nun von diesen sich durch Machtsprüche und Grimassen
imponieren läßt. Wollte nun einmal dieses Publikum nicht aus eigenen
Mitteln urteilen, sondern, wie die Unmündigen, sich durch Auktorität
leiten lassen; so hätte doch wahrlich die Auktorität des größten Mannes,
welchen, neben Kant, die Nation aufzuweisen hat, und noch dazu in einer
Sache, die er, sein ganzes Leben hindurch, als seine Hauptangelegenheit
betrieben hat, mehr Gewicht haben sollen, als die vieler Tausende solcher
Gewerbsleute zusammengenommen. Was nun die Entscheidung dieser Fachmänner
betrifft; so ist die ungeschminkte Wahrheit, daß sie sich erbärmlich
geschämt haben, als zu Tage kam, daß sie das handgreiflich Falsche nicht
nur sich hatten aufbinden lassen, sondern es hundert Jahre hindurch, ohne
alle eigene Untersuchung und Prüfung, mit blindem Glauben und andächtiger
Bewunderung, verehrt, gelehrt und verbreitet hatten, bis denn zuletzt
ein alter Poet gekommen war, sie eines Bessern zu belehren. Nach dieser,
nicht zu verwindenden Demütigung haben sie alsdann, wie Sünder pflegen,
sich verstockt, die späte Belehrung trotzig von sich gewiesen und durch
ein, jetzt schon vierzigjähriges, hartnäckiges Festhalten am aufgedeckten
und nachgewiesenen offenbar Falschen, ja, Absurden, zwar Frist gewonnen,
aber auch ihre Schuld verhundertfacht. Denn veritatem laborare nimis saepe
extingui nunquam, hat schon Livius gesagt: der Tag der Enttäuschung wird,
er muß kommen: und dann? — Nun dann — „wollen wir uns gebärden
wie wir können“ (Egm. 3, 2).
In den deutschen Staaten, welche Akademien der Wissenschaften besitzen,
könnten die denselben vorgesetzten Minister des öffentlichen Unterrichts
ihre, ohne Zweifel vorhandene, Verehrung Goethes nicht edler und aufrichtiger
an den Tag legen, als wenn sie jenen Akademien die Aufgabe stellten, binnen
gesetzter Frist, eine gründliche und ausführliche Untersuchung und Kritik
der Goetheschen Farbenlehre, nebst Entscheidung ihres Widerstreites mit
der Newtonischen, zu liefern. Möchten doch jene hochgestellten Herren
meine Stimme vernehmen und, da sie Gerechtigkeit für unsern größten
Toten anspricht, ihr willfahren, ohne erst die zu Rate zu ziehn, welche,
durch ihr unverantwortliches Schweigen, selbst Mitschuldige sind. Dies
ist der sicherste Weg, jene unverdiente Schmach von Goethen abzunehmen.
Alsdann nämlich würde die Sache nicht mehr mit Machtsprüchen und Grimassen
abzuthun sein und auch das unverschämte Vorgeben, daß es hier nicht
auf Urteil, sondern auf Rechnerei ankäme, sich nicht mehr hören lassen
dürfen: vielmehr würden die Gildenmeister sich in die Alternative versetzt
sehn, entweder der Wahrheit die Ehre zu geben, oder sich auf das allerbedenklichste
zu kompromittieren. Daher läßt, unter dem Einfluß solcher Daumschrauben,
sich etwas von ihnen hoffen; fürchten hingegen, nicht das geringste.
Denn, wie sollten doch, bei ernstlicher und ehrlicher Prüfung, die Newtonischen
Chimären, die augenfällig gar nicht vorhandenen, sondern bloß zu Gunsten
der Tonleiter erfundenen sieben prismatischen Farben, das Rot, welches
keines ist, und das einfache Urgrün, welches auf das deutlichste, vor
unsern Augen, sich ganz naiv und unbefangen aus Blau und Gelb zusammenmischt,
zumal aber die Monstrosität der im lautern, klaren Sonnenlichte steckenden
und verhüllten, dunkeln, sogar indigofarbenen, homogenen Lichter, dazu
noch ihre verschiedene Refrangibilität, die jeder achromatische Operngucker
Lügen straft, — wie sollten, sage ich, diese Märchen, recht behalten,
gegen Goethes klare und einfache Wahrheit, gegen seine auf ein großes
Naturgesetz zurückgeführte Erklärung aller Farbenerscheinungen, für
welches die Natur überall und unter jedweden Umständen ihr unbestochenes
Zeugnis ablegt! Ebensogut könnten wir befürchten, das Einmaleins widerlegt
zu sehn.
Qui non libere veritatem pronuntiat proditor veritatis est.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Die Buddhaisten gehn, infolge ihrer tieferen, ethischen und metaphysischen
Einsichten, nicht von Kardinaltugenden, sondern von Kardinallastern aus,
als deren Gegensätze, oder Verneinungen, allererst die Kardinaltugenden
auftreten. Nach J. J. Schmidts Geschichte der Ostmongolen, S. 7, sind
die Buddhaistischen Kardinallaster: Wollust, Trägheit, Zorn und Geiz.
Wahrscheinlich aber muß statt Trägheit Hochmut stehn: so nämlich werden
sie angegeben in den Lettres èdifiantes et curieuses. èdit. de 1819,
vol. 6, p. 372; woselbst jedoch noch der Neid, oder Haß, als fünftes
hinzukommt. Für meine Berichtigung der Angabe des hochverdienten J. J.
Schmidt spricht noch die Uebereinstimmung derselben mit den Lehren der,
jedenfalls unter dem Einfluß des Brahmanismus und Buddhaismus stehenden
Sufis. Auch diese nämlich stellen dieselben Kardinallaster, und zwar
sehr treffend paarweise, auf, so daß die Wollust mit dem Geiz, und der
Zorn mit dem Hochmut verschwistert auftritt. (Siehe Tholucks Blütensammlung
aus der morgenländischen Mystik, S. 206.) Wollust, Zorn und Geiz finden
wir schon im Bhagavat Gita (XVI. 21) als Kardinallaster aufgestellt; welches
das hohe Alter der Lehre bezeugt. Ebenfalls im Prabodha - Chandrodaya,
diesem für die Vedantaphilosophie so höchst wichtigen philosophisch-allegorischen
Drama treten diese drei Kardinallaster auf, als die drei Heerführer des
Königs Leidenschaft, in seinem Krieg gegen den König Vernunft*). Als
die jenen Kardinallastern entgegengesetzten Kardinaltugenden würden sich
ergeben Keuschheit und Freigebigkeit, nebst Milde und Demut. — Vergleicht
man nun mit diesen tiefgefaßten orientalischen Grundbegriffen der Ethik
die so berühmten und viele tausendmal wiederholten Platonischen Kardinaltugenden,
Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit und Weisheit; so findet man sie
ohne einen deutlichen, leitenden Grundbegriff und daher oberflächlich
gewählt, zum Teil sogar offenbar falsch. Tugenden müssen Eigenschaften
des Willens sein: Weisheit aber gehört zunächst dem Intellekt an. Die
σωφροσυνη, welche von Cicero temperantia und im Deutschen Mäßigkeit
übersetzt wird, ist ein gar unbestimmter und vieldeutiger Ausdruck, unter
welchen sich daher freilich mancherlei bringen läßt, — wie Besonnenheit,
Nüchternheit, den Kopf oben behalten: er kommt wahrscheinlich von σωον
εχειν το φρονειν, oder wie Hierax bei Stobäos (Flor. tit.
5, § 60; vol. 1, p. 134 Gaisf.) sagt: . . . Ταυτην την
άρετην σωφροσυνην έκαλεσαν σωτηριαν ούσαν
φρονησεως. Tapferkeit ist gar keine Tugend, wiewohl bisweilen
ein Diener, oder Werkzeug, derselben: aber sie ist auch eben so bereit,
der größten Nichtswürdigkeit zu dienen: eigentlich ist sie eine Temperamentseigenschaft.
Schon Geulinx (Ethica, in praefatione) verwarf die Platonischen Kardinaltugenden
und stellte diese auf: diligentia, obedientia, justitia, humilitas, —
offenbar schlecht. Die Chinesen nennen fünf Kardinaltugenden: Mitleid,
Gerechtigkeit, Höflichkeit, Wissenschaft und Aufrichtigkeit (Journ. Asiatique,
vol. 9, p. 62). Sam. Kidd, China (London 1841, p. 197) benennt sie benevolence,
righteousness, propriety (Anständigkeit), wisdom and sincerity, und gibt
einen ausführlichen Kommentar zu jeder. — Das Christentum hat nicht
Kardinal-, sondern Theologal-Tugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung.
Der Punkt, an welchem die moralischen Tugenden und Laster des Menschen
zuerst auseinandergehn, ist jener Gegensatz der Grundgesinnung gegen andere,
welche nämlich entweder den Charakter des Neides, oder aber den des Mitleides
annimmt. Denn diese zwei einander diametral entgegengesetzten Eigenschaften
trägt jeder Mensch in sich, indem sie entspringen aus der ihm unvermeidlichen
Vergleichung seines eigenen Zustandes mit dem der andern: je nachdem nun
das Resultat dieser auf seinen individuellen Charakter wirkt, wird die
eine oder die andere Eigenschaft seine Grundgesinnung und die Quelle seines
Handelns. Der Neid nämlich baut die Mauer zwischen Du und Ich fester
auf: dem Mitleid wird sie dünn und durchsichtig; ja bisweilen reißt
es sie ganz ein, wo dann der Unterschied zwischen Ich und Nicht-Ich verschwindet.
*) Krishna - Micra, Prabodha - Chandrodaya oder die Geburt des Begriffs.
Ein theologisch-philosophisches Drama. Aus dem Sanskrit übersetzt, mit
einem Vorwort eingeführt von Rosenkranz 1842.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Die Leser meiner Ethik wissen, daß bei mir das Fundament der Moral zuletzt
auf jener Wahrheit beruht, welche im Veda und Vedanta ihren Ausdruck hat
an der stehend gewordenen mystischen Formel tat twam asi (dies bist du),
welche mit Hindeutung auf jedes Lebende, sei es Mensch oder Tier, ausgesprochen
wird und dann die Mahavakya, das große Wort, heißt.
In der That kann man die ihr gemäß geschehenden Handlungen, z. B. die
der Wohlthätigkeit, als den Anfang der Mystik betrachten. Jede, in reiner
Absicht erzeigte Wohlthat gibt kund, daß der, welcher sie ausübt, im
geraden Widerspruch mit der Erscheinungswelt, in welcher das fremde Individuum
von ihm selbst gänzlich gesondert dasteht, sich als identisch mit demselben
erkennt. Dennoch ist jede ganz uninteressierte Wohlthat eine mysteriöse
Handlung, ein Mysterium: daher eben hat man, um Rechenschaft davon zu
geben, zu allerlei Fiktionen seine Zuflucht nehmen müssen. Nachdem Kant
dem Theismus alle andern Stützen weggezogen hatte, ließ er ihm bloß
die, daß er die beste Deutung und Auslegung jener und aller ihr ähnlichen
mysteriösen Handlungen abgäbe. Er ließ ihn demnach als eine zwar theoretisch
unerweisliche, aber zum praktischen Behufe gültige Annahme bestehn. Daß
es ihm aber auch nur hiemit so ganz Ernst gewesen sei, möchte ich bezweifeln.
Denn die Moral mittelst des Theismus stützen, heißt sie auf Egoismus
zurückführen; obgleich die Engländer, wie auch bei uns die untersten
Klassen der Gesellschaft, gar nicht die Möglichkeit einer andern Begründung
absehn.
Das oben in Anregung gebrachte Wiedererkennen seines eigenen wahren Wesens
in einem fremden, sich objektiv darstellenden Individuo tritt besonders
schön und deutlich hervor in den Fällen, wo ein bereits rettungslos
dem Tode anheimfallender Mensch noch mit ängstlicher Besorgnis und thätigem
Eifer auf das Wohl und die Rettung anderer bedacht ist. Dieser Art ist
die bekannte Geschichte von einer Magd, welche, nachts auf dem Hofe von
einem tollen Hunde gebissen, sich rettungslos verloren gebend, nun den
Hund packt und in den Stall schleppt, den sie verschließt, damit kein
anderer mehr sein Opfer werde. Ebenfalls jener Vorfall in Neapel, den
Tischbein in einem seiner Aquarellbilder verewigt hat: vor der, dem Meere
schnell zuströmenden Lava fliehend trägt der Sohn den alten Vater auf
dem Rücken: aber als nur noch ein schmaler Landstrich beide zerstörende
Elemente trennt, heißt der Vater den Sohn ihn niederlegen, um sich selbst
durch Laufen zu retten; weil sonst beide verloren sind. Der Sohn gehorcht
und wirft im Scheiden noch einen Abschiedsblick auf den Vater. Dies stellt
das Bild dar. Auch ist ganz dieser Art die historische Thatsache, welche
Walter Scott mit seiner Meisterhand darstellt im Heart of Mid-Lothian,
Chap. 2, wo nämlich, von zwei zum Tode verurteilten Delinquenten, der,
welcher durch sein Ungeschick die Gefangennehmung des andern veranlaßt
hatte, diesen, in der Kirche, nach der Sterbepredigt, durch kräftige
Ueberwältigung der Wache, glücklich befreit, ohne dabei irgend einen
Versuch für sich selbst zu unternehmen. Ja, hieher zu zählen, wenngleich
es dem occidentalischen Leser anstößig sein mag, ist auch die auf einem
oft wiederholten Kupferstiche dargestellte Scene, wo der, um füsiliert
zu werden, bereits knieende Soldat seinen Hund, der zu ihm will, eifrig
mit dem Tuche zurückscheucht. — In allen Fällen dieser Art nämlich
sehn wir ein seinem unmittelbaren persönlichen Untergange mit voller
Gewißheit entgegengehendes Individuum an seine eigene Erhaltung nicht
mehr denken, um seine ganze Sorgfalt und Anstrengung auf die eines andern
zu richten. Wie könnte doch deutlicher das Bewußtsein sich aussprechen,
daß dieser Untergang nur der einer Erscheinung und also selbst Erscheinung
ist, hingegen das wahre Wesen des Untergehenden davon unberührt, in dem
andern fortbesteht, in welchem er es eben jetzt, wie seine Handlung verrät,
so deutlich erkennt. Denn, wie könnte, wenn dem nicht so wäre, sondern
wir ein in der wirklichen Vernichtung begriffenes Wesen vor uns hätten,
dieses noch, durch äußerste Anstrengung seiner letzten Kräfte, einen
so innigen Anteil am Wohl und Fortbestand eines andern beweisen? —
Es gibt in der That zwei entgegengesetzte Weisen, sich seines eigenen
Daseins bewußt zu werden: einmal, in empirischer Anschauung, wie es von
außen sich darstellt, als eines verschwindend kleinen, in einer, der
Zeit und dem Raume nach, grenzenlosen Welt; als eines unter den tausend
Millionen menschlicher Wesen, die auf diesem Erdball herumlaufen, gar
kurze Zeit, alle dreißig Jahre sich erneuernd; — dann aber, indem man
in sein eigenes Inneres sich versenkt und sich bewußt wird, alles in
allem und eigentlich das allein wirkliche Wesen zu sein, welches, zur
Zugabe, sich in den andern, ihm von außen gegebenen, nochmals, wie im
Spiegel, erblickt. Daß nun die erstere Erkenntnisweise bloß die durch
das principium individuationis vermittelte Erscheinung erfasse, die andere
aber ein unmittelbares Innewerden seiner selbst als des Dinges an sich
sei, — ist eine Lehre, in der ich, der ersteren Hälfte nach, Kanten,
in beiden aber den Veda für mich habe. Allerdings ist der einfache Einwand
gegen die letztere Erkenntnisweise, sie setze voraus, daß eines und dasselbe
Wesen an verschiedenen Orten zugleich und doch in jedem ganz sein könne.
Wenn nun gleich dieses, auf dem empirischen Standpunkt, die palpabelste
Unmöglichkeit, ja eine Absurdität ist; so bleibt es dennoch vom Dinge
an sich vollkommen wahr; weil jene Unmöglichkeit und Absurdität bloß
auf den Formen der Erscheinung, die das principium individuationis ausmachen,
beruht. Denn das Ding an sich, der Wille zum Leben, ist in jedem Wesen,
auch dem geringsten, ganz und ungeteilt vorhanden, so vollständig, wie
in allen, die je waren, sind und sein werden, zusammen genommen. Hierauf
eben beruht es, daß jedes Wesen, selbst das geringste, zu sich sagt:
dum ego salvus sim, pereat mundus. Und in Wahrheit würde, wenn auch alle
andern Wesen untergingen, in diesem einen, übrig gebliebenen, doch noch
das ganze Wesen an sich der Welt ungekränkt und unvermindert dastehn
und jenes Untergangs als eines Gaukelspieles lachen. Dies ist freilich
ein Schluß per impossibile, welchem man, als ebenso berechtigt, diesen
gegenüberstellen kann, daß wenn irgend ein Wesen, auch nur das geringste,
gänzlich vernichtet wäre, in und mit ihm die ganze Welt untergegangen
sein würde. In diesem Sinne eben sagt der Mystiker Angelus Silesius:
„Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben:
Werd' ich zunicht; er muß von Not den Geist aufgeben.“
Um aber diese Wahrheit, oder wenigstens die Möglichkeit, daß unser eigenes
Selbst in andern Wesen existieren könne, deren Bewußtsein ein von dem
unsrigen getrenntes und verschiedenes ist, auch vom empirischen Standpunkt
aus einigermaßen absehn zu können, dürfen wir nur uns der magnetisierten
Somnambulen erinnern, deren identisches Ich, nachdem sie erwacht sind,
nichts von allen dem weiß, was sie den Augenblick vorher selbst gesagt,
gethan und erlitten haben. Ein so ganz phänomeneller Punkt ist also das
individuelle Bewußtsein, daß sogar in demselben Ich deren zwei entstehen
können, davon das eine nicht vom andern weiß.
Immer jedoch behalten Betrachtungen, wie die vorhergehenden, hier, in
unserm judaisierten Occident, etwas sehr Fremdartiges: aber nicht so im
Vaterlande des Menschengeschlechts, in jenem Lande, wo ein ganz anderer
Glaube herrscht, ein Glaube, welchem gemäß, auch noch heute, z. B. nach
der Totenbestattung, die Priester, vor allem Volke und mit Begleitung
der Instrumente, den Vedahymnus anstimmen, der also beginnt:
„Der verkörperte Geist, welcher tausend Häupter, tausend Augen, tausend
Füße hat, wurzelt in der Menschenbrust und durchdringt zugleich die
ganze Erde. Dieses Wesen ist die Welt und alles, was je war und sein wird.
Es ist das, was durch die Nahrung wächst, und das, was Unsterblichkeit
verleihet. Dieses ist seine Größe: und darum ist es der allerherrlichste
verkörperte Geist. Die Bestandteile dieser Welt machen einen Teil seines
Wesens aus, und drei Teile sind Unsterblichkeit im Himmel. Diese drei
Teile haben sich aus der Welt emporgehoben; aber der eine Teil ist zurückgeblieben
und ist das, was (durch die Seelenwanderung) die Früchte guter und böser
Thaten genießt und nicht genießt“ u. s. w. (nach Colebrooke, On the
religious ceremonies of the Hindus, im 5. Bande der Asiatic researches
S. 345 der Kalkuttaer Ausg., auch in dessen Miscellaneous essays, Vol.
1, p. 167.
Wenn man nun dergleichen Gesänge mit unsern Gesangbüchern vergleicht,
wird man sich nicht mehr wundern, daß die anglikanischen Missionarien
am Ganges so erbärmlich schlechte Geschäfte machen und mit ihren Vorträgen
über ihren „maker“ *) bei den Brahmanen keinen Eingang finden. Wer
aber das Vergnügen genießen will, zu sehn, wie den absurden und unverschämten
Prätensionen jener Herren, schon vor 41 Jahren, ein englischer Offizier
kühn und nachdrücklich entgegengetreten ist, der lese die Vindication
of the Hindoos from the aspersions of the reverend Claudius Buchanan,
with a refutation of his arguments in favour of an ecclesiastical establishment
in British India: the whole tending to evince the excellence of the moral
system of the Hindoos; by a Bengal officer. Lond. 1808. Der Verfasser
setzt darin, mit seltener Freimütigkeit, die Vorzüge der hindostanischen
Glaubenslehren vor den europäischen auseinander. Die kleine Schrift,
welche deutsch etwan fünf Bogen füllen würde, verdiente noch jetzt
übersetzt zu werden; da sie besser und aufrichtiger, als irgend eine
mir bekannte, den so wohlthätigen praktischen Einfluß des Brahmanismus,
sein Wirken im Leben und im Volke, darlegt, — ganz anders, als die aus
geistlichen Federn geflossenen Berichte, die, eben als solche, wenig Glauben
verdienen; hingegen übereinstimmend mit dem, was ich mündlich von englischen
Offizieren, die ihr halbes Leben in Indien zugebracht hatten, vernommen
habe. Denn um zu wissen, wie neidisch und ergrimmt die stets um ihre Pfründen
zitternde anglikanische Kirche auf den Brahmanismus ist, muß man z. B.
das laute Gebelle kennen, welches vor einigen Jahren die Bischöfe im
Parlament erhoben, monatelang fortsetzten und, da die ostindischen Behörden,
wie immer bei solchen Gelegenheiten, sich überaus zähe bezeigten, stets
wieder aufs neue anstimmten, bloß über einige äußere Ehrenbezeigungen,
welche, wie billig, in Indien, von englischen Behörden, der uralten,
ehrwürdigen Landesreligion erzeigt wurden, z. B. daß, wann die Prozession
mit den Götterbildern vorüberzieht, die Wache mit dem Offizier hübsch
heraustritt und trommelt; ferner über die Lieferung roten Tuches, den
Wagen von Jagernauth zu bedecken, u. dgl. m. Letztere ist wirklich jenen
Herren zu Gefallen, nebst dem dabei erhobenen Pilgerzoll, eingestellt
worden. Inzwischen läßt das unablässige Geifern jener sich selbst sehr-ehrwürdig
nennenden Pfründen- und Allongenperückenträger über solche Dinge,
nebst der noch ganz mittelalterlichen, heutzutage aber roh und pöbelhaft
zu nennenden Weise, in der sie sich über die Urreligion unsers Geschlechtes
ausdrücken, imgleichen auch das schwere Aergernis, welches sie daran
nahmen, daß Lord Ellenborough 1845 die Pforte der, im Jahre 1022 von
jenem fluchwürdigen Mahmud dem Ghaznewiden zerstörten Pagode von Sumenaut
im Triumphzuge nach Bengalen zurückbrachte und den Brahmanen übergab,
— dies alles, sage ich, läßt vermuten, daß ihnen nicht unbekannt
ist, wie sehr die meisten der Europäer, welche lange in Indien leben,
in ihrem Herzen dem Brahmanismus zugethan werden und über die religiösen,
wie die sozialen Vorurteile Europas nur noch die Achsel zucken. „Das
fällt alles ab, wie Schuppen, sobald man nur zwei Jahre in Indien gelebt
hat,“ — sagte zu mir einmal ein solcher. Sogar ein Franzose, jener
sehr gefällige und gebildete Herr, der, vor etwan zehn Jahren, die Dewadassi
(vulgo Bajaderen) in Europa begleitete, rief, als ich mit ihm auf die
Religion jenes Landes zu sprechen kam, sogleich mit feuriger Begeisterung
aus: Monsieur, c`est la vraie religion! — Höchst drollig hingegen ist,
nebenbei gesagt, die gelassen lächelnde Suffisance, mit welcher einige
servile deutsche Philosophaster, wie auch manche Buchstaben-Orientalisten,
von der Höhe ihres rationalistischen Judentums auf Brahmanismus und Buddhaismus
herabsehn. Solchen Herrlein möchte ich wahrlich ein Engagement bei der
Affenkomödie auf der Frankfurter Messe vorschlagen; wenn anders die Nachkommen
des Hanuman sie unter sich dulden wollen. —
Ich denke, daß, wenn der Kaiser von China oder der König von Siam und
andere asiatische Monarchen europäischen Mächten die Erlaubnis, Missionäre
in ihre Länder zu senden, erteilen, sie ganz und gar befugt wären, es
nur unter der Bedingung zu thun, daß sie ebenso viele buddhaistische
Priester, mit gleichen Rechten, in das betreffende europäische Land schicken
dürfen; wozu sie natürlich solche wählen würden, die in der jedesmaligen
europäischen Sprache vorher wohlunterrichtet sind. Da würden wir einen
interessanten Wettstreit vor Augen haben und sehn, wer am meisten ausrichtet.
Sogar die so phantastische, ja, mitunter barocke indische Götterlehre,
wie sie noch heute, so gut wie vor Jahrtausenden, die Religion des Volkes
ausmacht, ist, wenn man den Sachen auf den Grund geht, doch nur die verbildlichte,
d. h. mit Rücksicht auf die Fassungskraft des Volkes in Bilder eingekleidete
und so personifizierte und mythisierte Lehre der Upanischaden, welche
nun aus ihr jeder Hindu, nach Maßgabe seiner Kräfte und Bildung herausspürt,
oder fühlt, oder ahndet, oder sie durchschauend klar dahinter erblickt,
— während der rohe und bornierte englische Reverend, in seiner Monomanie,
sie verhöhnt und lästert, — als Idolatry: er allein, meint er, wäre
vor die rechte Schmiede gekommen. Hingegen war die Absicht des Buddha
Schakya Muni, den Kern aus der Schale abzulösen, die hohe Lehre selbst
von allem Bilder- und Götterwesen zu befreien und ihren reinen Gehalt
sogar dem Volke zugänglich und faßlich zu machen. Dies ist ihm wundervoll
gelungen, und daher ist seine Religion die vortrefflichste und durch die
größte Anzahl von Gläubigen vertretene auf Erden. Er kann mit Sophokles
sagen:
— ϑεοις μεν κ̕ αν ό μηδεν ών όμου
κρατος κατακτησαιτ̕ · έγω δε και διχα
κεινων πεποιϑα τουτ̕ έπισπασειν κλεος.
Ajax, 767—69.
Der christliche Fanatismus, welcher die ganze Welt zu seinem Glauben bekehren
will, ist unverantwortlich. — Sir James Brooke (Rajah of Borneo), welcher
einen Teil Borneos kolonisiert hat und einstweilen beherrscht, hat im
September 1858 zu Liverpool vor einer Versammlung des Vereins für die
Verbreitung des Evangeliums, also des Centrums der Missionen, eine Rede
gehalten, darin er sagt: „Bei den Mohammedanern habt ihr keine Fortschritte
gemacht, bei den Hindus habt ihr ganz und gar keine Fortschritte gemacht;
sondern seid gerade noch auf dem Punkt, wo ihr waret am ersten Tage, da
ihr Indien betreten habt.“ (Times, 29. Sept. 1858.) — Hingegen haben
die christlichen Glaubensboten sich in anderer Hinsicht sehr nützlich
und preiswürdig erwiesen, indem einige von ihnen uns vortreffliche und
gründliche Berichte über den Brahmanismus und Buddhaismus und treue,
sorgfältige Uebersetzungen heiliger Bücher geliefert haben, wie solche
ohne das con amore nicht möglich gewesen wären. Diesen Edeln widme ich
folgende Reime:
Als Lehrer geht ihr hin:
Als Schüler kommt ihr wieder.
Von dem umschlei’rten Sinn
Fiel dort die Decke nieder.
Wir dürfen daher hoffen, daß einst auch Europa von aller jüdischen
Mythologie gereinigt sein wird. Das Jahrhundert ist vielleicht herangerückt,
in welchem die aus Asien stammenden Völker japhetischen Sprachstammes
auch die heiligen Religionen der Heimat wieder erhalten werden: denn sie
sind, nach langer Verirrung, für dieselben wieder reif geworden.
*) Maker ist das deutsche „Macher“ und auch, wie dieses, in compositis
häufig, z. B. watchmaker, shoemaker, — Uhrmacher, Schuhmacher u. a.
m. Our maker „unser Macher“ (französisch wäre es „notre faiseur“
wiederzugeben) ist nun in englischen Schriften, Predigten und dem gemeinen
Leben ein sehr gewöhnlicher und beliebter Ausdruck für „Gott“; welches
ich, als für die englische Religionsauffassung höchst charakteristisch,
zu bemerken bitte. Wie jedoch dem, in der Lehre des heiligen Veda erzogenen
Brahmanen und dem ihm nacheifernden Vaisia, ja, wie dem gesamten, vom
Glauben an die Metempsychose und die Vergeltung durch sie durchdrungenen
und bei jedem Vorgange im Leben ihrer eingedenken indischen Volke zu Mute
werden muß, wenn man ihm solche Begriffe aufdringen will, wird der unterrichtete
Leser leicht ermessen. Von dem ewigen Brahm, welches in allen und in jedem
da ist, leidet, lebt und Erlösung hofft, überzugehen zu jenem maker
aus nichts ist für die Leute eine schwere Zumutung. Ihnen wird nie beizubringen
sein, daß die Welt und der Mensch ein Machwerk aus nichts sei. Mit großem
Rechte sagt daher der edele Verfasser des im Texte sogleich zu lobenden
Buches, S. 15 desselben: „Die Bemühungen der Missionarien werden fruchtlos
bleiben: kein irgend achtungswürdiger Hindu wird jemals ihren Vermahnungen
nachgeben.“ Desgleichen S. 50, nach Darlegung der brahmanischen Grundlehren:
„Zu hoffen, daß sie, durchdrungen von diesen Ansichten, in denen sie
leben, weben und sind, jemals sie aufgeben werden, um die christliche
Lehre anzunehmen, ist, meiner festen Ueberzeugung nach, eine eitele Erwartung.“
Auch S. 68: „Und wenn, zu solchem Zweck, die ganze Synode der englischen
Kirche Hand anlegte, würde es ihr, es wäre denn durch absoluten Zwang,
wahrlich nicht gelingen, auch nur einen Menschen aus tausend in der großen
indischen Bevölkerung zu bekehren.“ Wie richtig seine Vorhersagung
gewesen, bezeugt noch jetzt, 41 Jahre später, ein langer Brief in den
Times vom 6. November 1849, unterzeichnet Civis, der, wie aus demselben
erhellt, von einem Manne herrührt, der lange in Indien gelebt hat. Darin
heißt es unter anderm: „Nie ist mir auch nur ein einziges Beispiel
bekannt geworden, daß in Indien ein Mensch, dessen wir uns rühmen dürften,
zum Christentum bekehrt worden wäre; nicht einen Fall wüßte ich, wo
es nicht einer gewesen wäre, der dem Glauben, den er annahm, zum Vorwurf,
und dem, den er abschwur, zur Warnung gereichte. Die Proselyten, welche
man bis jetzt gemacht, so wenige ihrer sind, haben daher bloß gedient,
andere von der Nachfolge ihres Beispiels abzuschrecken.“ Nachdem auf
diesen Brief Widerspruch erfolgt war, erscheint zur Bekräftigung desselben,
in den Times vom 20. November, ein zweiter, Sepahee unterschrieben, darin
es heißt: „Ich habe über zwölf Jahre in der Präsidentur Madras gedient
und während dieser langen Zeit nie ein einziges Individuum gesehen, welches
sich auch nur nominell, vom Hinduismus, oder vom Islam, zur protestantischen
Religion bekehrt hätte. So weit also stimme ich ganz mit Civis überein
und glaube, daß fast alle Offiziere der Armee ein ähnliches Zeugnis
ablegen werden.“ — Auch auf diesen Brief ist starker Widerspruch erfolgt:
allein ich glaube, daß solcher, wenn auch nicht von Missionarien, doch
von Cousins der Missionarien herrührt: wenigstens sind es sehr gottselige
Gegner. Mag also auch nicht alles, was sie anführen, ohne Grund sein;
so messe ich denn doch den oben extrahierten, unbefangenen Gewährsmännern
mehr Glauben bei. Denn bei mir findet, in England, der rote Rock mehr
Glauben, als der schwarze, und alles, was daselbst zu Gunsten der Kirche,
dieser so reichen und bequemen Versorgungsanstalt der mittellosen jüngern
Söhne der gesamten Aristokratie, gesagt wird, ist mir eo ipso verdächtig.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Können wir nun, durch Betrachtungen, wie die obigen, also von einem sehr
hohen Standpunkt aus, eine Rechtfertigung der Leiden der Menschheit absehn;
so erstreckt jedoch diese sich nicht auf die Tiere, deren Leiden, zwar
großenteils durch den Menschen herbeigeführt, oft aber auch ohne dessen
Zuthun, bedeutend sind *). Da drängt sich also die Frage auf: wozu dieser
gequälte, geängstigte Wille in so tausendfachen Gestalten, ohne die
durch Besonnenheit bedingte Freiheit zur Erlösung? — Das Leiden der
Tierwelt ist bloß daraus zu rechtfertigen, daß der Wille zum Leben,
weil außer ihm, in der Erscheinungswelt, gar nichts vorhanden und er
ein hungriger Wille ist, an seinem eigenen Fleische zehren muß. Daher
die Stufenfolge seiner Erscheinungen, deren jede auf Kosten einer andern
lebt. Ferner verweise ich auf § 153 und 154 zurück, als welche darthun,
daß die Fähigkeit zum Leiden im Tiere sehr viel geringer ist, als im
Menschen. Was nun aber darüber hinaus sich noch beibringen ließe, würde
hypothetisch, ja sogar mythisch ausfallen, mag also der eigenen Spekulation
des Lesers überlassen bleiben.
*) Vergl. Ergänzungen zur „Welt als Wille und Vorstellung“ (Bd. 5,
S.192 f. dieser Gesamtausgabe).
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Immer von neuem fühlt sich wer unter Menschen lebt zu der Annahme versucht,
daß moralische Schlechtigkeit und intellektuelle Unfähigkeit eng zusammenhängen,
indem sie direkt einer Wurzel entsprössen. Daß dem jedoch nicht so sei,
habe ich in den Ergänzungen zur „Welt als Wille und Vorstellung“
Kap. 19, Nr. 8 (Bd. 5 S. l7 ff. dieser Gesamtausgabe) ausführlich dargethan.
Jener Anschein, der bloß daraus entspringt, daß man beide so gar oft
beisammen findet, ist gänzlich aus dem sehr häufigen Vorkommen beider
zu erklären, infolgedessen ihnen leicht begegnet, unter einem Dache wohnen
zu müssen. Dabei ist aber nicht zu leugnen, daß sie einander, zu gegenseitigem
Vorteil, in die Hände spielen, wodurch denn die so unerfreuliche Erscheinung
zu stande kommt, welche nur zu viele Menschen darbieten, und die Welt
geht, wie sie geht. Namentlich ist der Unverstand dem deutlichen Sichtbarwerden
der Falschheit, Niederträchtigkeit und Bosheit günstig; während die
Klugheit diese besser zu verhüllen versteht. Und wie oft verhindert andrerseits
die Perversität des Herzens den Menschen, Wahrheiten einzusehn, denen
sein Verstand ganz wohl gewachsen wäre.
Jedoch, es überhebe sich keiner. Wie jeder, auch das größte Genie,
in irgend einer Sphäre der Erkenntnis entschieden borniert ist und dadurch
seine Stammverwandtschaft mit dem wesentlich verkehrten und absurden Menschengeschlechte
beurkundet; so trägt auch jeder moralisch etwas durchaus Schlechtes in
sich, und selbst der beste, ja edelste Charakter wird uns bisweilen durch
einzelne Züge von Schlechtigkeit überraschen; gleichsam um seine Verwandtschaft
mit dem Menschengeschlechte, unter welchem jeder Grad von Nichtswürdigkeit,
ja Grausamkeit, vorkommt, anzuerkennen. Denn gerade kraft dieses Schlechten
in ihm, dieses bösen Prinzips, hat er ein Mensch werden müssen. Und
aus demselben Grunde ist die Welt überhaupt das, als was mein treuer
Spiegel derselben sie gezeigt hat.
Bei dem allen jedoch bleibt, auch zwischen Menschen, der Unterschied unabsehbar
groß, und mancher würde erschrecken, wenn er den andern sähe, wie er
ist. — O, um einem Asmodäus der Moralität, welcher seinem Günstlinge
nicht bloß Dächer und Mauern, sondern den über alles ausgebreiteten
Schleier der Verstellung, Falschheit, Heuchelei, Grimasse, Lüge und Trug
durchsichtig machte, und ihn sehn ließe, wie wenig wahre Redlichkeit
in der Welt zu finden ist, und wie so oft, auch wo man es am wenigsten
vermutet, hinter allen den tugendsamen Außenwerken, heimlich und im innersten
Receß, die Unrechtlichkeit am Ruder sitzt. — Daher eben kommen die
vierbeinigen Freundschaften so vieler Menschen besserer Art: denn freilich,
woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke
der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches
Gesicht man ohne Mißtrauen schauen kann? — Ist doch unsere zivilisierte
Welt nur eine große Maskerade. Man trifft daselbst Ritter, Pfaffen, Soldaten,
Doktoren, Advokaten, Priester, Philosophen, und was nicht alles an! Aber
sie sind nicht was sie vorstellen: sie sind bloße Masken, unter welchen,
in der Regel, Geldspekulanten (moneymakers) stecken. Doch nimmt auch wohl
einer die Maske des Rechts, die er sich dazu beim Advokaten geborgt hat,
vor, bloß um auf einen andern tüchtig losschlagen zu können: wieder
einer hat, zum selben Zwecke, die des öffentlichen Wohls und des Patriotismus
gewählt; ein dritter die der Religion, der Glaubensreinigkeit. Zu allerlei
Zwecken hat schon mancher die Maske der Philosophie, wohl auch der Philanthropie
u. dgl. m. vorgesteckt. Die Weiber haben weniger Auswahl: meistens bedienen
sie sich der Maske der Sittsamkeit, der Schamhaftigkeit, Häuslichkeit
und Bescheidenheit. Sodann gibt es auch allgemeine Masken, ohne besondern
Charakter, gleichsam die Dominos, die man daher überall antrifft: dahin
gehören die strenge Rechtlichkeit, die Höflichkeit, die aufrichtige
Teilnahme und grinsende Freundlichkeit. Meistens stecken, wie gesagt,
lauter Industrielle, Handelsleute und Spekulanten unter diesen sämtlichen
Masken. In dieser Hinsicht machen den einzigen ehrlichen Stand die Kaufleute
aus; da sie allein sich für das geben, was sie sind: sie gehn also unmaskiert
herum; stehn daher auch niedrig im Rang. — Es ist sehr wichtig, schon
früh, in der Jugend darüber belehrt zu werden, daß man sich auf der
Maskerade befinde. Denn sonst wird man manche Dinge gar nicht begreifen
und aufkriegen können, sondern davor stehn ganz verdutzt, und zwar am
längsten der, cui ex meliori luto dedit praecordia Titan: derart sind
die Gunst, welche die Niederträchtigkeit findet, die Vernachlässigung,
welche das Verdienst, selbst das seltenste und größte, von den Leuten
seines Faches erleidet, das Verhaßtsein der Wahrheit und der großen
Fähigkeiten, die Unwissenheit der Gelehrten in ihrem Fach, und daß fast
immer die echte Ware verschmäht, die bloß scheinbare gesucht wird. Also
werde schon der Jüngling belehrt, daß auf dieser Maskerade die Aepfel
von Wachs, die Blumen von Seide, die Fische von Pappe sind, und alles,
alles Tand und Spaß; und daß von jenen zweien, die er dort so ernstlich
miteinander handeln sieht, der eine lauter falsche Ware gibt und der andre
sie mit Rechenpfennigen bezahlt.
Aber ernstere Betrachtungen sind anzustellen und schlimmere Dinge zu berichten.
Der Mensch ist im Grunde ein wildes, entsetzliches Tier. Wir kennen es
bloß im Zustande der Bändigung und Zähmung, welcher Zivilisation heißt:
daher erschrecken uns die gelegentlichen Ausbrüche seiner Natur. Aber
wo und wann einmal Schloß und Kette der gesetzlichen Ordnung abfallen
und Anarchie eintritt, da zeigt sich was er ist. — Wer inzwischen auch
ohne solche Gelegenheit sich darüber aufklären möchte, der kann die
Ueberzeugung, daß der Mensch an Grausamkeit und Unerbittlichkeit keinem
Tiger und keiner Hyäne nachsteht, aus hundert alten und neuen Berichten
schöpfen. Ein vollwichtiges Beispiel aus der Gegenwart liefert ihm die
Antwort, welche die Britische Antisklavereigesellschaft, auf ihre Frage
nach der Behandlung der Sklaven in den sklavenhaltenden Staaten der Nordamerikanischen
Union, von der Nordamerikanischen Antisklavereigesellschaft im Jahre 1840
erhalten hat: Slavery and the internal Slavetrade in the United States
of North-America: being replies to questions transmitted by the British
Antislavery-society to the American Antislavery society. Lond. 1841. 280
S. gr. 8°. price 4 sh. in cloth. Dieses Buch macht eine der schwersten
Anklageakten gegen die Menschheit aus. Keiner wird es ohne Entsetzen,
wenige ohne Thränen aus der Hand legen. Denn was der Leser desselben
jemals vom unglücklichen Zustande der Sklaven, ja, von menschlicher Härte
und Grausamkeit überhaupt, gehört, oder sich gedacht, oder geträumt
haben mag, wird ihm geringfügig erscheinen, wenn er liest, wie jene Teufel
in Menschengestalt, jene bigotten, kirchengehenden, streng den Sabbath
beobachtenden Schurken, namentlich auch die anglikanischen Pfaffen unter
ihnen, ihre unschuldigen schwarzen Brüder behandeln, welche durch Unrecht
und Gewalt in ihre Teufelsklauen geraten sind. Dies Buch, welches aus
trockenen, aber authentischen und dokumentierten Berichten besteht, empört
alles Menschengefühl in dem Grade, daß man, mit demselben in der Hand,
einen Kreuzzug predigen könnte, zur Unterjochung und Züchtigung der
sklavenhaltenden Staaten Nordamerikas. Denn sie sind ein Schandfleck der
ganzen Menschheit. Ein anderes Beispiel aus der Gegenwart, da die Vergangenheit
manchem nicht mehr gültig scheint, enthalten „Tschudi’s Reisen in
Peru“ 1846, an der Beschreibung der Behandlung der peruvianischen Soldaten
durch ihre Offiziere *). — Aber wir brauchen die Beispiele nicht in
der Neuen Welt, dieser Kehrseite des Planeten, zu suchen. Ist es doch
im Jahre 1848 zu Tage gekommen, daß in England, nicht ein-, sondern,
in kurzem Zeitraume, wohl hundertmal, ein Ehegatte den andern, oder beide
in Gemeinschaft ihre Kinder, eines nach dem andern, vergiftet, oder auch
sie durch Hunger und schlechte Pflege langsam zu Tode gemartert haben,
bloß um von den Begräbnisvereinen (burial-clubs) die auf den Todesfall
ihnen zugesicherten Begräbniskosten zu empfangen; zu welchem Zwecke sie
ein Kind in mehrere, sogar bis in zwanzig solcher Vereine zugleich eingekauft
haben. Man sehe hierüber die Times vom 20., 22. und 23. September 1848,
welche Zeitung, bloß deswegen, auf Aufhebung der Begräbnisvereine dringt.
Dieselbe Anklage wiederholt sie auf das heftigste am 12. Dezember 1853.
Freilich gehören Berichte dieser Art zu den schwärzesten Blättern in
den Kriminalakten des Menschengeschlechts. Aber die Quelle von dem und
allem Aehnlichen ist doch das innere und angeborene Wesen des Menschen,
dieses Gottes κατ̓ εξοχην der Pantheisten. Da nistet in jedem
zunächst ein kolossaler Egoismus, der die Schranke des Rechts mit größter
Leichtigkeit überspringt; wie dies das tägliche Leben im kleinen und
die Geschichte, auf jeder Seite, im großen lehrt. Liegt denn nicht schon
in der anerkannten Notwendigkeit des so ängstlich bewachten europäischen
Gleichgewichts das Bekenntnis, daß der Mensch ein Raubtier ist, welches,
sobald es einen Schwächeren neben sich erspäht hat, unfehlbar über
ihn herfällt? und erhalten wir nicht täglich die Bestätigung desselben
im kleinen? — Zum grenzenlosen Egoismus unserer Natur gesellt sich aber
noch ein, mehr oder weniger in jeder Menschenbrust vorhandener Vorrat
von Haß, Zorn, Neid, Geifer und Bosheit, angesammelt, wie das Gift in
der Blase des Schlangenzahns, und nur auf Gelegenheit wartend, sich Luft
zu machen, und dann wie ein entfesselter Dämon zu toben und zu wüten.
Will kein großer Anlaß dazu sich einfinden; so wird er am Ende den kleinsten
benutzen, indem er ihn durch seine Phantasie vergrößert,
Quantulacunque adeo est occasio, sufficit irae.
J u v. Sat. XIII. v. 183.
und wird dann es so weit treiben, wie er irgend kann und darf. Dies sehn
wir im täglichen Leben, woselbst solche Eruptionen unter dem Namen „seine
Galle über etwas ausschütten“ bekannt sind. Auch will man wirklich
bemerkt haben, daß, wenn sie nur auf keinen Widerstand gestoßen sind,
das Subjekt sich entschieden wohler danach befindet. Daß der Zorn nicht
ohne Genuß sei, sagt schon Aristoteles: το οργιζεσϑαι ήδυ
(Rhet. I, 11. II, 2.), wozu er noch eine Stelle aus dem Homer anführt,
der den Zorn für süßer, als Honig, erklärt. Aber nicht nur dem Zorn,
sondern auch dem Haß, der sich zu ihm wie die chronische zur akuten Krankheit
verhält, gibt man sich so recht con amore hin:
Now hatred is by far the longest pleasure:
Men love in haste, but they detest at leisure.
Byr. D. Juan. C. 13, 6.
(Der Haß gewährt gewiß den süßern Trank:
Wir lieben flüchtig, aber hassen lang.)
Gobineau (Des races humaines) hat den Menschen l’animal mèchant par
excellence genannt, welches die Leute übelnehmen, weil sie sich getroffen
fühlen: er hat aber recht: denn der Mensch ist das einzige Tier, welches
andern Schmerz verursacht, ohne weitern Zweck, als eben diesen. Die andern
Tiere thun es nie anders, als um ihren Hunger zu befriedigen, oder im
Zorn des Kampfes. Wenn dem Tiger nachgesagt wird, er töte mehr, als er
auffresse: so würgt er alles doch nur in der Absicht, es zu fressen,
und es liegt bloß daran, daß, wie die französische Redensart es ausdrückt,
ses yeux sont plus grands que son estomac. Kein Tier jemals quält, bloß
um zu quälen; aber dies thut der Mensch, und dies macht den teuflischen
Charakter aus, der weit ärger ist, als der bloß tierische. Von der Sache
im großen ist schon geredet: aber auch im kleinen wird sie deutlich;
wo denn jeder sie zu beobachten täglich Gelegenheit hat. Z. B. wenn zwei
junge Hunde miteinander spielen, so friedlich und lieblich anzusehn, —
und ein Kind von drei bis vier Jahren kommt dazu; so wird es sogleich
mit seiner Peitsche oder Stock, heftig darein schlagen, fast unausbleiblich,
und dadurch zeigen, daß es schon jetzt l’animal mèchant par excellence
ist. Sogar auch die so häufige zwecklose Neckerei und der Schabernack
entspringt aus dieser Quelle. Z. B. hat man etwan über eine Störung
oder sonstige kleine Unannehmlichkeit sein Mißbehagen geäußert; so
wird es nicht an Leuten fehlen, die sie gerade deshalb zuwege bringen:
animal mèchant par excellence! Dies ist so gewiß, daß man sich hüten
soll, sein Mißfallen an kleinen Uebelständen zu äußern; sogar auch
umgekehrt sein Wohlgefallen an irgend einer Kleinigkeit. Denn im letztern
Falle werden sie es machen wie jener Gefängniswärter, der, als er entdeckte,
daß sein Gefangener das mühsame Kunststück vollbracht hatte, eine Spinne
zahm zu machen, und an ihr seine Freude hatte, sie sogleich zertrat: l’animal
mèchant par excellence! Darum fürchten alle Tiere instinktmäßig den
Anblick, ja die Spur des Menschen, — des animal mèchant par excellence.
Der Instinkt trügt hier nicht: denn allein der Mensch macht Jagd auf
das Wild, welches ihm weder nützt, noch schadet.
Wirklich aber liegt im Herzen eines jeden ein wildes Tier, das nur auf
Gelegenheit wartet, um zu toben und zu rasen, indem es andern wehe thun
und, wenn sie gar ihm den Weg versperren, sie vernichten möchte: es ist
eben das, woraus alle Kampf- und Kriegslust entspringt; und eben das,
welches zu bändigen und einigermaßen in Schranken zu halten die Erkenntnis,
sein beigegebener Wächter, stets vollauf zu thun hat. Immerhin mag man
es das radikale Böse nennen, als womit wenigstens denen, welchen ein
Wort die Stelle einer Erklärung vertritt, gedient sein wird. Ich aber
sage: es ist der Wille zum Leben, der durch das stete Leiden des Daseins
mehr und mehr erbittert, seine eigene Qual durch das Verursachen der fremden
zu erleichtern sucht. Aber auf diesem Wege entwickelt er sich allmählich
zur eigentlichen Bosheit und Grausamkeit. Auch kann man hiezu die Bemerkung
machen, daß wie, nach Kant, die Materie nur durch den Antagonismus der
Expansions- und Kontraktionskraft besteht; so die menschliche Gesellschaft
nur durch den des Hasses, oder Zorns, und der Furcht. Denn die Gehässigkeit
unsrer Natur würde vielleicht jeden einmal zum Mörder machen, wenn ihr
nicht eine gehörige Dosis Furcht beigegeben wäre, um sie in Schranken
zu halten; und wiederum diese allein würde ihn zum Spott und Spiel jedes
Buben machen, wenn nicht in ihm der Zorn bereit läge und Wache hielte.
Der schlechteste Zug in der menschlichen Natur bleibt aber die Schadenfreude,
da sie der Grausamkeit enge verwandt ist, ja eigentlich von dieser sich
nur wie Theorie von Praxis unterscheidet, überhaupt aber da eintritt,
wo das Mitleid seine Stelle finden sollte, welches, als ihr Gegenteil,
die wahre Quelle aller echten Gerechtigkeit und Menschenliebe ist. In
einem andern Sinne dem Mitleid entgegengesetzt ist der Neid; sofern er
nämlich durch den entgegengesetzten Anlaß hervorgerufen wird: sein Gegensatz
zum Mitleid beruht also zunächst auf dem Anlaß, und erst infolge hievon
zeigt er sich auch in der Empfindung selbst. Daher eben ist der Neid,
wenngleich verwerflich, doch noch einer Entschuldigung fähig und überhaupt
menschlich; während die Schadenfreude teuflisch und ihr Hohn das Gelächter
der Hölle ist. Sie tritt, wie gesagt, gerade da ein, wo Mitleid eintreten
sollte: der Neid hingegen doch nur da, wo kein Anlaß zu diesem, vielmehr
zum Gegenteil desselben vorhanden ist; und eben als dieses Gegenteil entsteht
er in der menschlichen Brust, mithin so weit noch als eine menschliche
Gesinnung: ja, ich befürchte, daß keiner ganz frei davon befunden werden
wird. Denn daß der Mensch, beim Anblick fremden Genusses und Besitzes,
den eigenen Mangel bitterer fühle, ist natürlich, ja, unvermeidlich:
nur sollte dies nicht seinen Haß gegen den Beglückteren erregen: gerade
hierin aber besteht der eigentliche Neid. Am wenigsten aber sollte dieser
eintreten, wo nicht die Gaben des Glückes, oder Zufalls, oder fremder
Gunst, sondern die der Natur der Anlaß sind; weil alles Angeborene auf
einem metaphysischen Grunde beruht, also eine Berechtigung höherer Art
hat und, sozusagen, von Gottes Gnaden ist. Aber leider hält der Neid
es gerade umgekehrt; er ist bei persönlichen Vorzügen am unversöhnlichsten;
daher eben Verstand, und gar Genie, sich auf der Welt erst Verzeihung
erbetteln müssen, wo immer sie nicht in der Lage sind, die Welt stolz
und kühn verachten zu dürfen. Wenn nämlich der Neid bloß durch Reichtum,
Rang oder Macht erregt worden ist, wird er noch oft durch den Egoismus
gedämpft; indem dieser absieht, daß von dem Beneideten, vorkommenden
Falls, Hilfe, Genuß, Beistand, Schutz, Beförderung u. s. w. zu hoffen
steht, oder daß man wenigstens im Umgange mit ihm, von dem Abglanze seiner
Vornehmigkeit beleuchtet, selbst Ehre genießen kann: auch bleibt hier
die Hoffnung übrig, alle jene Güter einst noch selbst zu erlangen. Hingegen
für den auf Naturgaben und persönliche Vorzüge, dergleichen bei Weibern
die Schönheit, bei Männern der Geist ist, gerichteten Neid gibt es keinen
Trost der einen und keine Hoffnung der andern Art; so daß ihm nichts
übrig bleibt, als die so Bevorzugten bitter und unversöhnlich zu hassen.
Daher ist sein einziger Wunsch, Rache an seinem Gegenstand zu nehmen.
Hiebei nun aber befindet er sich in der unglücklichen Lage, daß alle
seine Schläge machtlos fallen, sobald an den Tag kommt, daß sie von
ihm ausgegangen sind. Daher also versteckt er sich so sorgsam, wie die
geheimen Wollustsünden, und wird nun ein unerschöpflicher Erfinder von
Listen, Schlichen und Kniffen, sich zu verhüllen und zu maskieren, um
ungesehn seinen Gegenstand zu verwunden. Da wird er z. B. die Vorzüge,
welche sein Herz verzehren, mit unbefangenster Miene ignorieren, sie gar
nicht sehn, nicht kennen, nie bemerkt, noch davon gehört haben, und wird
so im Dissimulieren einen Meister abgeben. Er wird mit großer Feinheit,
den, dessen glänzende Eigenschaften an seinem Herzen nagen, scheinbar
als unbedeutend gänzlich übersehn, gar nicht gewahr werden und gelegentlich
ganz vergessen haben. Dabei aber wird er, vor allen Dingen, bemüht sein,
durch heimliche Machinationen, jenen Vorzügen alle Gelegenheit, sich
zu zeigen und bekannt zu werden, sorgfältig zu entziehn. Sodann wird
er über sie, aus dem Finstern, Tadel, Hohn, Spott und Verleumdung aussenden,
der Kröte gleich, die aus einem Loch ihr Gift hervorspritzt. Nicht weniger
wird er unbedeutende Menschen, oder auch das Mittelmäßige, ja Schlechte,
in derselben Gattung von Leistungen, enthusiastisch loben. Kurz, er wird
ein Proteus an Stratagemen, um zu verletzen, ohne sich zu zeigen. Aber,
was hilft es? das geübte Auge erkennt ihn doch. Ihn verrät schon die
Scheu und Flucht vor seinem Gegenstande, der daher, je glänzender er
ist, desto mehr allein steht; weshalb schöne Mädchen keine Freundinnen
haben: ihn verrät sein Haß ohne allen Anlaß, der bei der geringsten,
ja oft nur eingebildeten Gelegenheit, zur heftigsten Explosion kommt.
Wie ausgebreitet übrigens seine Familie sei, erkennt man an dem allgemeinen
Lobe der Bescheidenheit, dieser zu Gunsten der platten Gewöhnlichkeit
erfundenen, schlauen Tugend, welche dennoch, eben durch die in ihr an
den Tag gelegte Notwendigkeit der Schonung der Armseligkeit, diese gerade
ans Licht zieht. — Für unser Selbstgefühl freilich und unsern Stolz
kann es nichts Schmeichelhafteres geben, als den Anblick des in seinem
Verstecke lauernden und seine Machinationen betreibenden Neides; jedoch
vergesse man nie, daß, wo Neid ist, Haß ihn begleitet und hüte sich,
aus dem Neider einen falschen Freund werden zu lassen. Deshalb eben ist
die Entdeckung desselben für unsere Sicherheit von Wichtigkeit. Daher
soll man ihn studieren, um ihm auf die Schliche zu kommen; da er, überall
zu finden, allezeit inkognito einhergeht, oder auch, der giftigen Kröte
gleich, in finstern Löchern lauert. Hingegen verdient er weder Schonung,
noch Mitleid, sondern die Verhaltungsregel sei:
Den Neid wirst nimmer du versöhnen:
So magst du ihn getrost verhöhnen.
Dein Glück, dein Ruhm ist ihm ein Leiden:
Magst drum an seiner Qual dich weiden.
Wenn man nun, wie hier geschehn, die menschliche Schlechtigkeit ins Auge
gefaßt hat und sich darüber entsetzen möchte; so muß man alsbald den
Blick auf den Jammer des menschlichen Daseins werfen; und wieder ebenso,
wenn man vor diesem erschrocken ist, auf jene: da wird man finden, daß
sie einander das Gleichgewicht halten, und wird der ewigen Gerechtigkeit
inne werden, indem man merkt, daß die Welt selbst das Weltgericht ist,
und zu begreifen anfängt, warum alles, was lebt, sein Dasein abbüßen
muß, erst im Leben und dann im Sterben. So nämlich tritt das malum poenae
mit dem malum culpae in Uebereinstimmung. Vom selben Standpunkt aus verliert
sich auch die Indignation über die intellektuelle Unfähigkeit der allermeisten,
die uns im Leben so häufig anwidert. Also miseria humana, nequitia humana
und stultitia humana entsprechen einander vollkommen, in diesem Sansara
der Buddhaisten, und sind von gleicher Größe. Fassen wir aber einmal,
auf besondern Anlaß, eines von ihnen ins Auge und mustern es speziell;
so scheint es alsbald die zwei andern an Größe zu übertreffen: dies
ist jedoch Täuschung und bloß Folge ihres kolossalen Umfangs. Jegliches
kündigt dieses Sansara an; mehr als alles jedoch die Menschenwelt, als
in welcher, moralisch, Schlechtigkeit und Niederträchtigkeit, intellektuell,
Unfähigkeit und Dummheit in erschreckendem Maße vorherrschen. Dennoch
treten in ihr, wiewohl sehr sporadisch, aber doch stets von neuem uns
überraschend, Erscheinungen der Redlichkeit, der Güte, ja des Edelmuts,
und ebenso auch des großen Verstandes, des denkenden Geistes, ja, des
Genies auf. Nie gehn diese ganz aus: sie schimmern uns, wie einzelne glänzende
Punkte, aus der großen dunkeln Masse entgegen. Wir müssen sie als ein
Unterpfand nehmen, daß ein gutes und erlösendes Prinzip in diesem Sansara
steckt, welches zum Durchbruch kommen und das Ganze erfüllen und befreien
kann.
*) Ein Beispiel aus neuester Zeit findet man in Mac Leod, Travels in Eastern
Africa (in two Vol.’s, London 1860), wo die unerhörte, kalt berechnende
und wahrhaft teuflische Grausamkeit, mit der die Portugiesen in Mozambique
ihre Sklaven behandeln, berichtet wird.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Nach meiner Preisschrift über die moralische Freiheit kann keinem denkenden
Menschen zweifelhaft bleiben, daß diese nirgends in der Natur, sondern
nur außerhalb der Natur zu suchen ist. Sie ist ein Metaphysisches, aber
in der physischen Welt ein Unmögliches. Demnach sind unsere einzelnen
Thaten keineswegs frei; hingegen ist der individuelle Charakter eines
jeden anzusehn als seine freie That. Er selbst ist ein solcher, weil er,
ein für allemal, ein solcher sein will. Denn der Wille selbst und an
sich ist, auch sofern er in einem Individuo erscheint, also das Ur- und
Grundwollen desselben ausmacht, von aller Erkenntnis unabhängig, weil
ihr vorhergängig. Von ihr erhält er bloß die Motive, an denen er successive
sein Wesen entwickelt und sich kenntlich macht, oder in die Sichtbarkeit
tritt: aber er selbst ist, als außer der Zeit liegend, unveränderlich,
solange er überhaupt ist. Daher kann jeder, als ein solcher, der er nun
einmal ist, und unter den jedesmaligen Umständen, die aber ihrerseits
nach strenger Notwendigkeit eintreten, schlechterdings nie etwas anderes
thun, als was er jedesmal gerade jetzt thut. Demnach ist der ganze empirische
Verlauf des Lebens eines Menschen, in allen seinen Vorgängen, großen
und kleinen, so notwendig vorherbestimmt, wie der eines Uhrwerks. Dies
entsteht im Grunde daraus, daß die Art, wie die besagte, metaphysische
freie That ins erkennende Bewußtsein fällt, eine Anschauung ist, welche
Zeit und Raum zur Form hat, mittelst welcher nunmehr die Einheit und Unteilbarkeit
jener That sich darstellt als auseinander gezogen in eine Reihe von Zuständen
und Begebenheiten, die am Leitfaden des Satzes vom Grunde in seinen vier
Gestalten — und dies eben heißt notwendig, — eintreten. Das Resultat
aber ist ein moralisches, nämlich dieses, daß wir an dem, was wir thun,
erkennen was wir sind: wie wir an dem, was wir leiden, erkennen was wir
verdienen.
Hieraus folgt nun ferner, daß die Individualität nicht allein auf dem
principio individuationis beruht und daher nicht durch und durch bloße
Erscheinung ist; sondern daß sie im Dinge an sich, im Willen des Einzelnen,
wurzelt: denn sein Charakter selbst ist individuell. Wie tief nun aber
hier ihre Wurzeln gehn, gehört zu den Fragen, deren Beantwortung ich
nicht unternehme.
Hiebei verdient in Erinnerung gebracht zu werden, daß schon Plato, auf
seine Weise, die Individualität eines jeden als dessen freie That darstellt,
indem er ihn, infolge seines Herzens und Charakters, als einen solchen,
wie er ist, mittelst der Metempsychose, geboren werden läßt. (Phaedr.,
p. 325 sq. — De legib. X, p. 106. ed. Bip.) — Auch die Brahmanen ihrerseits
drücken die unveränderliche Bestimmtheit des angeborenen Charakters
mythisch dadurch aus, daß sie sagen, Brahma habe, bei der Hervorbringung
jedes Menschen, sein Thun und sein Leiden, in Schriftzeichen auf seinen
Schädel gegraben, denen gemäß sein Lebenslauf ausfallen müsse. Als
diese Schrift weisen sie die Zacken der Suturen der Schädelknochen nach.
Der Inhalt derselben sei eine Folge seines vorhergegangenen Lebens und
dessen Thuns. (Siehe Lettres èdifiantes, èdition de 1819, Vol. 6, p.
149, et Vol. 7, p. 135.) Dieselbe Einsicht scheint dem christlichen (sogar
schon paulinischen) Dogma von der Gnadenwahl zum Grunde zu liegen.
Eine andere Folge des Obigen, die sich empirisch durchgängig bestätigt,
ist, daß alle echten Verdienste, die moralischen, wie die intellektuellen,
nicht bloß einen physischen oder sonst empirischen, sondern einen metaphysischen
Ursprung haben, demnach a priori und nicht a posteriori gegeben, d. h.
angeboren und nicht erworben sind, folglich nicht in der bloßen Erscheinung,
sondern im Ding an sich wurzeln. Daher leistet jeder im Grunde nur das,
was schon in seiner Natur, d. h. eben in seinem Angeborenen, unwiderruflich
feststeht. Die intellektuellen Fähigkeiten bedürfen zwar der Ausbildung;
wie manche Naturprodukte der Zurichtung, um genießbar, oder sonst nutzbar,
zu sein: wie aber hier keine Zurichtung das ursprüngliche Material ersetzen
kann, so auch dort nicht. Daher eben sind alle bloß erworbenen, angelernten,
erzwungenen Eigenschaften, also Eigenschaften a posteriori, moralische,
wie intellektuelle, eigentlich unecht, eiteler Schein, ohne Gehalt. Wie
nun dies aus einer richtigen Metaphysik folgt, so lehrt es auch ein tieferer
Blick in die Erfahrung. Sogar bezeugt es das große Gewicht, welches alte
auf die Physiognomie und das Aeußere, also das Angeborene, jedes irgendwie
ausgezeichneten Menschen legen und daher so begierig sind, ihn zu sehn.
Die Oberflächlichen freilich und, aus guten Gründen, die gemeinen Naturen
werden der entgegengesetzten Ansicht sein, um bei allem, was ihnen abgeht,
sich getrösten zu können, es werde noch kommen. — So ist denn diese
Welt nicht bloß ein Kampfplatz, für dessen Siege und Niederlagen die
Preise in einer künftigen ausgeteilt werden; sondern sie selbst schon
ist das jüngste Gericht, indem jeder Lohn und Schmach, je nach seinen
Verdiensten, mitbringt; — wie denn auch Brahmanismus und Buddhaismus,
indem sie Metempsychose lehren, dies nicht anders wissen. —
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Welcher Art der Einfluß sei, den moralische Belehrung auf das Handeln
haben kann, und welches die Grenzen desselben, habe ich § 20 meiner Abhandlung
über das Fundament der Moral hinlänglich untersucht. Im wesentlichen
analog verhält sich der Einfluß des Beispiels, welcher jedoch mächtiger
ist, als der der Lehre; daher er eine kurze Analyse wohl verdient.
Das Beispiel wirkt zunächst entweder hemmend, oder befördernd. Ersteres,
wenn es den Menschen bestimmt, zu unterlassen was er gern thäte. Er sieht
nämlich, daß andere es nicht thun; woraus er im allgemeinen abnimmt,
daß es nicht rätlich sei, also wohl der eigenen Person, oder dem Eigentum,
oder der Ehre Gefahr bringen müsse; daran hält er sich und sieht sich
gern eigener Untersuchung überhoben. Oder er sieht gar, daß ein anderer,
der es gethan hat, schlimme Folgen davon trägt: dies ist das abschreckende
Beispiel. Befördernd hingegen wirkt das Beispiel auf zweierlei Weise:
nämlich entweder so, daß es den Menschen bewegt, zu thun was er gern
unterließe, jedoch ebenfalls besorgt, daß die Unterlassung ihm irgend
welche Gefahr bringen, oder ihm in der Meinung anderer schaden könne;
— oder aber es wirkt so, daß es ihn ermutigt, zu thun was er gern thut,
jedoch bisher, aus Furcht vor Gefahr, oder Schande, unterließ: dies ist
das verführerische Beispiel. Endlich kann auch noch das Beispiel ihn
auf etwas bringen, das ihm sonst gar nicht eingefallen wäre. Offenbar
wirkt es in diesem Fall zunächst nur auf den Intellekt: die Wirkung auf
den Willen ist dabei sekundär und wird, wenn sie eintritt, durch einen
Akt eigener Urteilskraft, oder durch Zutrauen auf den, der das Beispiel
gibt, vermittelt werden. — Die gesamte, sehr starke Wirkung des Beispiels
beruht darauf, daß der Mensch, in der Regel, zu wenig Urteilskraft, oft
auch zu wenig Kenntnis hat, um seinen Weg selbst zu explorieren; daher
er gern in die Fußstapfen anderer tritt. Demnach wird jeder dem Einflusse
des Beispiels um so mehr offen stehn, je mehr es ihm an jenen beiden Befähigungen
gebricht. Diesem gemäß ist der Leitstern der allermeisten Menschen das
Beispiel anderer, und ihr ganzes Thun und Treiben im großen, wie im kleinen,
läuft auf bloße Nachahmung zurück: nicht das Geringste thun sie nach
eigenem Ermessen *). Die Ursache hievon ist ihre Scheu vor allem und jedem
Nachdenken und ihr gerechtes Mißtrauen gegen das eigene Urteil. Zugleich
zeugt dieser so auffallend starke Nachahmungstrieb im Menschen auch von
seiner Verwandtschaft mit dem Affen. Die Art der Wirkung des Beispiels
aber wird durch den Charakter eines jeden bestimmt: daher dasselbe Beispiel
auf den einen verführerisch, auf den andern abschreckend wirken kann.
Dies zu beobachten geben gewisse gesellschaftliche Unarten, welche, früher
nicht vorhanden, allmählich einreißen, uns leicht Gelegenheit. Beim
ersten Wahrnehmen einer solchen wird einer denken: „Pfui, wie läßt
das! wie egoistisch, wie rücksichtslos! wahrlich, ich will mich hüten,
nie dergleichen zu thun.“ Zwanzig andere aber werden denken: „Aha!
thut der das, darf ich's auch.“ In moralischer Hinsicht kann das Beispiel,
eben wie die Lehre, zwar eine zivile, oder legale Besserung befördern,
jedoch nicht die innerliche, welches die eigentlich moralische ist. Denn
es wirkt stets nur als ein persönliches Motiv, folglich unter Voraussetzung
der Empfänglichkeit für solche Art der Motive. Aber gerade dies, ob
ein Charakter für diese, oder für jene Art der Motive überwiegend empfänglich
sei, ist für die eigentliche und wahre, jedoch stets nur angeborene Moralität
desselben entscheidend. Ueberhaupt wirkt das Beispiel als ein Beförderungsmittel
des Hervortretens der guten und schlechten Charaktereigenschaften: aber
es schafft sie nicht: daher Senecas Ausspruch velle non discitur auch
hier Stich hält. Daß das Angeborensein aller echten moralischen Eigenschaften,
der guten, wie der schlechten, besser zur Metempsychosenlehre der Brahmanisten
und Buddhaisten, derzufolge „dem Menschen seine guten und schlechten
Thaten aus einer Existenz in die andere, wie sein Schatten, nachfolgen“,
als zum Judentum paßt, welches vielmehr erfordert, daß der Mensch als
moralische Null auf die Welt komme, um nun, vermöge eines undenkbaren
liberi arbitrii indifferentiae, sonach infolge vernünftiger Ueberlegung,
sich zu entscheiden, ob er ein Engel, oder ein Teufel, oder was sonst
etwan zwischen beiden liegt, sein wolle, — das weiß ich sehr wohl,
kehre mich aber durchaus nicht daran: denn meine Standarte ist die Wahrheit.
Bin ich doch eben kein Philosophieprofessor und erkenne daher nicht meinen
Beruf darin, nur vor allen Dingen die Grundgedanken des Judentums sicher
zu stellen, selbst wenn solche aller und jeder philosophischen Erkenntnis
auf immer den Weg verrennen sollten. Liberum arbitrium indifferentiae,
unter dem Namen „die sittliche Freiheit“, ist eine allerliebste Spielpuppe
für Philosophieprofessoren, die man ihnen lassen muß, — den geistreichen,
redlichen und aufrichtigen.
*) Nachahmung und Gewohnheit sind die Triebfedern des allermeisten Thuns
der Menschen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Wegen der oben in Erinnerung gebrachten Negativität des Wohlseins und
Genusses, im Gegensatz der Positivität des Schmerzes, ist das Glück
eines gegebenen Lebenslaufes nicht nach dessen Freuden und Genüssen abzuschätzen,
sondern nach der Abwesenheit der Leiden, als des Positiven. Dann aber
erscheint das Los der Tiere erträglicher als das des Menschen. Wir wollen
beide etwas näher betrachten.
So mannigfaltig auch die Formen sind, unter denen das Glück und Unglück
des Menschen sich darstellt und ihn zum Verfolgen, oder Fliehen, anregt;
so ist doch die materielle Basis von dem allen der körperliche Genuß,
oder Schmerz. Diese Basis ist sehr schmal: es ist Gesundheit, Nahrung,
Schutz vor Nässe und Kälte, und Geschlechtsbefriedigung; oder aber der
Mangel an diesen Dingen. Folglich hat der Mensch an realem physischen
Genusse nicht mehr, denn das Tier; als etwan nur insofern sein höher
potenziertes Nervensystem die Empfindung jedes Genusses, jedoch auch die
jedes Schmerzes steigert. Allein, wie sehr viel stärker sind die Affekte,
welche in ihm erregt werden, als die des Tieres! wie ungleich tiefer und
heftiger wird sein Gemüt bewegt! um zuletzt doch nur dasselbe Resultat
zu erlangen: Gesundheit, Nahrung, Bedeckung u. s. w.
Dies entsteht zuvörderst daraus, daß bei ihm alles eine mächtige Steigerung
erhält durch das Denken an das Abwesende und Zukünftige, wodurch nämlich
Sorge, Furcht und Hoffnung erst eigentlich ins Dasein treten, dann aber
ihm viel stärker zusetzen, als die gegenwärtige Realität der Genüsse,
oder Leiden, auf welche das Tier beschränkt ist, es vermag. Diesem nämlich
fehlt, mit der Reflexion, der Kondensator der Freuden und Leiden, welche
daher sich nicht anhäufen können, wie dies beim Menschen, mittelst Erinnerung
und Vorhersehung, geschieht: sondern beim Tiere bleibt das Leiden der
Gegenwart, auch wenn es unzähligemal hinter einander wiederkehrt, doch
immer nur wie das erste Mal, das Leiden der Gegenwart, und kann sich nicht
aufsummieren. Daher die beneidenswerte Sorglosigkeit und Gemütsruhe der
Tiere. Hingegen mittelst der Reflexion und dem, was an ihr hängt, entwickelt
sich im Menschen, aus jenen nämlichen Elementen des Genusses und Leidens,
die das Tier mit ihm gemein hat, eine Steigerung der Empfindung seines
Glücks und Unglücks, die bis zum augenblicklichen, bisweilen sogar tödlichen
Entzücken, oder auch zum verzweifelten Selbstmord führen kann. Näher
betrachtet ist der Gang der Sache folgender. Seine Bedürfnisse, die ursprünglich
nur wenig schwerer zu befriedigen sind, als die des Tieres, steigert er
absichtlich, um den Genuß zu steigern: daher Luxus, Leckerbissen, Tabak,
Opium, geistige Getränke, Pracht und alles, was dahin gehört. Dann kommt,
ebenfalls infolge der Reflexion, noch hinzu eine ihm allein fließende
Quelle des Genusses, und folglich der Leiden, die ihm über alle Maßen
viel, ja, fast mehr als alle übrigen zu schaffen macht, nämlich Ambition,
und Gefühl für Ehre und Schande: — in Prosa, seine Meinung von der
Meinung Anderer von ihm. Diese nun wird, in tausendfachen und oft seltsamen
Gestalten, das Ziel fast aller seiner, über den physischen Genuß, oder
Schmerz, hinausgehenden Bestrebungen. Zwar hat er allerdings vor dem Tiere
noch die eigentlich intellektuellen Genüsse voraus, die gar viele Abstufungen
zulassen, von der einfältigsten Spielerei, oder auch Konversation, bis
zu den höchsten geistigen Leistungen: aber als Gegengewicht dazu, auf
der Seite der Leiden, tritt bei ihm die Langeweile auf, welche das Tier,
wenigstens im Naturzustande nicht kennt, sondern von der nur im gezähmten
Zustande die allerklügsten Tiere leichte Anfälle spüren; während sie
beim Menschen zu einer wirklichen Geißel wird, wie besonders zu ersehn
an jenem Heer der Erbärmlichen, die stets nur darauf bedacht gewesen
sind, ihren Beutel, aber nie ihren Kopf zu füllen, und denen nun gerade
ihr Wohlstand zur Strafe wird, indem er sie der marternden Langenweile
in die Hände liefert, welcher zu entgehn, sie jetzt bald herumjagen,
bald herumschleichen, bald herumreisen, und überall kaum angelangt, sich
ängstlich erkundigen nach den Ressourcen des Ortes, wie der Bedürftige
nach den Hilfsquellen desselben: denn freilich sind Not und Langeweile
die beiden Pole des Menschenlebens. Endlich ist noch zu erwähnen, daß
beim Menschen sich an die Geschlechtsbefriedigung eine nur ihm eigene,
sehr eigensinnige Auswahl knüpft, die bisweilen sich zu der, mehr oder
minder, leidenschaftlichen Liebe steigert, welcher ich, in den Ergänzungen
zur „Welt als Wille und Vorstellung“ (Bd. 6 dieser Gesamtausgabe)
ein ausführliches Kapitel gewidmet habe. Jene wird dadurch bei ihm eine
Quelle langer Leiden und kurzer Freuden. Zu bewundern ist es inzwischen,
wie, mittelst der Zuthat des Denkens, welches dem Tiere abgeht, auf derselben
schmalen Basis der Leiden und Freuden, die auch das Tier hat, das so hohe
und weitläuftige Gebäude des Menschenglückes und -unglücks sich erhebt,
in Beziehung auf welches sein Gemüt so starken Affekten, Leidenschaften
und Erschütterungen preisgegeben ist, daß das Gepräge derselben in
bleibenden Zügen auf seinem Gesichte lesbar wird; während doch am Ende
und im Realen es sich nur um dieselben Dinge handelt, die auch das Tier
erlangt, und zwar mit unvergleichlich geringerem Aufwande von Affekten
und Qualen. Durch dieses alles aber wächst im Menschen das Maß des Schmerzes
viel mehr, als das des Genusses, und wird nun noch speziell dadurch gar
sehr vergrößert, daß er vom Tode wirklich weiß; während das Tier
diesen nur instinktiv flieht, ohne ihn eigentlich zu kennen und daher
ohne jemals ihn wirklich ins Auge zu fassen, wie der Mensch, der diesen
Prospekt stets vor sich hat. Wenn nun also auch nur wenige Tiere natürlichen
Todes sterben, die meisten aber nur so viel Zeit gewinnen, ihr Geschlecht
fortzupflanzen, und dann, wenn nicht schon früher, die Beute eines andern
werden, der Mensch allein hingegen es dahin gebracht hat, daß, in seinem
Geschlechte, der sogenannte natürliche Tod zur Regel geworden ist, die
inzwischen beträchtliche Ausnahmen leidet; so bleiben, aus obigem Grunde,
die Tiere doch im Vorteil. Ueberdies aber erreicht er sein wirklich natürliches
Lebensziel ebenso selten, wie jene; weil die Widernatürlichkeit seiner
Lebensweise, nebst seinen Anstrengungen und Leidenschaften, und die durch
alles dieses entstandene Degeneration der Rasse ihn selten dahin gelangen
läßt.
Die Tiere sind viel mehr, als wir, durch das bloße Dasein befriedigt;
die Pflanze ist es ganz und gar; der Mensch je nach dem Grade seiner Stumpfheit.
Dem entsprechend enthält das Leben des Tieres weniger Leiden, aber auch
weniger Freuden, als das menschliche, und dies beruht zunächst darauf,
daß es einerseits von der Sorge und Besorgniß, nebst ihrer Qual, frei
bleibt, andererseits aber auch die eigentliche Hoffnung entbehrt, und
daher jener Anticipation einer freudigen Zukunft durch die Gedanken, nebst
der diese begleitenden, von der Einbildungskraft hinzugegebenen beseligenden
Phantasmagorie, dieser Quelle unserer meisten und größten Freuden und
Genüsse, nicht teilhaft wird, folglich in diesem Sinne hoffnungslos ist:
beides, weil sein Bewußtsein auf das Anschauliche, und dadurch auf die
Gegenwart, beschränkt ist. Das Tier ist die verkörperte Gegenwart; daher
es nur in Beziehung auf Gegenstände, die in dieser bereits anschaulich
vorliegen, ein, mithin äußerst kurz angebundenes, Fürchten und Hoffen
kennt; während das menschliche einen Gesichtskreis hat, der das ganze
Leben umfaßt, ja darüber hinausgeht. — Aber eben infolge hievon erscheinen
die Tiere, mit uns verglichen, in einem Betracht, wirklich weise, nämlich
im ruhigen, ungetrübten Genusse der Gegenwart: die augenscheinliche Gemütsruhe,
deren sie dadurch teilhaft sind, beschämt oft unsern, durch Gedanken
und Sorgen häufig unruhigen und unzufriedenen Zustand. Und sogar die
in Rede stehenden Freuden der Hoffnung und Anticipation haben wir nicht
unentgeltlich. Was nämlich einer durch das Hoffen und Erwarten einer
Befriedigung zum voraus genießt, geht nachher, als vom wirklichen Genuß
derselben vorweggenommen, von diesem ab, indem die Sache selbst dann um
so weniger befriedigt. Das Tier hingegen bleibt, wie vom Vorgenuß, so
auch von dieser Deduktion vom Genusse frei und genießt sonach das Gegenwärtige
und Reale selbst ganz und unvermindert. Und ebenfalls drücken auch die
Uebel auf dasselbe bloß mit ihrer wirklichen und eigenen Schwere, während
uns das Fürchten und Vorhersehn, ή προσδοκια των κακων,
diese oft verzehnfacht.
Eben dieses den Tieren eigene, gänzliche Aufgehn in der Gegenwart trägt
viel bei zu der Freude, die wir an unsern Haustieren haben: sie sind die
personifizierte Gegenwart und machen uns gewissermaßen den Wert jeder
unbeschwerten und ungetrübten Stunde fühlbar, während wir mit unsern
Gedanken meistens über diese hinausgehn und sie unbeachtet lassen. Aber
die angeführte Eigenschaft der Tiere, mehr, als wir, durch das bloße
Dasein befriedigt zu sein, wird vom egoistischen und herzlosen Menschen
mißbraucht und oft dermaßen ausgebeutet, daß er ihnen, außer dem bloßen
kahlen Dasein, nichts, gar nichts gönnt: den Vogel, der organisiert ist,
die halbe Welt zu durchstreifen, sperrt er in einen Kubikfuß Raum, wo
er sich langsam zu Tode sehnt und schreit: denn l'uccello nella gabbia
canta non di piacere, ma di rabbia, und seinen treuesten Freund, den so
intelligenten Hund, legt er an die Kette! Nie sehe ich einen solchen ohne
inniges Mitleid mit ihm und tiefe Indignation gegen seinen Herrn, und
mit Befriedigung denke ich an den vor einigen Jahren von den Times berichteten
Fall, daß ein Lord, der einen großen Kettenhund hielt, einst, seinen
Hof durchschreitend, sich beigehn ließ, den Hund liebkosen zu wollen,
darauf dieser sogleich ihm den Arm von oben bis unten aufriß, — mit
Recht! er wollte damit sagen: „Du bist nicht mein Herr, sondern mein
Teufel, der mir mein kurzes Dasein zur Hölle macht.“ Möge es jedem
so gehn, der Hunde ankettet.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Hat sich uns nun im Obigen ergeben, daß die erhöhte Erkenntniskraft
es ist, welche das Leben des Menschen schmerzensreicher macht, als das
des Tieres; so können wir dieses auf ein allgemeineres Gesetz zurückführen
und dadurch einen viel weiteren Ueberblick erlangen.
Erkenntnis ist, an sich selbst, stets schmerzlos. Der Schmerz trifft allein
den Willen und besteht in der Hemmung, Hinderung, Durchkreuzung desselben:
dennoch ist dazu erfordert, daß diese Hemmung von der Erkenntnis begleitet
sei. Wie nämlich das Licht den Raum nur dann erhellt, wann Gegenstände
dasind, es zurückzuwerfen; wie der Ton der Resonanz bedarf, und der Schall
überhaupt nur dadurch, daß die Wellen der vibrierenden Luft sich an
harten Körpern brechen, weit hörbar wird; daher er auf isolierten Bergspitzen
auffallend schwach ausfällt, ja, schon ein Gesang im Freien wenig Wirkung
thut; — ebenso nun muß die Hemmung des Willens, um als Schmerz empfunden
zu werden, von der Erkenntnis, welcher doch, an sich selbst, aller Schmerz
fremd ist, begleitet sein.
Daher ist schon der physische Schmerz durch Nerven und deren Verbindung
mit dem Gehirn bedingt, weshalb die Verletzung eines Gliedes nicht gefühlt
wird, wenn dessen zum Gehirn gehende Nerven durchschnitten sind, oder
das Gehirn selbst, durch Chloroform, depotenziert ist. Ebendeswegen auch
halten wir, sobald im Sterben das Bewußtsein erloschen ist, alle noch
folgenden Zuckungen für schmerzlos. Daß der geistige Schmerz durch Erkenntnis
bedingt sei, versteht sich von selbst, und daß er mit dem Grade derselben
wachse, ist leicht abzusehn, zudem im Obigen, wie auch in der „Welt
als Wille und Vorstellung“, § 56 (Bd. 3, S. 165 ff. dieser Gesamtausgabe),
nachgewiesen worden. — Wir können also das ganze Verhältnis bildlich
so ausdrücken: der Wille ist die Saite, seine Durchkreuzung, oder Hinderung,
deren Vibration, die Erkenntnis der Resonanzboden, der Schmerz ist der
Ton.
Demzufolge nun ist nicht nur das Unorganische, sondern auch die Pflanze
keines Schmerzes fähig; so viele Hemmungen auch der Wille in beiden erleiden
mag. Hingegen jedes Tier, selbst ein Infusorium, leidet Schmerz; weil
Erkenntnis, sei sie auch noch so unvollkommen, der wahre Charakter der
Tierheit ist. Mit ihrer Steigerung, auf der Skala der Animalität, wächst
demgemäß auch der Schmerz. Er ist sonach bei den untersten Tieren noch
äußerst gering: daher kommt es z. B. daß Insekten, die ihren abgerissenen
und bloß an einem Darm hängenden Hinterleib nach sich schleppen, dabei
noch fressen. Aber sogar bei den obersten Tieren kommt, wegen Abwesenheit
der Begriffe und des Denkens, der Schmerz dem des Menschen noch nicht
nahe. Auch durfte die Fähigkeit zu diesem ihren Höhepunkt erst da erreichen,
wo vermöge der Vernunft und ihrer Besonnenheit, auch die Möglichkeit
zur Verneinung des Willens vorhanden ist. Denn ohne diese wäre sie eine
zwecklose Grausamkeit gewesen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Einige Kirchenväter haben gelehrt, daß sogar die eheliche Beiwohnung
nur dann erlaubt ist, wann sie bloß der Kindererzeugung wegen geschehe,
έπι μονη παιδοποιια, wie Clemens Alex. Strom. I. III,
c. 11 sagt. (Die betreffenden Stellen findet man zusammengestellt in P.
E. Lind, De coelibatu Christianorum, c. 1.) Clemens (Strom. III, c. 3)
legt diese Ansicht auch den Pythagoreern bei. Dieselbe ist jedoch, genau
genommen, irrig. Denn, wird der Coitus nicht mehr seiner selbst wegen
gewollt; so ist schon die Verneinung des Willens zum Leben eingetreten,
und dann ist die Fortpflanzung des Menschengeschlechts überflüssig und
sinnleer; sofern der Zweck bereits erreicht ist. Zudem, ohne alle subjektive
Leidenschaft, ohne Gelüste und physischen Drang, bloß aus reiner Ueberlegung
und kaltblütiger Absicht einen Menschen in die Welt zu setzen, damit
er darin sei, — dies wäre eine moralisch sehr bedenkliche Handlung,
welche wohl nur wenige auf sich nehmen würden, ja, der vielleicht gar
einer nachsagen könnte, daß sie zur Zeugung aus bloßem Geschlechtstrieb
sich verhielte, wie der kaltblütig überlegte Mord zum Totschlag im Zorn.
Auf dem umgekehrten Grunde beruht eigentlich die Verdammlichkeit aller
widernatürlichen Geschlechtsbefriedigungen; weil durch diese dem Triebe
willfahrt, also der Wille zum Leben bejaht wird, die Propagation aber
wegfällt, welche doch allein die Möglichkeit der Verneinung des Willens
offen erhält. Hieraus ist zu erklären, daß erst mit dem Eintritt des
Christentums, weil dessen Tendenz asketisch ist, die Päderastie als eine
schwere Sünde erkannt wurde.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Rationalismus.
Der Mittelpunkt und das Herz des Christentums ist die Lehre vom Sündenfall,
von der Erbsünde, von der Heillosigkeit unsers natürlichen Zustandes
und der Verderbtheit des natürlichen Menschen, verbunden mit der Vertretung
und Versöhnung durch den Erlöser, deren man teilhaft wird durch den
Glauben an ihn. Dadurch nun aber zeigt dasselbe sich als Pessimismus,
ist also dem Optimismus des Judentums, wie auch des echten Kindes desselben,
des Islams, gerade entgegengesetzt, hingegen dem Brahmanismus und Buddhaismus
verwandt. — Dadurch, daß im Adam alle gesündigt haben und verdammt
sind, im Heiland hingegen alle erlöst werden, ist auch ausgedrückt,
daß das eigentliche Wesen und die wahre Wurzel des Menschen nicht im
Individuo liegt, sondern in der Spezies, welche die (platonische) Idee
des Menschen ist, deren auseinandergezogene Erscheinung in der Zeit die
Individuen sind.
Der Grundunterschied der Religionen liegt darin, ob sie Optimismus oder
Pessimismus sind; keineswegs darin, ob Monotheismus, Polytheismus, Trimurti,
Dreieinigkeit, Pantheismus, oder Atheismus (wie der Buddhaismus). Dieserwegen
sind A. T. und N. T. einander diametral entgegengesetzt und ihre Vereinigung
bildet einen wunderlichen Kentauren. Das A. T. nämlich ist Optimismus,
das N. T. Pessimismus. Jenes stammt erwiesenermaßen von der Ormuzdlehre;
dieses ist, seinem innern Geiste nach, dem Brahmanismus und Buddhaismus
verwandt, also wahrscheinlich auch historisch irgendwie aus ihnen abzuleiten.
Jenes ist eine Musik in Dur, dieses ist in Moll. Bloß der Sündenfall
macht im A. T. eine Ausnahme, bleibt aber unbenutzt, steht da wie ein
hors d’oeuvre, bis das Christentum ihn, als seinen allein passenden
Anknüpfungspunkt, wieder aufnimmt.
Allein jenen oben angegebenen Grundcharakter des Christentums, welchen
Augustinus, Luther und Melanchthon sehr richtig aufgefaßt und möglichst
systematisiert hatten, suchen unsere heutigen Rationalisten, in die Fußstapfen
des Pelagius tretend, nach Kräften zu verwischen und hinauszuexegesieren,
um das Christentum zurückzuführen auf ein nüchternes, egoistisches,
optimistisches Judentum, mit Hinzufügung einer bessern Moral und eines
künftigen Lebens, als welches der konsequent durchgeführte Optimismus
verlangt, damit nämlich die Herrlichkeit nicht so schnell ein Ende nehme
und der Tod, der gar zu laut gegen die optimistische Ansicht schreit und
wie der steinerne Gast am Ende zum fröhlichen Don Juan eintritt, abgefertigt
werde. — Diese Rationalisten sind ehrliche Leute, jedoch platte Gesellen,
die vom tiefen Sinne des neutestamentlichen Mythos keine Ahndung haben
und nicht über den jüdischen Optimismus hinaus können, als welcher
ihnen faßlich ist und zusagt. Sie wollen die nackte, trockene Wahrheit,
im Historischen, wie im Dogmatischen. Man kann sie dem Euhemerismus des
Altertums vergleichen. Freilich ist, was die Supranaturalisten bringen,
im Grunde eine Mythologie: aber dieselbe ist das Vehikel wichtiger tiefer
Wahrheiten, welche dem Verständnis des großen Haufens nahe zu bringen
auf anderem Wege nicht möglich wäre. — Wie weit hingegen diese Rationalisten
von aller Erkenntnis, ja, aller Ahndung des Sinnes und Geistes des Christentums
entfernt sind, zeigt z. B. ihr großer Apostel Wegscheider, in seiner
naiven Dogmatik, wo er (§ 115 nebst Anmerkungen) den tiefen Aussprüchen
Augustins und der Reformatoren über die Erbsünde und die wesentliche
Verderbtheit des natürlichen Menschen das fade Geschwätze des Cicero
in den Büchern De officiis entgegenzustellen sich nicht entblödet, da
solches ihm viel besser zusagt. Man muß wirklich sich über die Unbefangenheit
wundern, mit der dieser Mann seine Nüchternheit, Flachheit, ja gänzlichen
Mangel an Sinn für den Geist des Christentums zur Schau trägt. Aber
er ist nur unus e multis. Hat doch Brettschneider die Erbsünde aus der
Bibel hinausexegesiert; während Erbsünde und Erlösung die Essenz des
Christentums ausmachen. — Andererseits ist nicht zu leugnen, daß die
Supranaturalisten bisweilen etwas viel Schlimmeres, nämlich Pfaffen,
im ärgsten Sinne des Wortes, sind. Da mag nun das Christentum sehn, wie
es zwischen Skylla und Charybdis durchkomme. Der gemeinsame Irrtum beider
Parteien ist, daß sie in der Religion die unverschleierte, trockne, buchstäbliche
Wahrheit suchen. Diese aber wird allein in der Philosophie angestrebt:
die Religion hat nur eine Wahrheit, wie sie dem Volke angemessen ist,
eine indirekte, eine symbolische, allegorische Wahrheit. Das Christentum
ist eine Allegorie, die einen wahren Gedanken abbildet; aber nicht ist
die Allegorie an sich selbst das Wahre. Dies dennoch anzunehmen ist der
Irrtum, darin Supranaturalisten und Rationalisten übereinstimmen. Jene
wollen die Allegorie als an sich wahr behaupten; diese sie umdeuteln und
modeln, bis sie, so nach ihrem Maßstabe, an sich wahr sein könne. Danach
streitet denn jede Partei mit treffenden und starken Gründen gegen die
andere. Die Rationalisten sagen zu den Supranaturalisten: „Eure Lehre
ist nicht wahr.“ Diese hingegen zu jenen: „Eure Lehre ist kein Christentum.“
Beide haben recht. Die Rationalisten glauben die Vernunft zum Maßstabe
zu nehmen: in der That aber nehmen sie dazu nur die in den Voraussetzungen
des Theismus und Optimismus befangene Vernunft, so etwas wie Rousseaus
profession de foi du vicaire savoyard, diesen Prototyp alles Rationalismus.
Vom christlichen Dogma wollen sie daher nichts bestehn lassen, als eben
was sie für sensu proprio wahr halten: nämlich den Theismus und die
unsterbliche Seele. Wenn sie aber dabei, mit der Dreistigkeit der Unwissenheit,
an die reine Vernunft appellieren; so muß man sie mit der Kritik derselben
bedienen, um sie zu der Einsicht zu nötigen, daß diese ihre, als vernunftgemäß
zur Beibehaltung ausgewählten Dogmen sich bloß auf einer transcendenten
Anwendung immanenter Prinzipien basieren und demnach nur einen unkritischen,
folglich unhaltbaren philosophischen Dogmatismus ausmachen, wie ihn die
Kritik der reinen Vernunft auf jeder Seite bekämpft und als ganz eitel
nachweist; daher eben schon ihr Name ihren Antagonismus gegen den Rationalismus
ankündigt. Während demnach der Supranaturalismus doch allegorische Wahrheit
hat; kann man dem Rationalismus gar keine zuerkennen. Die Rationalisten
haben geradezu unrecht. Wer ein Rationalist sein will, muß ein Philosoph
sein und als solcher sich von aller Auktorität emanzipieren, vorwärtsgehn
und vor nichts zurückbeben. Will man aber ein Theolog sein; so sei man
konsequent und verlasse nicht das Fundament der Auktorität, auch nicht
wenn sie das Unbegreifliche zu glauben gebietet. Man kann nicht zweien
Herren dienen: also entweder der Vernunft oder der Schrift. Juste milieu
heißt hier, sich zwischen zwei Stühlen niederlassen. Entweder glauben,
oder philosophieren! was man erwählt, sei man ganz. Aber glauben, bis
auf einen gewissen Punkt und nicht weiter, und ebenso philosophieren,
bis auf einen gewissen Punkt und nicht weiter, — dies ist die Halbheit,
welche den Grundcharakter des Rationalismus ausmacht. Hingegen sind die
Rationalisten moralisch gerechtfertigt, sofern sie ganz ehrlich zu Werke
gehn und nur sich selbst täuschen; während die Supranaturalisten mit
ihrer Vindizierung der Wahrheit sensu proprio für eine bloße Allegorie
denn doch wohl meistens absichtlich andere zu täuschen suchen. Dennoch
wird, bei dem Streben dieser, die in der Allegorie enthaltene Wahrheit
gerettet; während hingegen die Rationalisten, in ihrer nordischen Nüchternheit
und Plattheit, diese und mit ihr die ganze Essenz des Christentums, zum
Fenster hinauswerfen, ja, Schritt vor Schritt, am Ende dahin kommen, wohin,
vor 80 Jahren, Voltaire im Fluge gelangt war. Oft ist es belustigend zu
sehn, wie sie, bei Feststellung der Eigenschaften Gottes (der Quidditas
desselben), wo sie doch mit dem bloßen Wort und Schiboleth „Gott“
nicht mehr ausreichen, sorgfältig zielen, das juste milieu zu treffen,
zwischen einem Menschen und einer Naturkraft; was denn freilich schwer
hält. Inzwischen reiben, in jenem Kampfe der Rationalisten und Supranaturalisten,
beide Parteien einander auf, wie die geharnischten Männer aus des Kadmus
Saat der Drachenzähne. Dazu gibt noch der von einer gewissen Seite her
thätige Tartüffianismus der Sache den Todesstoß. Nämlich, wie man,
im Karneval italienischer Städte, zwischen den Leuten, die nüchtern
und ernst ihren Geschäften nachgehn, tolle Masken herumlaufen sieht;
so sehn wir heutzutage in Deutschland zwischen den Philosophen, Naturforschern,
Historikern, Kritikern und Rationalisten, Tartüffes herumschwärmen,
im Gewande einer schon Jahrhunderte zurückliegenden Zeit, und der Effekt
ist burlesk, besonders wenn sie harangieren.
Die, welche wähnen, daß die Wissenschaften immer weiter fortschreiten
und immer mehr sich verbreiten können, ohne daß dies die Religion hindere,
immerfort zu bestehn und zu florieren, — sind in einem großen Irrtum
befangen. Physik und Metaphysik sind die natürlichen Feinde der Religion,
und daher diese die Feindin jener, welche allezeit strebt sie zu unterdrücken,
wie jene sie zu unterminieren. Von Friede und Uebereinstimmung beider
reden zu wollen ist höchst lächerlich: es ist ein bellum ad internecionem.
Religionen sind Kinder der Unwissenheit, die ihre Mutter nicht lange überleben.
Omar, Omar hat es verstanden, als er die Alexandrinische Bibliothek verbrannte:
sein Grund dazu, daß der Inhalt der Bücher entweder im Koran enthalten,
oder aber überflüssig wäre, gilt für albern, ist aber sehr gescheit,
wenn nur cum grano salis verstanden, wo er alsdann besagt, daß die Wissenschaften,
wenn sie über den Koran hinausgehn, Feinde der Religionen und daher nicht
zu dulden seien. Es stände viel besser um das Christentum, wenn die christlichen
Herrscher so klug gewesen wären, wie Omar. Jetzt aber ist es etwas spät,
alle Bücher zu verbrennen, die Akademien aufzuheben, den Universitäten
das pro ratione voluntas durch Mark und Bein dringen zu lassen, — um
die Menschheit dahin zurückzuführen, wo sie im Mittelalter stand. Und
mit einer Handvoll Obskuranten ist da nichts auszurichten: man sieht diese
heutzutage an, wie Leute, die das Licht auslöschen wollen, um zu stehlen.
So ist es denn augenscheinlich, daß nachgerade die Völker schon damit
umgehn, das Joch des Glaubens abzuschütteln: die Symptome davon zeigen
sich überall, wiewohl in jedem Lande anders modifiziert. Die Ursache
ist das zu viele Wissen, welches unter sie gekommen ist. Die sich täglich
vermehrenden und nach allen Richtungen sich immer weiter verbreitenden
Kenntnisse jeder Art erweitern den Horizont eines jeden, je nach seiner
Sphäre, so sehr, daß er endlich eine Größe erlangen muß, gegen welche
die Mythen, welche das Skelett des Christentums ausmachen, dermaßen einschrumpfen,
daß der Glaube nicht mehr daran haften kann. Die Menschheit wächst die
Religion aus, wie ein Kinderkleid; und da ist kein Halten; es platzt.
Glauben und Wissen vertragen sich nicht wohl im selben Kopfe: sie sind
darin wie Wolf und Schaf in einem Käfig; und zwar ist das Wissen der
Wolf, der den Nachbar aufzufressen droht. — In ihren Todesnöten sieht
man die Religion sich an die Moral anklammern, für deren Mutter sie sich
ausgeben möchte: — aber mit nichten! Echte Moral und Moralität ist
von keiner Religion abhängig; wiewohl jede sie sanktioniert und ihr dadurch
eine Stütze gewährt. — Zuerst nun aus den mittlern Ständen vertrieben
flüchtet das Christentum sich in die niedrigsten, wo es als Konventikelwesen
auftritt, und in die höchsten, wo es Sache der Politik ist, man aber
wohl bedenken sollte, daß auch hierauf Goethes Wort Anwendung findet:
„So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.“
Dem Leser wird hier die § 176 (S. 29 dieses Bandes) angeführte Stelle
des Condorcet wieder beifallen.
Der Glaube ist wie die Liebe: er läßt sich nicht erzwingen. Daher ist
es ein mißliches Unternehmen, ihn durch Staatsmaßregeln einführen,
oder befestigen zu wollen: denn, wie der Versuch, Liebe zu erzwingen,
Haß erzeugt; so der, Glauben zu erzwingen, erst rechten Unglauben. Nur
ganz mittelbar und folglich durch lange zum voraus getroffene Anstalten
kann man den Glauben befördern, indem man nämlich ihm ein gutes Erdreich,
darauf er gedeiht, vorbereitet: ein solches ist die Unwissenheit. Für
diese hat man daher in England, schon seit alten Zeiten und bis auf die
unserige, Sorge getragen, so daß zwei Drittel der Nation nicht lesen
können; daher denn auch noch heutzutage ein Köhlerglauben herrscht,
wie man ihn außerdem vergeblich suchen würde. Nunmehr aber nimmt auch
dort die Regierung den Volksunterricht dem Klerus aus den Händen; wonach
es mit dem Glauben bald bergab gehn wird. — Im ganzen also geht, von
den Wissenschaften fortwährend unterminiert, das Christentum seinem Ende
allmählich entgegen. Inzwischen ließe sich für dasselbe Hoffnung schöpfen
aus der Betrachtung, daß nur solche Religionen untergehn, die keine Urkunden
haben. Die Religion der Griechen und Römer, dieser weltbeherrschenden
Völker, ist untergegangen. Hingegen hat die Religion des verachteten
Judenvölkchens sich erhalten: ebenso die des Zendvolks, bei den Gebern.
Hingegen ist die der Gallier, Skandinaven und Germanen untergegangen.
Die brahmanische und buddhaistische aber bestehn und florieren: sie sind
die ältesten von allen und haben ausführliche Urkunden.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
A. und N. T.
Das Judentum hat zum Grundcharakter Realismus und Optimismus, als welche
nahe verwandt und die Bedingungen des eigentlichen Theismus sind; da dieser
die materielle Welt für absolut real und das Leben für ein uns gemachtes,
angenehmes Geschenk ausgibt. Brahmanismus und Buddhaismus haben, im Gegenteil,
zum Grundcharakter Idealismus und Pessimismus; da sie der Welt nur eine
traumartige Existenz zugestehn und das Leben als Folge unsrer Schuld betrachten.
In der Zendavestalehre, welcher bekanntlich das Judentum entsprossen ist,
wird das pessimistische Element doch noch durch den Ahriman vertreten.
Im Judentum hat aber dieser nur noch eine untergeordnete Stelle, als Satan,
welcher jedoch, eben wie Ahriman, auch Urheber der Schlangen, Skorpionen
und des Ungeziefers ist. Das Judentum verwendet ihn sogleich zur Nachbesserung
seines optimistischen Grundirrtums, nämlich zum Sündenfall, der nun
das, zur Steuer der augenscheinlichsten Wahrheit erforderte, pessimistische
Element in jene Religion bringt und noch der richtigste Grundgedanke in
derselben ist; obwohl er in den Verlauf des Daseins verlegt, was als Grund
desselben und ihm vorhergängig dargestellt werden müßte.
Eine schlagende Bestätigung, daß Jehovah Ormuzd sei, liefert das erste
Buch Esra in der LXX, also ό ίερευς A (c. 6, v. 24), von Luther
weggelassen: „Kyros, der König, ließ das Haus des Herrn zu Jerusalem
bauen, wo ihm durch das immerwährende Feuer geopfert wird.“ — Auch
das zweite Buch der Makkabäer, Kap. 1 und 2, auch Kap. 13, 8 beweist,
daß die Religion der Juden die der Perser gewesen ist, da erzählt wird,
die in die babylonische Gefangenschaft abgeführten Juden hätten, unter
Leitung des Nehemias, zuvor das geheiligte Feuer in einer ausgetrockneten
Zisterne verborgen, daselbst sei es unter Wasser geraten, durch ein Wunder
später wieder angefacht, zu großer Erbauung des Perserkönigs. Den Abscheu
gegen Bilderdienst und daher das Nichtdarstellen der Götter im Bilde
hatten, wie die Juden, so auch die Perser. (Auch Spiegel, über die Zendreligion,
lehrt enge Verwandtschaft zwischen Zendreligion und Judentum, will aber,
daß erstere vom letzteren stamme.) — Wie Jehovah eine Transformation
des Ormuzd, so ist die entsprechende des Ahriman der Satan, d. h. der
Widersacher, nämlich des Ormuzd. (Luther hat Widersacher, wo die Septuaginta
„Satan“ hat, z. B. 1. Kön. 11, 23.) Es scheint, daß der Jehovahdienst
unter Josias mit Beihilfe des Hilkias entstanden, d. h. von den Parsen
angenommen und durch Esra bei der Wiederkehr aus der babylonischen Verbannung
vollendet ist. Denn bis Josias und Hilkias hat offenbar Naturreligion,
Sabäismus, Verehrung des Belus, der Astarte u. a. m. in Judäa geherrscht,
auch unter Salomo. (Siehe die Bücher der Könige über Josias und Hilkias.)
*) — Beiläufig sei hier, als Bestätigung des Ursprungs des Judentums
aus der Zendreligion, angeführt, daß, nach dem A. T. und andern jüdischen
Auktoritäten, die Cherubim stierköpfige Wesen sind, auf welchen der
Jehovah reitet. (Psalm 99, 1. In der Septuaginta, Kön. Buch 2, c. 6,
2 und c. 22, 11; Buch 4, c. 19, 15: ό καϑημενος έπι των
Χερουβιμ.) Derartige Tiere, halb Stier, halb Mensch, auch halb
Löwe, der Beschreibung Ezechiels, Kap. 1 u. 10, sehr ähnlich, finden
sich auf den Skulpturen in Persepolis, besonders aber unter den in Mosul
und Nimrud gefundenen assyrischen Statuen, und sogar ist in Wien ein geschnittener
Stein, welcher den Ormuzd auf einem solchen Ochsencherubim reitend darstellt:
worüber das Nähere in den Wiener Jahrbüchern der Litteratur, September
1833, Rec. der Reisen in Persien. Die ausführliche Darlegung jenes Ursprungs
hat übrigens geliefert J. G. Rhode, in seinem Buche „Die heilige Sage
des Zendvolks“. Dies alles wirft Licht auf den Stammbaum des Jehovah.
Das N. T. hingegen muß irgendwie indischer Abstammung sein: davon zeugt
seine durchaus indische, die Moral in die Askese überführende Ethik,
sein Pessimismus und sein Avatar. Durch eben diese aber steht es mit dem
A. T. in entschiedenem, innerlichem Widerspruch; so daß nur die Geschichte
vom Sündenfall da war, ein Verbindungsglied, dem es angehängt werden
konnte, abzugeben. Denn als jene indische Lehre den Boden des gelobten
Landes betrat, entstand die Aufgabe, die Erkenntnis der Verderbnis und
des Jammers der Welt, ihrer Erlösungsbedürftigkeit und des Heils durch
einen Avatar, nebst der Moral der Selbstverleugnung und Buße — mit
dem jüdischen Monotheismus und seinem παντα καλα λιαν zu
vereinigen. Und es ist gelungen, so gut es konnte, so gut nämlich zwei
so ganz heterogene, ja entgegengesetzte Lehren sich vereinigen ließen.
Wie eine Epheuranke, da sie der Stütze und des Anhalts bedarf, sich um
einen roh behauenen Pfahl schlingt, seiner Ungestalt sich überall anbequemend,
sie wiedergebend, aber mit ihrem Leben und Liebreiz bekleidet, wodurch,
statt seines, ein erfreulicher Anblick sich uns darstellt; so hat die
aus indischer Weisheit entsprungene Christuslehre den alten, ihr ganz
heterogenen Stamm des rohen Judentums überzogen, und was von seiner Grundgestalt
hat beibehalten werden müssen ist etwas ganz anderes, etwas Lebendiges
und Wahres, durch sie verwandelt: es scheint dasselbe, ist aber ein wirklich
Anderes.
Der von der Welt gesonderte Schöpfer aus Nichts ist nämlich identifiziert
mit dem Heiland und durch ihn mit der Menschheit, als deren Stellvertreter
dieser dasteht, da sie in ihm erlöst wird, wie sie im Adam gefallen war
und seitdem in den Banden der Sünde, des Verderbens, des Leidens und
des Todes verstrickt lag. Denn als alles dieses stellt hier, so gut wie
im Buddhaismus, die Welt sich dar; — nicht mehr im Lichte des jüdischen
Optimismus, welcher „alles sehr schön“ (παντα καλα λιαν)
gefunden hatte: vielmehr heißt jetzt der Teufel selbst „Fürst dieser
Welt“, — ό αρχων του κοσμου τουτου (Joh.
12, 32), wörtlich Weltregierer. Die Welt ist nicht mehr Zweck, sondern
Mittel: das Reich der ewigen Freuden liegt jenseit derselben und des Todes.
Entsagung in dieser Welt und Richtung aller Hoffnung auf eine bessere
ist der Geist des Christentums. Den Weg zu einer solchen aber öffnet
die Versöhnung, d. i. die Erlösung von der Welt und ihren Wegen. In
der Moral ist an die Stelle des Vergeltungsrechtes das Gebot der Feindesliebe
getreten, an die des Versprechens zahlloser Nachkommenschaft die Verheißung
des ewigen Lebens, und an die des Heimsuchens der Missethat an den Kindern
bis ins vierte Glied der heilige Geist, der alles überschattet.
So sehn wir durch die Lehren des N. T. die des Alten rektifiziert und
umgedeutet, wodurch im Innersten und Wesentlichen eine Uebereinstimmung
mit den alten Religionen Indiens zuwege gebracht wird. Alles, was im Christentum
Wahres ist, findet sich auch im Brahmanismus und Buddhaismus. Aber die
jüdische Ansicht von einem belebten Nichts, einem zeitlichen Machwerk,
welches sich für eine ephemere Existenz, voll Jammer, Angst und Not,
nicht demütig genug bedanken und den Jehovah dafür preisen kann, —
wird man im Hinduismus und Buddhaismus vergeblich suchen. Denn wie ein
aus fernen tropischen Gefilden, über Berge und Ströme hergewehter Blütenduft,
ist im N. T. der Geist der indischen Weisheit zu spüren. Vom A. T. hingegen
paßt zu dieser nichts, als nur der Sündenfall, der eben als Korrektiv
des optimistischen Theismus sogleich hat hinzugefügt werden müssen und
an den denn auch das N. T. sich anknüpfte, als an den einzigen ihm sich
darbietenden Anhaltspunkt.
Wie nun aber zur gründlichen Kenntnis einer Spezies die ihres Genus erfordert
ist; dieses selbst jedoch wieder nur in seinen speciebus erkannt wird;
so ist zum gründlichen Verständnis des Christentums die Kenntnis der
beiden andern weltverneinenden Religionen, also des Brahmanismus und Buddhaismus
erforderlich, und zwar eine solide und möglichst genaue. Denn, wie allererst
das Sanskrit uns das recht gründliche Verständnis der griechischen und
lateinischen Sprache eröffnet; so Brahmanismus und Buddhaismus das des
Christentums.
Ich hege sogar die Hoffnung, daß einst mit den indischen Religionen vertraute
Bibelforscher kommen werden, welche die Verwandtschaft derselben mit dem
Christentum auch durch ganz spezielle Züge werden belegen können. Bloß
versuchsweise mache ich einstweilen auf folgenden aufmerksam. In der Epistel
des Jakobus (Jak. 3, 6), ist der Ausdruck ό τροχός τής γενέσεως
(wörtlich „das Rad der Entstehung“) von jeher eine crux interpretum
gewesen. Im Buddhaismus ist aber das Rad der Seelenwanderung ein sehr
geläufiger Begriff. In Abel Remusats Uebersetzung des Foe-Kue-ki heißt
es S. 28: La roue est l’emblème de la transmigration des àmes, qui
est comme un cercle sans commencement ni fin. S. 179: La roue est un emblème
familier aux Bouddhistes, il exprime le passage successit de l'àme dans
le cercle des divers modes d’existence. S. 282 sagt der Buddha selbst:
Qui ne connait pas la raison, tombera par le tour de la roue dans la vie
et la mort. In Burnoufs Introduction à l'histoire du Bouddhisme finden
wir, Vol. 1, p. 434, die bedeutsame Stelle: Il reconnut ce que c’est
que la roue de la transmigration, qui porte cinq marques, qui est à la
fois mobile et immobile; et ayant triomphè de toutes les voies par lesquelles
on entre dans le monde, en les dètruisant, etc. In Spence Hardy, Eastern
Monachism (Lond. 1850), ist p. 6 zu lesen: Like the revolutions of a wheel,
there is a regular succession of death and birth, the moral cause of which
is the cleaving to existing objects, whilst the instrumental cause is
karma (action). Siehe daselbst p. 193 und 223, 24. Auch im Prabodh Chandrodaya
(Akt 4, Sc. 3) steht: Ignorance is the source of Passion, who turns the
wheel of this mortal existence. (S. Prabodh Chandrodaya, transl. by Tylor,
Lond. 1812, p. 49.) Vom beständigen Entstehn und Vergehn successiver
Welten heißt es in der Darlegung des Buddhaismus nach birmanischen Texten,
von Buchanan, in den Asiatic researches Vol. 6, p. 181: The successive
destructions and reproductions of the world resemble a great wheel, in
which we can point out neither beginning nor end. (Dieselbe Stelle, nur
länger, steht in Sangermano, Description of the Burmese Empire, Rome
1833, p. 7.) In Menus Verordnungen heißt es: lt is He (Brahma), who,
pervading all beings in five elemental forms, causes them by the gradations
of birth, growth and dissolution, to revolve in this world, until they
deserve beatitude, like the wheels of a car. (S. Institutes of Hindu Law:
or, the ordinances of Menu, according to the Gloss of Cullùca. Translated
by Sir William Jones, chapt. XII, 124.) —
Nach Grauls Glossar ist Hansa ein Synonym von Saniassi. — Sollte der
Name Johannes (aus dem wir Hans machen) damit (und mit seinem Saniassileben
in der Wüste) zusammenhängen? —
Eine ganz äußerliche und zufällige Aehnlichkeit des Buddhaismus mit
dem Christentum ist die, daß er im Lande seiner Entstehung nicht herrschend
ist, also beide sagen müssen: προφητης εν τη ιδια πατριδι
τιμην ουκ εχει. (Vates in propria patria honore caret.)
Wollte man, um jene Uebereinstimmung mit den indischen Lehren zu erklären,
sich in allerlei Konjekturen ergehn; so könnte man annehmen, daß der
evangelischen Notiz von der Flucht nach Aegypten etwas Historisches zum
Grunde läge und daß Jesus, von ägyptischen Priestern, deren Religion
indischen Ursprungs gewesen ist, erzogen, von ihnen die indische Ethik
und den Begriff des Avatars angenommen hätte und nachher bemüht gewesen
wäre, solche daheim den jüdischen Dogmen anzupassen und sie auf den
alten Stamm zu pfropfen. Gefühl eigener moralischer und intellektueller
Ueberlegenheit hätte ihn endlich bewogen, sich selbst für einen Avatar
zu halten und demgemäß sich des Menschen Sohn zu nennen, um anzudeuten,
daß er mehr als ein bloßer Mensch sei. Sogar ließe sich denken, daß,
bei der Stärke und Reinheit seines Willens, und vermöge der Allmacht,
die überhaupt dem Willen als Ding an sich zukommt und die wir aus dem
animalischen Magnetismus und den diesem verwandten magischen Wirkungen
kennen, er auch vermocht hätte, sogenannte Wunder zu thun, d. h. mittelst
des metaphysischen Einflusses des Willens zu wirken; wobei denn ebenfalls
der Unterricht der ägyptischen Priester ihm zu statten gekommen wäre.
Diese Wunder hätten dann nachher die Sage vergrößert und vermehrt.
Denn ein eigentliches Wunder wäre überall ein Dementi, welches die Natur
sich selber gäbe. (Die Evangelien wollten ihre Glaubwürdigkeit durch
den Bericht von Wundern unterstützen, haben sie aber gerade dadurch unterminiert.)
Inzwischen wird es uns nur unter Voraussetzungen solcher Art einigermaßen
erklärlich, wie Paulus, dessen Hauptbriefe doch wohl echt sein müssen,
einen damals noch so kürzlich, daß noch viele Zeitgenossen desselben
lebten, Verstorbenen ganz ernstlich als inkarnierten Gott und als eins
mit dem Weltschöpfer darstellen kann: indem doch sonst ernstlich gemeinte
Apotheosen dieser Art und Größe vieler Jahrhunderte bedürfen, um allmählich
heranzureifen. Andererseits aber könnte man daher ein Argument gegen
die Echtheit der Paulinischen Briefe überhaupt nehmen.
Daß überhaupt unsern Evangelien irgend ein Original, oder wenigstens
Fragment aus der Zeit und Umgebung Jesu selbst zum Grunde liege, möchte
ich schließen gerade aus der so anstößigen Prophezeiung des Weltendes
und der glorreichen Wiederkehr des Herrn in den Wolken, welche statthaben
soll, noch bei Lebzeiten einiger, die bei der Verheißung gegenwärtig
waren. Daß nämlich diese Verheißungen unerfüllt geblieben, ist ein
überaus verdrießlicher Umstand, der nicht nur in späteren Zeiten Anstoß
gegeben, sondern schon dem Paulus und Petrus Verlegenheiten bereitet hat,
welche in des Reimarus sehr lesenswertem Buche „Vom Zwecke Jesu und
seiner Jünger“ §§ 42—44 ausführlich erörtert sind. Wären nun
die Evangelien, etwan hundert Jahre später, ohne vorliegende gleichzeitige
Dokumente verfaßt; so würde man sich wohl gehütet haben, dergleichen
Prophezeiungen hineinzubringen, deren so anstößige Nichterfüllung damals
schon am Tage lag. Ebensowenig würde man in die Evangelien alle jene
Stellen hineingebracht haben, aus welchen Reimarus sehr scharfsinnig das
konstruiert, was er das erste System der Jünger nennt und wonach ihnen
Jesus nur ein weltlicher Befreier der Juden war; wenn nicht die Abfasser
der Evangelien auf Grundlage gleichzeitiger Dokumente gearbeitet hätten,
die solche Stellen enthielten. Denn sogar eine bloß mündliche Tradition
unter den Gläubigen würde Dinge, die dem Glauben Ungelegenheiten bereiteten,
haben fallen lassen. Beiläufig gesagt, hat Reimarus unbegreiflicherweise
die seiner Hypothese vor allen andern günstige Stelle Joh. 11, 48 (zu
vergleichen mit 1, 50 und 6, 15) übersehn, imgleichen auch Matth. 27,
V. 28—30; Luk. 23, V. 1—4, 37, 38, und Joh. 19, V. 19—22. Wollte
man aber diese Hypothese ernstlich geltend machen und durchführen; so
müßte man annehmen, daß der religiöse und moralische Gehalt des Christentums
von alexandrinischen, der indischen und buddhaistischen Glaubenslehren
kundigen Juden zusammengestellt und dann ein politischer Held, mit seinem
traurigen Schicksale, zum Anknüpfungspunkte derselben gemacht sei, indem
man den ursprünglich irdischen Messias in einen himmlischen umschuf.
Allerdings hat dies sehr viel gegen sich. Jedoch bleibt das von Strauß
aufgestellte mythische Prinzip, zur Erklärung der evangelischen Geschichte,
wenigstens für die Einzelheiten derselben, gewiß das richtige: und es
wird schwer auszumachen sein, wie weit es sich erstreckt. Was überhaupt
es mit dem Mythischen für eine Bewandtnis habe, muß man sich an näherliegenden
und weniger bedenklichen Beispielen klar machen. So z. B. ist, im ganzen
Mittelalter, sowohl in Frankreich, wie in England, der König Arthur eine
festbestimmte, sehr thatenreiche, wundersame, stets mit gleichem Charakter
und mit derselben Begleitung auftretende Person und macht, mit seiner
Tafelrunde, seinen Rittern, seinen unerhörten Heldenthaten, seinem wunderlichen
Seneschall, seiner treulosen Gattin, nebst deren Lancelot vom See u. s.
w., das stehende Thema der Dichter und Romanenschreiber vieler Jahrhunderte
aus, welche sämtlich uns die nämlichen Personen mit denselben Charakteren
vorführen, auch in den Begebenheiten ziemlich übereinstimmen, nur aber
im Kostüme und den Sitten, nämlich nach Maßgabe ihres jedesmaligen
eigenen Zeitalters, stark voneinander abweichen. Nun hatte, vor einigen
Jahren, das französische Ministerium den Herrn de la Villemarquè nach
England gesandt, um den Ursprung der Mythen von jenem König Arthur zu
untersuchen. Da ist, hinsichtlich des zum Grunde liegenden Faktischen,
das Ergebnis gewesen, daß, im Anfang des sechsten Jahrhunderts, in Wales,
ein kleiner Häuptling, Namens Arthur, gelebt hat, der unverdrossen mit
den eingedrungenen Sachsen kämpfte, dessen unbedeutende Thaten jedoch
vergessen sind. Aus dem also ist, der Himmel weiß warum, eine so glänzende,
viele Jahrhunderte hindurch, in unzähligen Liedern, Romanzen und Romanen
celebrierte Person geworden. Man sehe: Contes populaires des anciens Bretons,
avec un essay sur l’origine des èpopèes sur la table ronde, par Th.
de la Villemarquè. 2 Vol. 1842, wie auch The life of king Arthur, from
ancient historians and authentic documents, by Ritson, 1825, darin er
als eine ferne undeutliche Nebelgestalt, jedoch nicht ohne realen Kern
erscheint. — Fast ebenso verhält es sich mit dem Roland, welcher der
Held des ganzen Mittelalters ist und in zahllosen Liedern, epischen Gedichten
und Romanen, auch sogar durch Rolandssäulen celebriert wird, bis er zuletzt
noch dem Ariosto seinen Stoff liefert und daraus verklärt aufersteht:
dieser nun wird von der Geschichte nur ein einziges Mal, gelegentlich
und mit drei Worten erwähnt, indem nämlich Eginhard ihn unter den bei
Roncesvall gebliebenen Notabeln mit aufzählt als Hroudlandus, Britannici
limitis praefectus, und das ist alles, was wir von ihm wissen; wie alles,
was wir von Jesus Christus eigentlich wissen, die Stelle im Tacitus (Annal.
L. XV, c. 44) ist. Noch ein anderes Beispiel liefert der weltberühmte
Cid der Spanier, welchen Sagen und Chroniken, vor allem aber die Volkslieder
in dem so berühmten, wunderschönen Romancero, endlich auch noch Corneilles
bestes Trauerspiel, verherrlichen und dabei auch in den Hauptbegebenheiten,
namentlich was die Chimene betrifft, ziemlich übereinstimmen; während
die spärlichen historischen Data über ihn nichts ergeben, als einen
zwar tapfern Ritter und ausgezeichneten Heerführer, aber von sehr grausamem
und treulosem, ja, feilem Charakter, bald dieser bald jener Partei und
öfter den Sarazenen, als den Christen dienend; beinahe wie ein Condottiere;
jedoch mit einer Chimene verheiratet; wie das Nähere zu ersehn ist aus
den Recherches sur l'histoire de l'Espagne par Dozy, 1849, Bd. 1, —
der zuerst an die rechte Quelle gekommen zu sein scheint. — Was mag
wohl die historische Grundlage der Ilias sein? — Ja, um die Sache ganz
in der Nähe zu haben, denke man an das Histörchen vom Apfel des Newton,
dessen Grundlosigkeit ich bereits oben, § 87, erörtert habe, welches
jedoch in tausend Büchern wiederholt worden ist; wie denn sogar Euler,
im ersten Bande seiner Briefe an die Prinzessin, nicht verfehlt hat, es
recht con amore auszumalen. — Wenn es überhaupt mit aller Geschichte
viel auf sich haben sollte, müßte unser Geschlecht nicht ein so erzlügenhaftes
sein, wie es leider ist.
*) Sollte die sonst unerklärliche Gnade, welche (nach Esra) Kyros und
Darius den Juden erzeigen und deren Tempel wiederherstellen lassen, vielleicht
darauf beruhen, daß die Juden, welche bis dahin den Baal, die Astarte,
den Moloch u. s. w. angebetet hatten, in Babylon, nach dem Siege der Perser,
den Zoroaster-Glauben angenommen haben, und nun dem Ormuzd, unter dem
Namen Jehovah, dienten? Dazu stimmt sogar, daß (was sonst absurd wäre)
Kyros zum Gotte Israels betet. (Esra 1, c. 2, v. 3 in LXX.) Alle vorhergehenden
Bücher des A. T. sind entweder später, also nach der babylonischen Gefangenschaft,
abgefaßt, oder wenigstens ist die Jehovahlehre später hineingetragen.
Uebrigens lernt man durch den Esra. 1, c. 8 und 9, das Judentum, von seiner
schändlichsten Seite kennen: hier handelt das auserwählte Volk nach
dem empörenden und ruchlosen Vorbilde seines Stammvaters Abraham: wie
dieser die Hagar mit dem Ismael fortjagte, so werden die Weiber, nebst
ihren Kindern, welche Juden während der babylonischen Gefangenschaft
geheiratet hatten, weggejagt; weil sie nicht von der Rasse Mauschel sind.
Etwas Nichtswürdigeres läßt sich kaum denken. Wenn nicht etwan jene
Schurkerei des Abraham erfunden ist, um die großartigere des ganzen Volkes
zu beschönigen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Kant hat eine Abhandlung über die lebendigen Kräfte geschrieben: ich
aber möchte eine Nänie und Threnodie über dieselben schreiben; weil
ihr so überaus häufiger Gebrauch, im Klopfen, Hämmern und Rammeln,
mir mein Leben hindurch, zur täglichen Pein gereicht hat. Allerdings
gibt es Leute, ja, recht viele, die hierüber lächeln; weil sie unempfindlich
gegen Geräusch sind: es sind jedoch eben die, welche auch unempfindlich
gegen Gründe, gegen Gedanken, gegen Dichtungen und Kunstwerke, kurz,
gegen geistige Eindrücke jeder Art sind: denn es liegt an der zähen
Beschaffenheit und handfesten Textur ihrer Gehirnmasse. Hingegen finde
ich Klagen über die Pein, welche denkenden Menschen der Lärm verursacht,
in den Biographien, oder sonstigen Berichten persönlicher Aeußerungen
fast aller großen Schriftsteller, z. B. Kants, Goethes, Lichtenbergs,
Jean Pauls; ja, wenn solche bei irgend einem fehlen sollten, so ist es
bloß, weil der Kontext nicht darauf geführt hat. Ich lege mir die Sache
so aus: wie ein großer Diamant, in Stücke zerschnitten, an Wert nur
noch ebenso vielen kleinen gleichkommt; oder wie ein Heer, wenn es zersprengt,
d. h. in kleine Haufen aufgelöst ist, nichts mehr vermag; so vermag auch
ein großer Geist nicht mehr, als ein gewöhnlicher, sobald er unterbrochen,
gestört, zerstreut, abgelenkt wird; weil seine Ueberlegenheit dadurch
bedingt ist, daß er alle seine Kräfte, wie ein Hohlspiegel alle seine
Strahlen, auf einen Punkt und Gegenstand konzentriert; und hieran eben
verhindert ihn die lärmende Unterbrechung. Darum also sind die eminenten
Geister stets jeder Störung, Unterbrechung und Ablenkung, vor allem aber
der gewaltsamen durch Lärm, so höchst abhold gewesen; während die übrigen
dergleichen nicht sonderlich anficht. Die verständigste und geistreichste
aller europäischen Nationen hat sogar die Regel never interrupt, —
„du sollst niemals unterbrechen“, — das elfte Gebot genannt. Der
Lärm aber ist die impertinenteste aller Unterbrechungen, da er sogar
unsere eigenen Gedanken unterbricht, ja, zerbricht. Wo jedoch nichts zu
unterbrechen ist, da wird er freilich nicht sonderlich empfunden werden.
— Bisweilen quält und stört ein mäßiges und stetiges Geräusch mich
eine Weile, ehe ich seiner mir deutlich bewußt werde, indem ich es bloß
als eine konstante Erschwerung meines Denkens, wie einen Block am Fuße,
empfinde, bis ich inne werde, was es sei. —
Nunmehr aber, vom Genus auf die Spezies übergehend, habe ich, als den
unverantwortlichsten und schändlichsten Lärm, das wahrhaft infernale
Peitschenknallen, in den hallenden Gassen der Städte, zu denunzieren,
welches dem Leben alle Ruhe und alle Sinnigkeit benimmt. Nichts gibt mir
von dem Stumpfsinn und der Gedankenlosigkeit der Menschen einen so deutlichen
Begriff, wie das Erlaubtsein des Peitschenklatschens. Dieser plötzliche,
scharfe, hirnlähmende, alle Besinnung zerschneidende und gedankenmörderische
Knall muß von jedem, der nur irgend etwas, einem Gedanken Aehnliches
im Kopfe herumträgt, schmerzlich empfunden werden; jeder solcher Knall
muß daher Hunderte in ihrer geistigen Thätigkeit, so niedriger Gattung
sie auch immer sein mag, stören: dem Denker aber fährt er durch seine
Meditationen so schmerzlich und verderblich, wie das Richtschwert zwischen
Kopf und Rumpf. Kein Ton durchschneidet so scharf das Gehirn, wie dieses
vermaledeite Peitschenklatschen: man fühlt geradezu die Spitze der Peitschenschnur
im Gehirn, und es wirkt auf dieses wie die Berührung auf die mimosa pudica;
auch ebenso nachhaltig. Bei allem Respekt vor der hochheiligen Nützlichkeit
sehe ich doch nicht ein, daß ein Kerl, der eine Fuhr Sand oder Mist von
der Stelle schafft, dadurch das Privilegium erlangen soll, jeden etwan
aufsteigenden Gedanken, in successive zehntausend Köpfen (eine halbe
Stunde Stadtweg) im Keime zu ersticken. Hammerschläge, Hundegebell und
Kindergeschrei sind entsetzlich; aber der rechte Gedankenmörder ist allein
der Peitschenknall. Jeden guten, sinnigen Augenblick, den etwan hier und
da irgend einer hat, zu zermalmen ist seine Bestimmung. Nur wenn, um Zugtiere
anzutreiben, kein anderes Mittel vorhanden wäre, als dieser abscheulichste
aller Klänge, würde es zu entschuldigen sein. Aber ganz im Gegenteil:
dieses vermaledeite Peitschenklatschen ist nicht nur unnötig, sondern
sogar unnütz. Die durch dasselbe beabsichtigte psychische Wirkung auf
die Pferde nämlich ist durch die Gewohnheit, welche der unablässige
Mißbrauch der Sache herbeigeführt hat, ganz abgestumpft und bleibt aus:
sie beschleunigen ihren Schritt nicht danach: wie besonders an leeren
und Kunden suchenden Fiakern, die, im langsamsten Schritt fahrend, unaufhörlich
klatschen, zu ersehn ist: die leiseste Berührung mit der Peitsche wirkt
mehr. Angenommen aber, daß es unumgänglich nötig wäre, die Pferde
durch den Schall beständig an die Gegenwart der Peitsche zu erinnern,
so würde dazu ein hundertmal schwächerer Schall ausreichen; da bekanntlich
die Tiere sogar auf die leisesten, ja auf kaum merkliche Zeichen, hörbare
wie sichtbare, achten; wovon abgerichtete Hunde und Kanarienvögel staunenerregende
Beispiele liefern. Die Sache stellt demnach sich eben dar als reiner Mutwille,
ja, als ein frecher Hohn des mit den Armen arbeitenden Teiles der Gesellschaft
gegen den mit dem Kopfe arbeitenden. Daß eine solche Infamie in Städten
geduldet wird ist eine große Barbarei und eine Ungerechtigkeit; um so
mehr, als es gar leicht zu beseitigen wäre, durch polizeiliche Verordnung
eines Knotens am Ende jeder Peitschenschnur. Es kann nicht schaden, daß
man die Proletarier auf die Kopfarbeit der über ihnen stehenden Klassen
aufmerksam mache: denn sie haben vor aller Kopfarbeit eine unbändige
Angst. Daß nun aber ein Kerl, der mit ledigen Postpferden, oder auf einem
losen Karrengaul, die engen Gassen einer volkreichen Stadt durchreitend,
mit einer klafterlangen Peitsche aus Leibeskräften unaufhörlich klatscht,
nicht verdiene, sogleich abzusitzen, um fünf aufrichtig gemeinte Stockprügel
zu empfangen, das werden mir alle Philanthropen der Welt, nebst den legislativen,
sämtliche Leibesstrafen, aus guten Gründen, abschaffenden Versammlungen,
nicht einreden. Aber etwas noch Stärkeres, als jenes, kann man oft genug
sehen, nämlich so einen Fuhrknecht, der allein und ohne Pferde, durch
die Straßen gehend, unaufhörlich klatscht: so sehr ist diesem Menschen
der Peitschenklatsch zur Gewohnheit geworden, infolge unverantwortlicher
Nachsicht. Soll denn, bei der so allgemeinen Zärtlichkeit für den Leib
und alle seine Befriedigungen, der denkende Geist das Einzige sein, was
nie die geringste Berücksichtigung, noch Schutz, geschweige Respekt erfährt?
Fuhrknechte, Sackträger, Eckensteher u. dgl. sind die Lasttiere der menschlichen
Gesellschaft; sie sollen durchaus human, mit Gerechtigkeit, Billigkeit,
Nachsicht und Vorsorge behandelt werden: aber ihnen darf nicht gestattet
sein, durch mutwilligen Lärm den höhern Bestrebungen des Menschengeschlechts
hinderlich zu werden. Ich möchte wissen, wie viel große und schöne
Gedanken diese Peitschen schon aus der Welt geknallt haben. Hätte ich
zu befehlen, so sollte in den Köpfen der Fuhrknechte ein unzerreißbarer
nexus idearum zwischen Peitschenklatschen und Prügelkriegen erzeugt werden.
— Wir wollen hoffen, daß die intelligenteren und feiner fühlenden
Nationen auch hierin den Anfang machen und dann, auf dem Wege des Beispiels,
die Deutschen ebenfalls dahin werden gebracht werden *). Von diesen sagt
inzwischen Thomas Hood (up the Rhine) for a musical people, they are the
most noisy I ever met with (für eine musikalische Nation, sind sie die
lärmendeste, welche mir je vorgekommen). Daß sie dies sind, liegt aber
nicht daran, daß sie mehr als andere zum Lärmen geneigt wären, sondern
an der aus Stumpfheit entspringenden Unempfindlichkeit derer, die es anzuhören
haben, als welche dadurch in keinem Denken oder Lesen gestört werden,
weil sie eben nicht denken, sondern bloß rauchen, als welches ihr Surrogat
für Gedanken ist. Die allgemeine Toleranz gegen unnötigen Lärm, z.
B. gegen das so höchst ungezogene und gemeine Thürenwerfen, ist geradezu
ein Zeichen der allgemeinen Stumpfheit und Gedankenleere der Köpfe. In
Deutschland ist es, als ob es ordentlich darauf angelegt wäre, daß,
vor Lärm, niemand zur Besinnung kommen solle: z. B. das zwecklose Trommeln.
Was nun endlich die Litteratur des in diesem Kapitel abgehandelten Gegenstandes
betrifft; so habe ich nur ein Werk, aber ein schönes, zu empfehlen, nämlich
eine poetische Epistel in Terzerimen, von dem berühmten Maler Bronzino,
betitelt De’ romori, a Messer Luca Martini: hier wird nämlich die Pein,
die man von dem mannigfaltigen Lärm einer italienischen Stadt auszustehn
hat, in tragikomischer Weise, ausführlich und sehr launig geschildert.
Man findet diese Epistel S. 258 des zweiten Bandes der Opere burlesche
del Berni, Aretino ed altri, angeblich erschienen in Utrecht, 1771.
*) Nach einer „Bekanntmachung des Münchener Tierschutzvereins“ vom
Dezember 1858 ist in Nürnberg das überflüssige Peitschen und Knallen
strengstens verboten.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Ueber Theismus.
Wie der Polytheismus die Personifikation einzelner Teile und Kräfte der
Natur ist, so ist der Monotheismus die der ganzen Natur, — mit einem
Schlage. —
Wenn ich aber suche, mir vorstellig zu machen, daß ich vor einem individuellen
Wesen stände, zu dem ich sagte: „Mein Schöpfer! ich bin einst nichts
gewesen: du aber hast mich hervorgebracht, so daß ich jetzt etwas und
zwar ich bin“; — und dazu noch: „ich danke dir für diese Wohlthat“;
— und am Ende gar: „wenn ich nichts getaugt habe, so ist das meine
Schuld“; — so muß ich gestehn, daß infolge philosophischer und indischer
Studien mein Kopf unfähig geworden ist, einen solchen Gedanken auszuhalten.
Derselbe ist übrigens das Seitenstück zu dem, welchen Kant uns vorführt
in der Kritik der reinen Vernunft (im Abschnitt von der Unmöglichkeit
eines kosmologischen Beweises): „Man kann sich des Gedankens nicht erwehren,
man kann ihn aber auch nicht ertragen: daß ein Wesen, welches wir uns
auch als das höchste unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu
sich selbst sage: Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, außer mir ist nichts,
ohne das, was bloß durch meinen Willen etwas ist: aber woher bin ich
denn?“ — Beiläufig gesagt, hat so wenig diese letzte Frage, als der
ganze eben angeführte Abschnitt, die Philosophieprofessoren seit Kant
abgehalten, zum beständigen Hauptthema alles ihres Philosophierens das
Absolutum zu machen, d. h. plan geredet, das was keine Ursach hat. Das
ist so recht ein Gedanke für sie. Ueberhaupt sind diese Leute unheilbar,
und ich kann nicht genugsam anraten, mit ihren Schriften und Vorträgen
keine Zeit zu verlieren.
Ob man sich ein Idol macht aus Holz, Stein, Metall, oder es zusammensetzt
aus abstrakten Begriffen, ist einerlei: es bleibt Idololatrie, sobald
man ein persönliches Wesen vor sich hat, dem man opfert, das man anruft,
dem man dankt. Es ist auch im Grunde so verschieden nicht, ob man seine
Schafe, oder seine Neigungen opfert. Jeder Ritus oder Gebet zeugt unwidersprechlich
von Idololatrie. Daher stimmen die mystischen Sekten aus allen Religionen
darin überein, daß sie allen Ritus für ihre Adepten aufheben.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Von dem menschlichen Wissen überhaupt, in jeder Art, existiert der allergrößte
Teil stets nur auf dem Papier, in den Büchern, diesem papiernen Gedächtnis
der Menschheit. Nur ein kleiner Teil desselben ist, in jedem gegebenen
Zeitpunkt, in irgendwelchen Köpfen wirklich lebendig. Dies entspringt
besonders aus der Kürze und Ungewißheit des Lebens, zudem aus der Trägheit
und Genußsucht der Menschen. Das jedesmalige schnell vorübereilende
Geschlecht erreicht vom menschlichen Wissen was es gerade braucht. Es
stirbt bald aus. Die meisten Gelehrten sind sehr oberflächlich. Nun folgt
ein neues hoffnungsvolles Geschlecht, welches von nichts weiß, sondern
alles von Anfang an zu lernen hat; davon nimmt es wieder, so viel es auffassen
oder auf seiner kurzen Reise gebrauchen kann, und geht ebenfalls ab. Wie
schlecht würde es also um das menschliche Wissen stehn, wenn Schrift
und Druck nicht wären. Daher sind die Bibliotheken allein das sichere
und bleibende Gedächtnis des menschlichen Geschlechts, dessen einzelne
Mitglieder alle nur ein sehr beschränktes, und unvollkommenes haben.
Daher lassen die meisten Gelehrten so ungern ihre Kenntnisse examinieren,
wie die Kaufleute ihre Handlungsbücher.
Das menschliche Wissen ist nach allen Seiten unabsehbar und von dem, was
überhaupt wissenswert wäre, kann kein einzelner auch nur den tausendsten
Teil wissen.
Demgemäß haben die Wissenschaften eine solche Breite der Ausdehnung
erlangt, daß wer etwas „darin leisten“ will, nur ein ganz spezielles
Fach betreiben darf, unbekümmert um alles andre. Alsdann wird er zwar
in seinem Fache über dem Vulgus stehn, in allem übrigen jedoch zu demselben
gehören. Kommt nun noch, wie heutzutage immer häufiger wird, die Vernachlässigung
der alten Sprachen, welche halb zu lernen nichts hilft, hinzu, wodurch
die allgemeine Humanitätsbildung wegfällt; so werden wir Gelehrte sehn,
die außerhalb ihres speziellen Faches wahre Ochsen sind. — Ueberhaupt
ist so ein exklusiver Fachgelehrter dem Fabrikarbeiter analog, der, sein
Leben lang, nichts andres macht, als eine bestimmte Schraube, oder Haken,
oder Handhabe, zu einem bestimmten Werkzeuge, oder Maschine, worin er
dann freilich eine unglaubliche Virtuosität erlangt. Auch kann man den
Fachgelehrten mit einem Manne vergleichen, der in seinem eigenen Hause
wohnt, jedoch nie herauskommt. In dem Hause kennt er alles genau, jedes
Treppchen, jeden Winkel und jeden Balken; etwan wie Victor Hugos Quasimodo
die Notredame-Kirche kennt: aber außerhalb desselben ist ihm alles fremd
und unbekannt. — Wahre Bildung zur Humanität hingegen erfordert durchaus
Vielseitigkeit und Ueberblick, also, für einen Gelehrten im höhern Sinne,
allerdings etwas Polyhistoria. Wer aber vollends ein Philosoph sein will,
muß in seinem Kopfe die entferntesten Enden des menschlichen Wissens
zusammenbringen: denn wo anders könnten sie jemals zusammenkommen? —
Geister ersten Ranges nun gar werden niemals Fachgelehrte sein. Ihnen,
als solchen, ist das Ganze des Daseins zum Problem gegeben und über dasselbe
wird jeder von ihnen, in irgend einer Form und Weise, der Menschheit neue
Aufschlüsse erteilen. Denn den Namen eines Genies kann nur der verdienen,
welcher das Ganze und Große, das Wesentliche und Allgemeine der Dinge
zum Thema seiner Leistungen nimmt, nicht aber wer irgend ein spezielles
Verhältnis von Dingen zu einander zurechtzulegen sein Leben lang bemüht
ist.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der Wille zum Leben, wie er den innersten Kern alles Lebenden ausmacht,
stellt sich am unverschleiertesten dar und läßt daher sich, seinem Wesen
nach, am deutlichsten beobachten und betrachten an den obersten, also
klügsten, Tieren. Denn unter dieser Stufe tritt er noch nicht so deutlich
hervor, hat einen mindern Grad der Objektivation; darüber aber, also
im Menschen, ist mit der Vernunft die Besonnenheit und mit dieser die
Fähigkeit zur Verstellung eingetreten, die alsbald einen Schleier über
ihn wirft. Hier tritt er daher nur noch in den Ausbrüchen der Affekte
und Leidenschaften unverhüllt hervor. Ebendeshalb aber findet allemal
die Leidenschaft, wann sie spricht, Glauben, gleichviel welche es sei,
und mit Recht. Aus demselben Grunde sind die Leidenschaften das Hauptthema
der Dichter und das Paradepferd der Schauspieler. — Auf dem zuerst Gesagten
aber beruht unsere Freude an Hunden, Affen, Katzen u. s. w.: die vollkommene
Naivetät aller ihrer Aeußerungen ist es, die uns so sehr ergötzt. —
Welchen eigentümlichen Genuß gewährt doch der Anblick jedes freien
Tieres, wenn es ungehindert für sich allein sein Wesen treibt, seiner
Nahrung nachgeht, oder seine Jungen pflegt, oder zu anderen seinesgleichen
sich gesellt u.s.w., dabei so ganz was es sein soll und kann. Und sei
es nur ein Vögelein, ich kann ihm lange mit Vergnügen zusehn; — ja
einer Wasserratte, einem Frosch: doch lieber einem Igel, einem Wiesel,
einem Reh oder Hirsch!
Daß uns der Anblick der Tiere so sehr ergötzt, beruht hauptsächlich
darauf, daß es uns freut, unser eigenes Wesen so sehr vereinfacht vor
uns zu sehn. —
Es gibt auf der Welt nur ein lügenhaftes Wesen: es ist der Mensch. Jedes
andere ist wahr und aufrichtig, indem es sich unverhohlen gibt als das,
was es ist, und sich äußert, wie es sich fühlt. Ein emblematischer,
oder allegorischer Ausdruck dieses Fundamentalunterschiedes ist, daß
alle Tiere in ihrer natürlichen Gestalt umhergehn, was viel beiträgt
zu dem so erfreulichen Eindruck ihres Anblicks, bei dem mir, zumal wenn
es freie Tiere sind, stets das Herz aufgeht; — während der Mensch durch
die Kleidung zu einem Fratz, einem Monstrum geworden ist, dessen Anblick
schon dadurch widerwärtig ist, und nun gar unterstützt wird durch die
ihm nicht natürliche weiße Farbe, und durch alle die ekelhaften Folgen
widernatürlicher Fleischnahrung, spirituoser Getränke, Tabaks, Ausschweifungen
und Krankheiten. Er steht da als ein Schandfleck in der Natur! — Die
Griechen beschränkten die Kleidung möglichst, weil sie es fühlten.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Zuverlässig verdankt mancher das Glück seines Lebens bloß dem Umstande,
daß er ein angenehmes Lächeln besitzt, womit er die Herzen gewinnt.
— Jedoch thäten die Herzen besser, sich in acht zu nehmen und aus Hamlets
Gedächtnistafel zu wissen, that one may smile, and smile, and be a villain
(daß einer lächeln und lächeln kann, und ein Schurke sein).
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der Wille, als das Ding an sich, ist der gemeinsame Stoff aller Wesen,
das durchgängige Element der Dinge: wir haben ihn sonach mit allen und
jedem Menschen, ja, mit den Tieren, und sogar noch weiter abwärts, gemein.
In ihm, als solchem, sind wir sonach jedem gleich; sofern alles und jedes
vom Willen erfüllt ist und davon strotzt. Dagegen ist das, was Wesen
über Wesen, Mensch über Mensch erhebt, die Erkenntnis. Deshalb sollten
unsere Aeußerungen, soviel als möglich, sich auf sie beschränken, und
nur sie sollte hervortreten. Denn der Wille als das durchaus Gemeinsame
ist eben auch das Gemeine. Demgemäß ist jedes heftige Hervortreten desselben
gemein: d. h. es setzt uns herab zu einem bloßen Beispiele und Exemplare
der Gattung: denn wir zeigen alsdann eben nur den Charakter derselben.
Gemein ist daher aller Zorn, unbändige Freude, aller Haß, alle Furcht,
kurz, jeder Affekt, d. h. jede Bewegung des Willens, wann sie so stark
wird, daß sie, im Bewußtsein, das Erkennen entschieden überwiegt und
den Menschen mehr als ein wollendes, denn als ein erkennendes Wesen erscheinen
läßt. Einem solchen Affekte hingegeben, wird das größte Genie dem
gemeinsten Erdensohne gleich. Wer hingegen schlechthin ungemein, also
groß sein will, darf nie die überwiegenden Bewegungen des Willens sein
Bewußtsein ganz einnehmen lassen, wie sehr auch er dazu sollicitiert
werde. Er muß z. B. die gehässige Gesinnung der andern wahrnehmen können,
ohne die seinige dadurch erregt zu fühlen: ja, es gibt kein sichereres
Merkmal der Größe, als kränkende oder beleidigende Aeußerungen unbeachtet
hingehn zu lassen, indem man sie, eben wie unzählige andere Irrtümer,
der schwachen Erkenntnis des Redenden ohne weiteres zuschreibt und daher
sie bloß wahrnimmt, ohne sie zu empfinden. Hieraus ist auch zu verstehn,
was Gracian sagt: „Nichts steht einem Manne übler an, als merken zu
lassen, daß er ein Mensch sei.“ (El mayor desdoro de un hombre es dar
muestras de que es hombre.)
Dem Gesagten gemäß hat man seinen Willen zu verbergen, eben wie seine
Genitalien; obgleich beide die Wurzel unsres Wesens sind; und soll man
bloß die Erkenntnis sehn lassen, wie sein Antlitz: bei Strafe gemein
zu werden.
Selbst im Drama, dessen Thema die Leidenschaften und Affekte ganz eigentlich
sind, erscheinen diese dennoch leicht gemein; wie dies besonders an den
französischen Tragikern bemerklich wird, als welche sich kein höheres
Ziel, als eben Darstellung der Leidenschaften, gesteckt haben und nun
bald hinter ein sich blähendes, lächerliches Pathos, bald hinter epigrammatische
Spitzreden die Gemeinheit der Sache zu verstecken suchen. Die berühmte
Demoiselle Rachel, als Maria Stuart, erinnerte mich, in ihrem Losbrechen
gegen die Elisabeth, so vortrefflich sie es auch machte, doch an ein Fischweib.
Auch verlor, in ihrer Darstellung, die letzte Abschiedsscene alles Erhebende,
d. i. alles wahrhaft Tragische, als wovon die Franzosen gar keinen Begriff
haben. Ohne allen Vergleich besser spielte dieselbe Rolle die Italienerin
Ristori, wie denn Italiener und Deutsche, trotz großer Verschiedenheit
in vielen Stücken, doch übereinstimmen im Gefühl für das Innige, Ernste
und Wahre in der Kunst, und dadurch in Gegensatz treten zu den Franzosen,
welchen jenes Gefühl ganz abgeht; was sich überall verrät. — Das
Edle, d. i. das Ungemeine, ja, das Erhabene, wird auch in das Drama allererst
durch das Erkennen, im Gegensatz des Wollens, hineingebracht, indem dasselbe
über allen jenen Bewegungen des Willens frei schwebt und sie sogar zum
Stoffe seiner Betrachtungen macht, wie dies besonders Shakespeare durchgängig
sehn läßt, zumal aber im Hamlet. Steigert nun gar die Erkenntnis sich
zu dem Punkte, wo ihr die Nichtigkeit alles Wollens und Strebens aufgeht
und infolge davon der Wille sich selbst aufhebt; dann erst wird das Drama
eigentlich tragisch, mithin wahrhaft erhaben und erreicht seinen höchsten
Zweck.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Wenn man wohl erwägt, wie groß und wie naheliegend das Problem des Daseins
ist, dieses zweideutigen, gequälten, flüchtigen, traumartigen Daseins;
— so groß und so naheliegend, daß, sobald man es gewahr wird, es alle
andern Probleme und Zwecke überschattet und verdeckt; — und wenn man
nun dabei vor Augen hat, wie alle Menschen, — einige wenige und seltene
ausgenommen, — dieses Problems sich nicht deutlich bewußt, ja, seiner
gar nicht inne zu werden scheinen, sondern um alles andere eher, als darum,
sich bekümmern, und dahinleben, nur auf den heutigen Tag und die fast
nicht längere Spanne ihrer persönlichen Zukunft bedacht, indem sie jenes
Problem entweder ausdrücklich ablehnen, oder hinsichtlich desselben sich
bereitwillig abfinden lassen mit irgend einem Systeme der Volksmetaphysik
und damit ausreichen; — wenn man, sage ich, das wohl erwägt; so kann
man der Meinung werden, daß der Mensch doch nur sehr im weitern Sinne
ein denkendes Wesen heiße, und wird fortan über keinen Zug von Gedankenlosigkeit,
oder Einfalt, sich sonderlich wundern, vielmehr wissen, daß der intellektuelle
Gesichtskreis des Normalmenschen zwar über den des Tieres, — dessen
ganzes Dasein, der Zukunft und der Vergangenheit sich nicht bewußt, gleichsam
eine einzige Gegenwart ist, — hinausgeht, aber doch nicht so unberechenbar
weit, wie man wohl anzunehmen pflegt.
Diesem entspricht es sogar, daß man auch im Gespräche die Gedanken der
meisten Menschen so kurz abgeschnitten findet, wie Häckerling, daher
kein längerer Faden sich herausspinnen läßt.
Auch könnte unmöglich, wenn diese Welt von eigentlich denkenden Wesen
bevölkert wäre, der Lärm jeder Art so unbeschränkt erlaubt und freigegeben
sein, wie sogar der entsetzlichste und dabei zwecklose es ist. — Wenn
nun aber gar schon die Natur den Menschen zum Denken bestimmt hätte;
so würde sie ihm keine Ohren gegeben, oder diese wenigstens, wie bei
den Fledermäusen, die ich darum beneide, mit luftdichten Schließklappen
versehen haben. In Wahrheit aber ist er, gleich den andern, ein armes
Tier, dessen Kräfte bloß auf die Erhaltung seines Daseins berechnet
sind, weshalb es der stets offenen Ohren bedarf, als welche, auch unbefragt
und bei Nacht wie bei Tage, die Annäherung des Verfolgers ankündigen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Sekten.
Der Augustinismus mit seinem Dogma von der Erbsünde und was sich daran
knüpft, ist, wie schon gesagt, das eigentliche und wohlverstandene Christentum.
Der Pelagianismus hingegen ist das Bemühen, das Christentum zum plumpen
und platten Judentum und seinem Optimismus zurückzubringen.
Den die Kirche beständig teilenden Gegensatz zwischen Augustinismus und
Pelagianismus könnte man, als auf seinen letzten Grund, darauf zurückführen,
daß ersterer vom Wesen an sich der Dinge, letzterer hingegen von der
Erscheinung redet, die er jedoch für das Wesen nimmt. Z. B. der Pelagianer
leugnet die Erbsünde; da das Kind, welches noch gar nichts gethan hat,
unschuldig sein müsse; — weil er nicht einsieht, daß zwar als Erscheinung
das Kind erst anfängt zu sein, nicht aber als Ding an sich. Ebenso steht
es mit der Freiheit des Willens, dem Versöhnungstode des Heilands, der
Gnade, kurz mit allem. — Infolge seiner Begreiflichkeit und Plattheit
herrscht der Pelagianismus immer vor: mehr als je aber jetzt, als Rationalismus.
Gemildert pelagianisch ist die griechische Kirche, und seit dem Concilio
Tridentino ebenfalls die katholische, die sich dadurch in Gegensatz zum
augustinisch und daher mystisch gesinnten Luther, wie auch zu Calvin,
hat stellen wollen: nicht weniger sind die Jesuiten semipelagianisch.
Hingegen sind die Jansenisten augustinisch und ihre Auffassung möchte
wohl die echteste Form des Christentums sein. Denn der Protestantismus
ist dadurch, daß er das Cölibat und überhaupt die eigentliche Askese,
wie auch deren Repräsentanten, die Heiligen, verwarf, zu einem abgestumpften,
oder vielmehr abgebrochenen Christentum geworden, als welchem die Spitze
fehlt: es läuft in nichts aus.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Glauben und Wissen.
Die Philosophie hat, als eine Wissenschaft, es durchaus nicht damit zu
thun, was geglaubt werden soll, oder darf; sondern bloß damit, was man
wissen kann. Sollte nun dieses auch etwas ganz anderes sein, als was man
zu glauben hat; so wäre selbst für den Glauben dies kein Nachteil: denn
dafür ist er Glaube, daß er lehrt, was man nicht wissen kann. Könnte
man es wissen; so würde der Glaube als unnütz und lächerlich dastehn;
etwan wie wenn hinsichtlich der Mathematik eine Glaubenslehre aufgestellt
würde.
Hiegegen ließe sich nun aber einwenden, daß zwar der Glaube immerhin
mehr, und viel mehr, als die Philosophie lehren könne; jedoch nichts
mit den Ergebnissen dieser Unvereinbares: weil nämlich das Wissen aus
einem härteren Stoff ist, als der Glaube, so daß, wenn sie gegeneinander
stoßen, dieser bricht.
Jedenfalls sind beide von Grund aus verschiedene Dinge, die, zu ihrem
beiderseitigen Wohl, streng geschieden bleiben müssen, so daß jedes
seinen Weg gehe, ohne vom andern auch nur Notiz zu nehmen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
So sehr ich auch die religiösen und philosophischen Werke der Sanskritlitteratur
verehre; so habe ich dennoch an den poetischen nur selten einiges Wohlgefallen
finden können; sogar hat es mich zuzeiten bedünken wollen, diese wären
so geschmacklos und monstros, wie die Skulptur derselben Völker. Selbst
ihre dramatischen Werke schätze ich hauptsächlich nur wegen der sehr
belehrenden Erläuterungen und Belege des religiösen Glaubens und der
Sitten, die sie enthalten. Dies alles mag daran liegen, daß Poesie, ihrer
Natur nach, unübersetzbar ist. Denn in ihr sind Gedanken und Worte so
innig und fest miteinander verwachsen, wie pars uterina et pars foetalis
placentae; so daß man nicht, ohne jene zu affizieren, diesen fremde substituieren
kann. Ist doch alles Metrische und Gereimte eigentlich von Hause aus ein
Kompromiß zwischen dem Gedanken und der Sprache: dieses aber darf, seiner
Natur nach, nur auf dem eigenen, mütterlichen Boden des Gedankens vollzogen
werden, nicht auf einem fremden, dahin man ihn verpflanzen möchte, und
gar auf einem so unfruchtbaren, wie die Uebersetzerköpfe in der Regel
sind. Was überhaupt kann entgegengesetzter sein, als die freie Ergießung
der Begeisterung eines Dichters, die schon von selbst und instinktiv in
Metrum und Reim gekleidet an den Tag tritt, und die peinliche, rechnende,
kalte, Silben zählende und Reime suchende Qual des Uebersetzers. Da nun
überdies in Europa an poetischen, uns direkt ansprechenden Werken kein
Mangel ist, gar sehr aber an richtigen metaphysischen Einsichten, so bin
ich der Meinung, daß die Uebersetzer aus dem Sanskrit ihre Mühe viel
weniger der Poesie und viel mehr den Veden, Upanischaden und philosophischen
Werken zuwenden sollten.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Statt die Wahrheit der Religionen als sensu allegorico zu bezeichnen,
könnte man sie, wie eben auch die Kantische Moraltheologie, Hypothesen
zu praktischem Zwecke, oder hodegetische Schemata nennen, Regulative,
nach Art der physikalischen Hypothesen von Strömungen der Elektrizität,
zur Erklärung des Magnetismus, oder von Atomen zur Erklärung der chemischen
Verbindungsproportionen u. s. w.)*), welche man sich hütet, als objektiv
wahr festzustellen, jedoch davon Gebrauch macht, um die Erscheinungen
in Verbindung zu setzen, da sie in Hinsicht auf das Resultat und das Experimentieren
ungefähr dasselbe leisten, als die Wahrheit selbst. Sie sind Leitsterne
für das Handeln und die subjektive Beruhigung beim Denken. —
Die Religionen erfüllen und beherrschen die Welt und der große Haufe
der Menschheit gehorcht ihnen. Daneben geht langsam die stille Succession
der Philosophen, welche für die wenigen, durch Anlage und Bildung dazu
befähigten, an der Enträtselung des großen Geheimnisses arbeiten. Im
Durchschnitt bringt jedes Jahrhundert einen heran: dieser wird, sobald
er als echt befunden worden, stets mit Jubel empfangen und mit Aufmerksamkeit
angehört.
Für den großen Haufen sind die einzigen faßlichen Argumente Wunder;
daher alle Religionsstifter deren verrichten. —
Die Theologen suchen die Wunder der Bibel bald zu allegorisieren, bald
zu naturalisieren, um sie irgendwie loszuwerden: denn sie fühlen, daß
miraculum sigillum mendacii. —
Religionsurkunden enthalten Wunder, zur Beglaubigung ihres Inhalts: aber
es kommt eine Zeit heran, wo sie das Gegenteil bewirken. —
Was für ein schlechtes Gewissen die Religion haben muß, ist daran zu
ermessen, daß es bei so schweren Strafen verboten ist, über sie zu spotten.
—
Unter dem vielen Harten und Beklagenswerten des Menschenloses ist keines
der geringsten dieses, daß wir da sind, ohne zu wissen, woher, wohin
und wozu: wer eben vom Gefühl dieses Uebels ergriffen und durchdrungen
ist, wird kaum umhin können, einige Erbitterung zu verspüren gegen diejenigen,
welche vorgeben, Spezialnachrichten darüber zu haben, die sie unter dem
Namen von Offenbarungen uns mitteilen wollen. —
Den Herren von der Offenbarung möchte ich raten, heutzutage nicht so
viel von der Offenbarung zu reden; sonst ihnen leicht einmal offenbart
werden könnte, was eigentlich die Offenbarung ist. —
Eine Religion, die zu ihrem Fundament eine einzelne Begebenheit hat, ja
aus dieser, die sich da und da, dann und dann zugetragen, den Wendepunkt
der Welt und alles Daseins machen will, hat ein so schwaches Fundament,
daß sie unmöglich bestehn kann, sobald einiges Nachdenken unter die
Leute gekommen. Wie weise ist dagegen im Buddhaismus die Annahme der tausend
Buddhas! damit es nicht sich ausnehme, wie im Christentum, wo Jesus Christus
die Welt erlöst hat und außer ihm kein Heil möglich ist, — aber viertausend
Jahre, deren Denkmale in Aegypten, Asien und Europa groß und herrlich
dastehn, nichts von ihm wissen konnten und jene Zeitalter mit aller ihrer
Herrlichkeit unbesehens zum Teufel fuhren! Die vielen Buddhas sind notwendig,
weil am Ende jedes Kalpas die Welt untergeht und mit ihr die Lehre, also
eine neue Welt einen neuen Buddha verlangt. Das Heil ist immer da. —
Daß die Zivilisation unter den christlichen Völkern am höchsten steht,
liegt nicht daran, daß das Christentum ihr günstig, sondern daran, daß
es abgestorben ist und wenig Einfluß mehr hat: solange es ihn hatte,
war die Zivilisation weit zurück: im Mittelalter. Hingegen haben Islam,
Brahmanismus und Buddhaismus noch durchgreifenden Einfluß aufs Leben:
in China noch am wenigsten, daher die Zivilisation der europäischen ziemlich
gleichkommt. Alle Religion steht im Antagonismus mit der Kultur. —
Die europäischen Regierungen verbieten jeden Angriff auf die Landesreligion.
Sie selbst aber schicken Missionarien in brahmanische und buddhaistische
Länder, welche die dortigen Religionen eifrig und von Grund aus angreifen,
— ihrer importierten Platz zu machen. Und dann schreien sie Zeter, wenn
einmal ein chinesischer Kaiser oder Großmandarin von Tunkin solchen Leuten
die Köpfe abschlägt. —
*) Sogar die Pole, Aequator und Parallelen auf dem Firmament sind dieser
Art: am Himmel ist nichts dergleichen: er dreht sich nicht.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der moralische Sinn der Metempsychose, in allen indischen Religionen,
ist nicht bloß, daß wir jedes Unrecht, welches wir verüben, in einer
folgenden Wiedergeburt abzubüßen haben; sondern auch, daß wir jedes
Unrecht, welches uns widerfährt, ansehn müssen als wohlverdient, durch
unsere Missethaten in einem frühern Dasein.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Ihr spottet über die Aeonen und Kalpas des Buddhaismus! — Das Christentum
freilich hat einen Standpunkt eingenommen, von dem aus es eine Spanne
Zeit überblickt; der Buddhaismus einen, von dem aus die Unendlichkeit
in Zeit und Raum sich ihm darstellt und sein Thema wird. —
Wie die Lalitavistara, anfangs ziemlich einfach und natürlich, in jeder
neuen Redaktion, wie sie eine solche in jedem der folgenden Konzilien
erfuhr, komplizierter und wunderbarer wurde; ebenso ist es dem Dogma selbst
ergangen, dessen wenige, einfache und großartige Lehrsätze, durch nähere
Ausführungen, räumliche und zeitliche Darstellungen, Personifikationen,
empirische Lokalisationen u. s. w. allmählich bunt, kraus und kompliziert
wurden; weil der Geist des großen Haufens es so liebt, indem er phantastische
Beschäftigung haben will und sich am Einfachen und Abstrakten nicht genügen
läßt.
Die brahmanistischen Dogmen und Distinktionen vom Brahm und Brahmâ, von
Paramatma und Djiwatma, Hiranya-Garbha, Pradjapati, Puruscha, Prakriti
u. dgl. m. (wie man sie sehr gut in der Kürze dargelegt findet in Obrys
vortrefflichem Buche du Nirvana Indien 1856) sind im Grunde bloß mythologische
Fiktionen, gemacht in der Absicht, dasjenige objektiv darzustellen, was
wesentlich und schlechterdings nur ein subjektives Dasein hat; daher eben
Buddha sie hat fallen lassen und nichts kennt, als Sansara und Nirwana.
Denn je krauser, bunter und komplizierter die Dogmen wurden, desto mythologischer.
Am besten versteht es der Yogui oder Saniassi, welcher methodisch sich
zurechtsetzend, alle seine Sinne in sich zurückzieht, die ganze Welt
vergißt und sich selbst dazu: — was alsdann noch in seinem Bewußtsein
übrig bleibt, ist das Urwesen. Nur daß die Sache leichter gesagt, als
gethan ist. —
Der versunkene Zustand der einst so hochgebildeten Hindu ist die Folge
der entsetzlichen Unterdrückung, welche sie, 700 Jahre hindurch, von
den Mohammedanern erlitten haben, die sie gewaltsam zum Islam bekehren
wollten. — Jetzt ist nur ein Achtel der Bevölkerung Indiens mohammedanisch.
(Edinb. review, Jan. 1858.)*)
*) Es ist wahrscheinlich, daß gerade so entfernt verwandt, wie das Griechische
und Lateinische dem Sanskrit, auch die Mythologie der Griechen und Römer
der indischen ist, und beiden die ägyptische. Zeus, Poseidon und Hades
sind vielleicht Brahma, Wischnu und Schiwa: dieser letztere hat einen
Dreizack, dessen Zweck beim Poseidon unerklärt ist. Der Nilschlüssel,
crux ansata, Zeichen der Venus ♀ ist genau Lingam und Yoni der Schiwaiten.
Osiris oder Isiris ist vielleicht Isvara, Herr und Gott. — Den Lotus
verehrten Aegypter und Inder. —
Sollte nicht Janus (Schellings Erklärung des Janus [in der Berlin. Akad.]
ist, daß er „das Chaos als Ureinheit“ bedeutet. — Eine viel gründlichere
gibt Walz De religione Romanorum antiquissima, — [im Programm der Tübinger
Universität] 1845) der Todesgott Yama sein, der zwei Gesichter hat, und
bisweilen vier. Zur Kriegszeit sind die Pforten des Todes geöffnet. Und
wäre vielleicht Pradjapati Japetos? —
Die Göttin Anna Purna der Hindu (Langlès, Monum. d. l’Inde, Vol. II,
p. 107) ist gewiß die Anna Perenna der Römer. Dies ist längst bemerkt
und erörtert Asiat. research. VIII, p. 69—73. — Baghis, ein Beiname
des Schiwa, erinnert an den Seher Bakis. (Daselbst Vol. I, 178.) In der
Sakontala (Akt 6, Schluß S. 131) kommt Divespetir als Beiname Indras
vor: offenbar Diespiter. — Schon gesagt: Asiat. res. Vol. I, p. 241.
Für die Identität des Buddha mit dem Wodan spricht sehr, daß (nach
Langlès, Monum., Vol. II) der Mittwoch (Wodans-day) dem ☿ und dem Buddha
heilig ist. — Korban, im Oupnekhat sacrificium, kommt vor Markus 7,
11: κορβαν (ό έστι δωρον), lat.: corban, i. e. munus Deo
dicatum. — Das Wichtigste aber ist folgendes. Der Planet ☿ ist dem
Buddha heilig, wird gewissermaßen mit ihm identifiziert und der Mittwoch
ist Buddhas Tag. Nun ist aber Merkur der Sohn der Maja, und Buddha der
Sohn der Königin Maja. Das kann nicht Zufall sein. „Hier“, sagen
die Schwaben, „liegt ein Spielmann begraben.“ Siehe jedoch Manual
of Buddhism, p. 354, note und Asiat. res. Vol. I, p. 162. —
Spence Hardy (On eastern monachism p. 122) berichtet, daß die bei einer
gewissen Feierlichkeit den Priestern zu schenkenden Talare in einem Tage
gewoben und verfertigt sein müssen: das Gleiche berichtet Herodot II,
c. 122, von einem bei einer feierlichen Gelegenheit einem Priester gereichten
Gewande. —
Der Autochthon der Deutschen ist Mannus, sein Sohn ist Thuiskon: — im
Oupnekhat (Bd. 2, S. 347 und Bd. 1, S. 96) heißt der erste Mensch Man.
—
Bekanntlich ist Satyavrati identisch mit Menu oder Manu, — wie andererseits
mit Noa. Nun heißt der Vater des Samson (Buch der Richter, Kap. 13) Manoe:
— also Manu, Manoe, Noa: die Septuaginta schreibt Μανωέ und Νωε.
Sollte nicht Noe geradezu Manoe, mit Weglassung der ersten Silbe sein?
—
Bei den Hetruriern hieß Jupiter Tina (Moreau de Jonès, à l'acad. d.
sc. mor. et polit., Dec. 1850). Sollte dies mit dem chinesischen Tien
zusammenhängen? Hatten doch die Hetrurier die Anna Perenna der Hindu.
Alle diese Analogien sind gründlichst untersucht von Wilford und von
Burr, in den Asiat. researches.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der Name Pelasger, ohne Zweifel mit Pelagus verwandt, ist die allgemeine
Bezeichnung für die vereinzelten, verdrängten, verirrten, kleinen asiatischen
Stämme, welche zuerst nach Europa gelangten, woselbst sie ihre heimatliche
Kultur, Tradition und Religion bald gänzlich vergaßen, dagegen aber,
begünstigt durch den Einfluß des schönen, gemäßigten Klimas und guten
Bodens, wie auch der vielen Seeküsten Griechenlands und Kleinasiens,
aus sich selbst, unter dem Namen der Hellenen, eine ganz naturgemäße
Entwickelung und rein menschliche Kultur erlangten, in einer Vollkommenheit,
wie solche außerdem nie und nirgends vorgekommen ist. Dieser gemäß
hatten sie auch keine andere, als eine halb scherzhaft gemeinte Kinderreligion:
der Ernst flüchtete sich in die Mysterien und das Trauerspiel. Dieser
griechischen Nation ganz allein verdanken wir die richtige Auffassung
und naturgemäße Darstellung der menschlichen Gestalt und Gebärde, die
Auffindung der allein regelrechten und von ihnen auf immer festgestellten
Verhältnisse der Baukunst, die Entwickelung aller echten Formen der Poesie,
nebst Erfindung der wirklich schönen Silbenmaße, die Aufstellung philosophischer
Systeme, nach allen Grundrichtungen des menschlichen Denkens, die Elemente
der Mathematik, die Grundlagen einer vernünftigen Gesetzgebung und überhaupt
die normale Darstellung einer wahrhaft schönen und edlen menschlichen
Existenz. Denn dieses kleine auserwählte Volk der Musen und Grazien war,
sozusagen, mit einem Instinkt der Schönheit ausgestattet. Dieser erstreckte
sich auf alles: auf Gesichter, Gestalten, Stellungen, Gewänder, Waffen,
Gebäude, Gefäße, Geräte und was noch sonst war, und verließ sie nie
und nirgends. Daher werden wir stets uns ebensoweit vom guten Geschmack
und der Schönheit entfernt haben, als wir uns von den Griechen entfernen;
zu allermeist in Skulptur und Baukunst; und nie werden die Alten veralten.
Sie sind und bleiben der Polarstern für alle unsere Bestrebungen, sei
es in der Litteratur, oder in der bildenden Kunst, den wir nie aus den
Augen verlieren dürfen. Schande wartet des Zeitalters, welches sich vermessen
möchte, die Alten beiseite zu setzen. Wenn daher irgend eine verdorbene,
erbärmliche und rein materiell gesinnte „Jetztzeit“ ihrer Schule
entlaufen sollte, um im eigenen Dünkel sich behaglicher zu fühlen, so
säet sie Schande und Schmach*).
Dagegen stehn die Griechen in den mechanischen und technischen Künsten,
wie auch in allen Zweigen der Naturwissenschaft, weit hinter uns zurück;
weil diese Dinge eben mehr Zeit, Geduld, Methode und Erfahrung, als hohe
Geisteskräfte erfordern. Daher auch ist aus den meisten naturwissenschaftlichen
Werken der Alten für uns wenig mehr zu lernen, als was doch alles sie
nicht gewußt haben. Wer wissen will, wie unglaublich weit die Unwissenheit
der Alten in der Physik und Physiologie ging, lese die problemata Aristotelis:
sie sind ein wahres specimen ignorantiae veterum. Zwar sind die Probleme
meistens richtig und zum Teil fein aufgefaßt: aber die Lösungen sind
größtenteils erbärmlich, weil er keine andern Elemente der Erklärung
kennt, als nur immer το ϑερμον και φυχρον, το ξηρον
και δγρον.
*) Die Griechen waren, wie die Germanen, ein aus Asien eingewanderter
Stamm, — Horde; und beide haben, von ihrer Heimat entfernt, sich ganz
aus eigenen Mitteln herangebildet. Aber was wurden die Griechen, und was
die Germanen! — Man vergleiche z. B. nur die Mythologie beider: denn
auf diese setzten die Griechen später ihre Poesie und Philosophie, —
ihre ersten Erzieher waren die alten Sänger, Orpheus, Musäus, Amphion,
Linus, zuletzt Homer. Auf diese folgten die sieben Weisen und endlich
kamen die Philosophen. So gingen die Griechen gleichsam durch die drei
Klassen ihrer Schule — wovon bei den Germanen (vor der Völkerwanderung)
keine Rede ist.
Auf den Gymnasien sollte keine altdeutsche Litteratur, Nibelungen und
sonstige Poeten des Mittelalters gelehrt werden: diese Dinge sind zwar
höchst merkwürdig, auch lesenswert, tragen aber nicht zur Bildung des
Geschmacks bei und rauben die Zeit, welche der alten, wirklich klassischen
Litteratur angehört. Wenn ihr, edle Germanen und deutsche Patrioten,
an die Stelle der griechischen und römischen Klassiker altdeutsche Reimereien
setzt; so werdet ihr nichts anderes, als Bärenhäuter erziehn. Nun aber
gar diese Nibelungen mit der Ilias zu vergleichen ist eine rechte Blasphemie,
mit welcher die Ohren der Jugend, vor allem, verschont bleiben sollten.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der Sturz der Titanen, welche Zeus hinabdonnert in die Unterwelt, scheint
dieselbe Geschichte zu sein mit dem Sturz der gegen den Jehovah rebellischen
Engel.
Die Geschichte des Idomeneus, der ex voto seinen Sohn opfert, und die
des Jephtha ist im wesentlichen dieselbe.
Ob nicht, wie im Sanskrit die Wurzel der gotischen, wie der griechischen
Sprache liegt, es eine ältere Mythologie gibt, aus der die griechische,
wie die jüdische Mythologie entsprungen ist? Man könnte sogar, wenn
man dem Witz Spielraum gestatten wollte, anführen, daß die verdoppelt
lange Nacht, in welcher Zeus mit der Alkmene den Herakles zeugte, dadurch
entstand, daß weiter östlich Josua vor Jericho die Sonne stillstehen
hieß. Zeus und Jehovah spielten so einander in die Hände: denn die Götter
des Himmels sind, wie die irdischen, allezeit im stillen befreundet. Aber
wie unschuldig war die Kurzweil des Vaters Zeus im Vergleich mit dem blutdürstigen
Treiben des Jehovah und seines auserwählten Räubervolks.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der „Kampf des Menschen mit dem Schicksal“, welchen unsere faden,
hohlen, verblasenen und ekelhaft süßlichen modernen Aesthetiker, seit
etwan fünfzig Jahren, wohl einstimmig, als das allgemeine Thema des Trauerspiels
aufstellen, hat zu seiner Voraussetzung die Freiheit des Willens, diese
Marotte aller Ignoranten, und dazu wohl auch noch den kategorischen Imperativ,
dessen moralische Zwecke, oder Befehle, dem Schicksale zum Trotz, nun
durchgesetzt werden sollen; woran dann die besagten Herren ihre Erbauung
finden. Zudem aber ist jenes vorgebliche Thema des Trauerspiels schon
darum ein lächerlicher Begriff, weil es der Kampf mit einem unsichtbaren
Gegner, einem Kämpen in der Nebelkappe, wäre, gegen den daher jeder
Schlag ins Leere geführt würde und dem man sich in die Arme würfe,
indem man ihm ausweichen wollte, wie ja dies dem Lajus und dem Oedipus
begegnet ist. Dazu kommt, daß das Schicksal allgewaltig ist, daher mit
ihm zu kämpfen die lächerlichste aller Vermessenheiten wäre, so daß
Byron vollkommen recht hat zu sagen:
To strive, too, with our fate were such a strife
As if the corn-sheaf should oppose the sickle.
(Zudem wäre, gegen unser Schicksal anzukämpfen, ein Kampf, wie wenn
die Garbe sich der Sichel widersetzen wollte.) D. Juan V.17.
So versteht die Sache auch Shakespeare:
Fate, show thy force: ourselves we do not owe;
What is decreed must be, and be this so!
Twelfth night A. I, the close.
Welcher Vers (beiläufig gesagt) zu den höchst seltenen gehört, die
in der Uebersetzung gewinnen:
„Jetzt kannst du deine Macht, o Schicksal, zeigen:
Was sein soll, muß geschehn, und keiner ist sein eigen.“
Bei den Alten ist der Begriff des Schicksals der einer im Ganzen der Dinge
verborgenen Notwendigkeit, welche, ohne alle Rücksicht, weder auf unsere
Wünsche und Bitten, noch auf Schuld oder Verdienst, die menschlichen
Angelegenheiten leitet und an ihrem geheimen Bande auch die äußerlich
voneinander unabhängigen Dinge zieht, um sie zu bringen, wohin sie will;
so daß deren offenbar zufälliges Zusammentreffen ein im höheren Sinne
notwendiges ist. Wie nun, vermöge dieser Notwendigkeit, alles vorherbestimmt
ist (fatum); so ist auch ein Vorherwissen desselben möglich, durch Orakel,
Seher, Träume u.s.w.
Die Vorsehung ist das christianisierte Schicksal, also das in die auf
das Beste der Welt gerichtete Absicht eines Gottes verwandelte.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
So stehe denn hier zum Schlusse noch meine sehr subtile und höchst seltsame
allegorische Deutung eines bekannten, besonders durch Apulejus verherrlichten
Mythos; obwohl sie, ihres Stoffes halber, dem Spotte aller derer bloßliegt,
die das du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas sich dabei zu nutze
machen wollen.
Vom Gipfelpunkte meiner Philosophie, welcher bekanntlich der asketische
Standpunkt ist, aus gesehn, konzentriert die Bejahung des Willens zum
Leben sich im Zeugungsakt und dieser ist ihr entschiedenster Ausdruck.
Die Bedeutung dieser Bejahung nun aber ist eigentlich diese, daß der
Wille, welcher ursprünglich erkenntnislos, also ein blinder Drang ist,
nachdem ihm, durch die Welt als Vorstellung, die Erkenntnis seines eigenen
Wesens aufgegangen und geworden ist, hiedurch in seinem Wollen und seiner
Sucht sich nicht stören oder hemmen läßt, sondern nunmehr, bewußt
und besonnen, eben das will, was er bis dahin als erkenntnisloser Trieb
und Drang gewollt hat. (Siehe Welt als W. u. V. Bd. 1, § 54; Bd. 3, S.
127 ff. dieser Gesamtausgabe.) Diesem gemäß nun finden wir, daß der,
durch freiwillige Keuschheit, das Leben asketisch Verneinende von dem,
durch Zeugungsakte, dasselbe Bejahenden empirisch dadurch sich unterscheidet,
daß bei jenem ohne Erkenntnis und als blinde, physiologische Funktion,
nämlich im Schlafe, das vor sich geht, was von diesem mit Bewußtsein
und Besonnenheit vollbracht wird, also beim Lichte der Erkenntnis geschieht.
Nun ist es in der That sehr merkwürdig, daß dieses abstrakte und dem
Geiste der Griechen keineswegs verwandte Philosophem, nebst dem es belegenden
empirischen Hergang, seine genaue allegorische Darstellung hat an der
schönen Fabel von der Psyche, welche den Amor nur ohne ihn zu sehn genießen
sollte, jedoch, damit nicht zufrieden, ihn, aller Warnungen ungeachtet,
durchaus auch sehn gewollt hat, wodurch sie, nach einem unabwendbaren
Ausspruch geheimnisvoller Mächte, in grenzenloses Elend geriet, welches
nur durch eine Wanderung in die Unterwelt, nebst schweren Leistungen daselbst
abgebüßt werden konnte.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Beim Schachspiel ist der Zweck (den Gegner matt zu machen) willkürlich
angenommen, die Mittel dazu sind in breiter Möglichkeit gegeben, die
Schwierigkeit ist offenbar, und je nachdem wir die Mittel klüglich benutzen,
werden wir zum Ziel kommen. Man entriert das Spiel beliebig.
Ganz ebenso ist es mit dem Menschenleben, nur daß man nicht beliebig,
sondern gezwungen entriert, und der Zweck (Leben und Dasein) uns zwar
zuzeiten als ein willkürlich angenommener erscheint, den man auch allenfalls
aufgeben könnte, aber doch eigentlich ein natürlicher ist, d. h. den
man nicht aufgeben kann, ohne seine eigne Natur aufzugeben. Denken wir
unser Dasein als das Werk fremder Willkür, so müssen wir die schlaue
Schalkheit des schaffenden Geistes bewundern, der es gelang, uns einen
momentanen und notwendig sehr bald beiseite zu legenden Zweck, dessen
Nichtigkeit sogar notwendig der Reflexion deutlich wird, Leben und Dasein,
so angelegen zu machen, daß wir, mit größtem Ernst darauf hinarbeitend,
alle Kräfte ins Spiel setzen, obwohl wir wissen, daß sobald die Partie
zu Ende ist, der Zweck für uns nicht mehr existiert und wir im ganzen
nicht angeben können, was uns den Zweck so angelegen macht, sondern dies
so beliebig angenommen scheint, als der Zweck, dem fremden König Schach
zu bieten, wir jedoch immer nur auf die Mittel bedacht, über den Zweck
nicht weiter sinnen und brüten: dies ist offenbar dadurch erreicht, daß
unsre Erkenntnis bloß fähig ist, nach außen und durchaus nicht nach
innen zu sehn, worein wir uns, weil es einmal nicht anders ist, ein für
allemal gefunden haben.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
Nach Welt-Anfang und -Ende, Zustand vor und nach dem Tode u. s. w. fragen,
worin der Zweck fast alles Philosophierens vor Kant bestand, und wozu
uns allerdings die bloße Vernunft treibt: — dies ist das widersprechende
Beginnen, das Ding an sich nach den Gesetzen der Erscheinung erkennen
zu wollen: die Sonderung und Erkenntnis beider ist die wahre Philosophie.
Alle Mythen vom Zustande nach dem Tode, von Vergeltung und Strafe, alle
Religionen, sind solche Versuche, das Ding an sich nach den Gesetzen der
Erscheinung zu konstruieren: nach einer solchen Konstruktion wäre die
Welt eine Frucht, deren dicke Schale ihre ganze Masse ausmachte, ohne
Fleisch und Kern. So gut gemeint solche Mythen, ja zweckdienlich und ersprießlich
sie sein mögen: sie sind doch für den Philosophen was chinesische Götzen
dem Phidias wären. Und auch die Wahrheit hat ihre Rechte.
Arthur Schopenhauer 1788 - 1860
[...] Man hat geschrieen über das Melancholische und Trostlose meiner
Philosophie: es liegt jedoch bloß darin, daß ich, statt als Aequivalent
der Sünden eine künftige Hölle zu fabeln, nachwies, daß wo die Schuld
liegt, in der Welt, auch schon etwas Höllenartiges sei: wer aber dieses
leugnen wollte, — kann es leicht einmal erfahren.
Und dieser Welt, diesem Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen,
welche nur dadurch bestehen, daß eines das andere verzehrt, wo daher
jedes reißende Tier das lebendige Grab tausend anderer und seine Selbsterhaltung
eine Kette von Martertoden ist, wo sodann mit der Erkenntnis die Fähigkeit
Schmerz zu empfinden wächst, welche daher im Menschen ihren höchsten
Grad erreicht und einen um so höheren, je intelligenter er ist, —
dieser Welt hat man das System des Optimismus anpassen und sie uns als
die beste unter den möglichen andemonstrieren wollen. Die Absurdität
ist schreiend. — Inzwischen heißt ein Optimist mich die Augen öffnen
und hineinsehen in die Welt, wie sie so schön sei, im Sonnenschein, mit
ihren Bergen, Thälern, Strömen, Pflanzen, Tieren u. s. f. — Aber ist
denn die Welt ein Guckkasten? Zu sehen sind diese Dinge freilich schön;
aber sie zu sein ist ganz etwas anderes. — Dann kommt ein Teleolog und
preist mir die weise Einrichtung an, vermöge welcher dafür gesorgt sei,
daß die Planeten nicht mit den Köpfen gegeneinander rennen, Land und
Meer nicht zum Brei gemischt, sondern hübsch auseinander gehalten seien,
auch nicht alles in beständigem Froste starre, noch von Hitze geröstet
werde, imgleichen, infolge der Schiefe der Ekliptik, kein ewiger Frühling
sei, als in welchem nichts zur Reife gelangen könnte, u. dgl. m. —
Aber dieses und alles Aehnliche sind ja bloße conditiones sine quibus
non. Wenn es nämlich überhaupt eine Welt geben soll, wenn ihre Planeten
wenigstens so lange, wie der Lichtstrahl eines entlegenen Fixsterns braucht,
um zu ihnen zu gelangen, bestehen und nicht, wie Lessings Sohn, gleich
nach der Geburt wieder abfahren sollen; — da durfte sie freilich nicht
so ungeschickt gezimmert sein, daß schon ihr Grundgerüst den Einsturz
drohte. Aber wenn man zu den Resultaten des gepriesenen Werkes fortschreitet,
die Spieler betrachtet, die auf der so dauerhaft gezimmerten Bühne agieren,
und nun sieht, wie mit der Sensibilität der Schmerz sich einfindet und
in dem Maße, wie jene sich zur Intelligenz entwickelt, steigt, wie sodann,
mit dieser gleichen Schritt haltend, Gier und Leiden immer stärker hervortreten
und sich steigern, bis zuletzt das Menschenleben keinen andern Stoff darbietet,
als den zu Tragödien und Komödien, — da wird, wer nicht heuchelt,
schwerlich disponiert sein, Hallelujahs anzustimmen. Den eigentlichen,
aber verheimlichten Ursprung dieser letzteren hat übrigens, schonungslos,
aber mit siegender Wahrheit, David Hume aufgedeckt, in seiner Natural
history of religion, Sect. 6, 7, 8 and 13. Derselbe legt auch im zehnten
und elften Buch seiner Dialogues on natural religion, unverhohlen, mit
sehr triftigen und dennoch ganz anderartigen Argumenten als die meinigen,
die trübselige Beschaffenheit dieser Welt und die Unhaltbarkeit alles
Optimismus dar; wobei er diesen zugleich in seinem Ursprung angreift.
Beide Werke Humes sind so lesenswert, wie sie in Deutschland heutzutage
unbekannt sind, wo man dagegen, patriotisch, am ekelhaften Gefasel einheimischer,
sich spreizender Alltagsköpfe unglaubliches Genügen findet und sie als
große Männer ausschreit. Jene Dialogues aber hat Hamann übersetzt,
Kant hat die Uebersetzung durchgesehen und noch im späten Alter Hamanns
Sohn zur Herausgabe derselben bewegen wollen, weil die von Platner ihm
nicht genügte (siehe Kants Biographie von F. W. Schubert, S. 81 und 165).
— Aus jeder Seite von David Hume ist mehr zu lernen, als aus Hegels,
Herbarts und Schleiermachers sämtlichen philosophischen Werken zusammengenommen.
[...]
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Alle wirklich tiefen Denker aller Zeiten, so verschieden auch ihre sonstigen
Ansichten sein mochten, stimmten darin überein, daß sie die Nothwendigkeit
der Willensacte bei eintretenden Motiven behaupteten und die Willensfreiheit
(das liberum arbitrium indifferentiae) verwarfen, während die oberflächlichen
Geister mit dem großen Haufen der Willensfreiheit anhängen. Hobbes zuerst,
dann Spinoza, dann Hume, auch Hollbach im Système de la nature, und endlich
am ausführlichsten und gründlichsten Priestley, haben die vollkommene
und strenge Nothwendigkeit der Willensacte bei eintretenden Motiven so
deutlich bewiesen, daß sie den vollkommen demonstrirten Wahrheiten beizuzählen
ist. Und nicht bloß große Philosophen, sondern auch große Theologen,
wie Augustinus und Luther, und große Dichter, wie Shakespeare, Göthe,
Schiller, haben diese Wahrheit gelehrt, so daß nur noch Unwissende und
Rohe von einer Freiheit des Menschen in den einzelnen Handlungen zu reden
fortfahren können. Es giebt aber noch einen Mittelschlag, welcher, sich
verlegen fühlend, hin und her lavirt, sich und Andern den Zielpunkt verrückt,
sich hinter Worte und Phrasen flüchtet, oder die Frage so lange dreht
und verdreht, bis man nicht mehr weiß, worauf sie hinauslief. So hat
es z. B. Leibnitz gemacht.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Was die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit,
und in dieser sich selbst, zu ertragen. Innere Leere und Ueberdruß sind
es, von denen sie sowohl in die Gesellschaft, wie in die Fremde und auf
Reisen getrieben werden. Ihrem Geiste mangelt es an Federkraft, sich eigene
Bewegung zu ertheilen. Daher bedürfen sie der steten Erregung von Außen
und zwar der stärksten, d. i. der durch Wesen ihres Gleichen. Imgleichen
ließe sich sagen, daß Jeder von ihnen nur ein kleiner Bruch der Idee
der Menschheit sei, daher er vieler Ergänzung durch Andere bedarf, damit
einigermaßen ein volles menschliches Bewußtsein herauskomme. Hingegen,
wer ein ganzer Mensch ist, ein Mensch par excellence, der stellt eine
Einheit und keinen Bruch dar, hat daher an sich selbst genug.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
͑Η αλαζονεια της ήδονης.
Die Täuschungen, welche die erotischen Gelüste uns bereiten, sind gewissen
Statuen zu vergleichen, welche, infolge ihres Standortes, darauf berechnet
sind, nur von vorne gesehen zu werden, und sich dann schön ausnehmen;
während sie von hinten einen schlechten Anblick darbieten. Dem analog
ist was die Verliebtheit uns vorspiegelt, solange wir es im Prospekt haben
und als kommend erblicken, ein Paradies der Wonne; aber wann vorübergegangen
und demnach von hinten gesehn, zeigt es sich als etwas Geringfügiges
und Unbedeutendes, wo nicht gar Widerliches.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Man ist fast immer der Meinung gewesen, die Aufgabe der Philosophie sei etwas
tief Verborgenes zu finden, das von der Welt verschieden und von ihr bedeckt und
beschattet sei. Daß man dieses glaubte, kommt daher, daß in allen
Wissenschaften offenbare Phänomene gegeben sind und nur die verborgenen, hinter
ihnen liegenden, Gründe zu erforschen sind: diese mögen nun Ursachen oder
Erkenntnisgründe (allgemeine Begriffe und engere unter diesen, die die Phänomene
begreifen und ordnen, wie Cuvier sie zur Zoologie fand) oder Motive und Seinsgründe
sein, gleichviel. Von der Philosophie glaubte man, es sei ebenso damit, und
hielt sie deshalb auch für eine Wissenschaft. Auch konnte es nicht anders sein,
solange man in dem Wahn stand, der Satz vom Grunde sei, wenn auch die Welt nicht
wäre; und die Welt sei, wenn auch das vorstellende Subjekt nicht wäre. Aber
nachdem wir wissen, daß die Welt nichts ist als eine Vorstellung des
erkennenden Subjekts und daher nur für dieses ist, daß daher Sinnlichkeit und
Verstand die Objekte gänzlich erschöpfen, wie die Vernunft die Begriffe erschöpft:
nachdem wir ferner wissen, daß der Satz vom Grunde nichts ist als die in den
vier Klassen der Vorstellungen sich immer in andern Gestalten zeigende
Endlichkeit oder vielmehr Nichtigkeit aller Objekte *), vermöge welcher jedes
Objekt nur eine scheinbare Existenz hat, wie ein Schatten, den man nicht
festhalten kann: denn jedes Objekt ist nur insofern sein Nichtsein noch in der
Zukunft liegt und nicht in der Gegenwart, was bei der Unendlichkeit der Zeit
aber einerlei ist — : Nachdem wir diese besagten zwei Wahrheiten erkannt
haben, werden wir nicht mehr glauben, mit uns werde Versteckens gespielt, indem
einesteils im Objekte etwas liege das Sinnlichkeit und Verstand nicht erkennten
(denn das Sein des Objekts ist nur die Vereinigung wahrnehmbarer Zeit und Raumes
durch den Verstand) oder andernteils die Welt einen Grund habe, ein von ihr
Verschiedenes, das gefunden werden müßte (denn die Welt ist nur sofern wir sie
vorstellen, und der Satz vom Grund ist nur der Ausdruck der Nichtigkeit aller
und jeder Vorstellung). Vielmehr ist es uns jetzt offenbar daß die Welt nicht
ein großes X für ein U ist, nicht ein großer Taschenspielerstreich, daß
nicht etwas zu suchen sei, das dahinter steckt; sondern daß der Charakter der
Welt durchaus Ehrlichkeit ist, daß sie selbst das ist, wofür sie sich gibt und
daß wir um alle Offenbarung zu erlangen nichts brauchen, als zu merken auf das
was vor uns ist, und die Welt wohl ins Auge zu fassen **). Wäre es nicht so,
wie könnte denn alle Kunst um so schöner sein, je objektiver und naiver sie
ist? Nun könnte man aber fragen: „Wozu denn noch Philosophie? Die Welt sehn
wir alle und somit ist uns alle Weisheit gegeben und ferner nichts zu suchen!“
Auf solche Frage muß zuvörderst gefragt werden: Was ist überhaupt Irrtum und
Wahrheit? — Die Welt lügt nicht; indem wir sie anschauen (mit Sinnen und
Verstand), können wir nicht irren; ebensowenig lügt unser eignes Bewußtsein:
unser Innres ist was es ist, wir eben selbst sind es ja, wie könnte Irrtum möglich
sein?! — Nur der Vernunft ist Irrtum möglich, nur in den Begriffen hat er
statt. Wahrheit ist die Beziehung eines Urteils auf etwas außer ihm. Wir irren,
indem wir Begriffe so vereinigen, daß sich eine dieser Vereinigung
entsprechende außer ihnen nicht findet, wie z. B. in dem Urteil „die Welt und
ich selbst sind nur als Folgen eines Grundes“. Der Stoff, in welchem
Philosophie geschaffen werden soll, sind Begriffe, diese (und also ihr Vermögen,
die Vernunft) sind dem Philosophen was dem Bildner der Marmor: er ist Vernunftkünstler:
sein Geschäft, d. i. seine Kunst, ist diese, daß er die ganze Welt, d. i. alle
Vorstellungen und auch was in unserm Innern sich findet (nicht als Vorstellung
sondern als Bewußtsein), daß er dies alles abbilde für die Vernunft, diesem
allem entsprechende Begriffe zusammensetze, also die Welt und das Bewußtsein in
abstracto treu wiederhole. Sobald dies geschehn sein wird, sobald alles was im
Bewußtsein sich findet zu Begriffen gesondert und zu Urteilen wieder vereint, für
die Vernunft niedergelegt sein wird; — wird das letzte, unumstößliche, ganz
befriedigende System der Philosophie, das Kunstwerk dessen Stoff die Begriffe
sind, da sein. Vollkommen objektiv, vollkommen naiv, wie jedes echte Kunstwerk,
wird also diese Philosophie sein. Um sie zu schaffen wird der Philosoph, wie
jeder Künstler, immer unmittelbar aus der Quelle, d. i. der Welt und dem Bewußtsein,
schöpfen, nicht aber es aus Begriffen abspinnen wollen, wie viele falsche
Philosophen, besonders aber Fichte, es thaten, und wie es, scheinbar und der
Form nach, auch Spinoza that. Solches Ableiten von Begriffen aus Begriffen ist
in Wissenschaften von Nutzen, aber in keiner Kunst, also auch nicht in der
Philosophie. Alle Objektivität ist Genialität, nur das Genie ist objektiv, und
daher erklärt sich die gänzliche Unfähigkeit der meisten Menschen Philosophie
zu produzieren und die Erbärmlichkeit fast aller Versuche. Die Philosophaster können
nicht aus sich heraus, um die Welt anzuschauen und ihr Innres besonnen zu
betrachten: aus Begriffen denken sie ein System abzuspinnen: es wird danach. —
Platon hat die hohe Wahrheit gefunden: nur die Ideen sind wirklich, d. h. die
ewigen Formen der Dinge, die anschaulichen adäquaten Repräsentanten der
Begriffe. Die Dinge in Zeit und Raum sind hinschwindende nichtige Schatten: sie
und die Gesetze, nach denen sie entstehn und vergehn, sind nur Gegenstand der
Wissenschaft, ebenso auch die bloßen Begriffe und ihre Ableitung auseinander.
Aber Gegenstand der Philosophie, der Kunst, deren bloßes Material die Begriffe
sind, ist nur die Idee: die Ideen alles dessen, was im Bewußtsein liegt, was
als Objekt erscheint, fasse also der Philosoph auf, er stehe wie Adam vor der
neuen Schöpfung und gebe jedem Ding seinen Namen: dann wird er die ewigen
lebenden Ideen in den toten Begriffen niederlegen und erstarren lassen, wie der
Bildner die Form im Marmor. Wenn er die Idee alles dessen, was ist und lebt,
gefunden und dargestellt haben wird, wird für die praktische Philosophie ein
Nicht-sein-wollen sich ergeben. Denn es wird sich gezeigt haben, wie die Idee
des Seins in der Zeit die Idee eines unseligen Zustandes ist, wie das Sein in
der Zeit, die Welt, das Reich des Zufalls, des Irrtums und der Bosheit ist; wie
der Leib der sichtbare Wille ist, der immer will und nie zufrieden sein kann;
wie das Leben ein stets gehemmtes Sterben, ein ewiger Kampf mit dem Tode, der
endlich siegen muß, ist; wie die leidende Menschheit und die leidende Tierheit
die Idee des Lebens in der Zeit ist; wie das Lebenwollen die wahre Verdammnis
ist, und Tugend und Laster nur der schwächste und stärkste Grad des
Lebenwollens; wie es Thorheit ist, zu fürchten, der Tod könne uns das Leben
rauben, da leider das Lebenwollen schon das Leben ist, und wenn Tod und Leiden
dies Lebenwollen nicht töten, das Leben selbst aus unerschöpflicher Quelle,
aus der unendlichen Zeit, ewig fließt und der Wille zum Leben immer Leben haben
wird, mit dem Tode, der bittern Zugabe, die mit dem Leben eigentlich eines ist,
da nur die Zeit, die nichtige, sie unterscheidet und Leben nur aufgeschobener
Tod ist.
*) Gleichsam der Pferdefuß den der Teufel nicht verleugnen darf, welche Gestalt
er auch annimmt, oder überhaupt die blutige Verschreibung jedes Objekts zum
Tode und Nichtsein, die wir inne werden, wenn wir sehn wie jede Sekunde nur ist,
sofern sie die vorhergehende verschlingt, was durchgeht durch alle Klassen, sich
z. B. zeigt in unserm Atemholen, das nur ein stets gehemmtes Sterben ist, u. s.
f.
Was willst du armer Teufel geben?
Doch hast du Speise, die nicht sättigt, hast
Du rotes Gold, das ohne Rast,
Quecksilber gleich dir in der Hand zerrinnt,
Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,
— — — —
— — —
Zeig mir die Frucht, die fault, eh’ man sie bricht,
Die Bäume, die sich täglich neu begrünen.
Goethe.
**) Der Charakter der Welt würde Falschheit sein, wenn mit der Anschauung des
Dings die eigentliche Erkenntnis seines Wesens nicht vollendet wäre, sondern
man, um diese zu erreichen, etwas vom Dinge ganz Verschiedenes, seinen Grund,
suchen müßte. Die so von einem zum andern weiter geschickte Erkenntnis ist nur
die endliche, ist nur für die Vernunft, für die Wissenschaft: die
philosophische Erkenntnis aber ist in sich ruhend und vollendet, sie ist die
Platonische Idee, welche man durch klare, objektive, naive Anschauung erhält:
da gibt sich jedes Ding für das, was es ist, spricht sich selbst rein aus, und
schickt nicht von einem zum andern, wie der Satz vom Grunde.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der Mensch ist eine Münze, auf deren einer Seite geprägt steht: „Weniger als
nichts“ — und auf der andern: „Alles in allem“. —
Ebenso ist alles Materie und zugleich alles Geist (Wille und Vorstellung).
Ebenso war ich von jeher und werde stets sein: und zugleich bin ich vergänglich
wie die Blume des Feldes.
Ebenso ist das wahrhaft Bestehende nur die Materie; und zugleich nur die Form.
Das scholastische forma dat esse rei ist so zu berichtigen: (rei) dat forma
essentiam, materia existentiam.
Ebenso sind eigentlich nur die Ideen; und zugleich nur die Individuen.
(Realismus, Nominalismus.)
Ebenso hat der Todesgott Yama zwei Gesichter, ein grimmiges und ein unendlich
freundliches.
Es mag noch mehrere solche Widersprüche geben, die ihre Ausgleichung nur in der
wahren Philosophie finden.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Das Menschengeschlecht ist einmal von Natur aus zum Elend und Untergang
bestimmt; denn, wenn nun auch durch den Staat und die Geschichte dem Unrecht und
der Noth so weit abgeholfen wäre, daß eine Art Schlaraffenleben einträte, so
würden sich die Menschen alsdann vor Langeweile balgen und über einander
herfallen, oder die Uebervölkerung würde Hungersnoth herbeiführen und diese
sie aufreiben.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der moderne Materialismus ist der Mist, den Boden zu düngen für die
Philosophie. —
Sämmtliche Naturwissenschaften unterliegen dem unvermeidlichen Nachtheil, daß
sie die Natur ausschließlich von der objektiven Seite auffassen, unbekümmert
um die subjektive. In dieser steckt aber nothwendigerweise die Hauptsache: sie fällt
der Philosophie zu.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Die Menschen, welche nach einem glücklichen, glänzenden und langen Leben,
statt nach einem tugendhaften Leben streben, gleichen den thörigten
Schauspielern, die immer brilliante, siegreiche und lange Rollen haben wollen,
weil sie nicht einsehn, daß es nicht darauf ankommt, was oder wieviel sie
spielen, sondern wie sie spielen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Es ist eine unmögliche, in sich selbst sich widersprechende Forderung
fast aller Philosophen, daß der Mensch innere Einheit seines Wesens,
Eintracht mit sich selbst erlangen soll. Denn als Mensch ist innere
Zwietracht sein Wesen, durchaus so lange er lebt.
Denn nur Eines kann er wirklich ganz und gar seyn: zu allem Andern hat er
aber die Anlage und die unvertilgbare Möglichkeit, es zu seyn. Hat er
sich zu Einem entschlossen, so steht alles Uebrige als Anlage immer bereit
und fordert unablässig aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit zu gelangen:
er muß es also fortwährend zurückdrängen, überwältigen, tödten, so
lange er jenes Eine seyn will. Will er z. B. nur denken und nicht handeln
und treiben, so ist damit die Anlage zum Handeln und Treiben nicht mit
Einem Male vernichtet, sondern so lange er als Denker lebt, muß er sich
stündlich und immer als handelnden betriebsamen Menschen tödten, ewig
mit sich, als einem Ungeheuer, dem jeder abgehauene Kopf gleich wieder wächst,
kämpfen. So, wenn er sich zur Heiligkeit entschlossen hat, muß er sein
ganzes Leben hindurch, und nicht ein für alle Mal, sich als genießendes,
der Wollust ergebenes Wesen tödten: denn ein solches bleibt er, so lange
er lebt. Hat er sich für den Genuß, auf welche Weise auch dieser zu
erlangen sei, entschieden, so kämpft er sein Leben lang mit sich als
einem Wesen, das rein und frei und heilig seyn möchte: denn die Anlage
bleibt ihm, er muß sie stündlich tödten. So durchaus in Allem, in
unendlichen Modifikationen. Bald mag das Eine, bald das Andere in ihm
siegen: er ist der Tummelplatz. Siegt auch das Eine fortwährend, so kämpft
doch das Andere fortwährend; denn es lebt, so lange er lebt: als Mensch
ist er die Möglichkeit vieler Gegensätze.
Wie wäre da Eintracht mit sich selbst möglich? In keinem Heiligen ist
sie und in keinem Bösewicht. Oder vielmehr kein ganzer Heiliger und kein
ganzer Bösewicht ist möglich. Denn sie sollen Menschen seyn, d. h.
unselige Wesen, Kämpfer, Gladiatoren auf der Arena des Lebens.
Freilich ist’s am Besten, er erkenne, welches Theils Besiegung ihn am
meisten schmerzt: diesen lasse er stets siegen; was ihm mittelst der
Vernunft, deren Begriffe ihm stets gegenwärtig sind, möglich ist. Er
entschließe sich freiwillig zu dem Schmerz, den ihm die Besiegung des
andern Theiles macht. So hat er Charakter. Denn ohne allen Schmerz geht
der Kampf des Lebens nicht ab, der darf nicht ohne Blut endigen, und
leiden muß der Mensch den Schmerz in jedem Fall, denn er ist ja sowohl
der Besiegte, als der Sieger. Haec est vivendi conditio.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Der große Unterschied zwischen äußerm und innerm Gesetz (Staat und
Reich Gottes) ist schon daraus zu ersehen, daß der Staat sorgt, daß
einem Jeden Recht widerfahre, Jeden als passiv betrachtet und daher sich
an die Handlung hält, dagegen das Moralgesetz will, daß Jeder Recht
thue, Jeden als aktiv betrachtet, den Willen, nicht die That ansieht. Z.
B. Ein Schuldner und ein Gläubiger streiten sich, indem Jener die Schuld
leugnet. Dabei sind gegenwärtig ein Rechtskundiger und ein Moralist.
Diese werden lebhaften Antheil an der Sache nehmen und Beide denselben
Ausgang der Sache wünschen, obgleich Jeder von ihnen etwas ganz Anderes
will. Der Rechtskundige sagt: „Ich will, daß dieser Mann das Seinige
wieder erhalte.“ — Der Moralist: „Ich will, daß Jener seine Pflicht
thue.“
Wie man gesagt hat, der Geschichtschreiber sei der umgekehrte Prophet, so
kann man auch sagen: der Lehrer der Rechte ist der umgekehrte Moralist,
oder Politik die umgekehrte Ethik. — Der Staat ist der gordische Knoten,
der zerhauen ist, statt daß er gelöst werden sollte; das Ei des
Kolumbus, das durch Zerbrechen zum Stehen gebracht ist, statt durch
Aequilibrium, als sei sein Stehen die Sache, statt daß sein Balanciren es
ist. Er gleicht Dem, der schön Wetter zu machen glaubt, wenn er nur das
Barometer zum steigen zwingt.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Nichts verräth weniger Menschenkenntniß, als wenn man als einen Beleg
der Verdienste und des Werthes eines Menschen anführt, daß er sehr viele
Freunde hat: als ob die Menschen ihre Freundschaft nach dem Werth und
Verdienst verschenkten! als ob sie nicht vielmehr ganz und gar, wie die
Hunde wären, die den lieben, der sie streichelt oder gar ihnen Brocken
giebt und weiter sich um nichts bekümmert! — Wer es am besten versteht,
sie zu streicheln, und seien es die garstigsten Thiere, der hat viele
Freunde.
Es läßt sich gegentheils behaupten, daß Menschen von vielem
intellektualen Werth oder gar von Genie nur sehr wenige Freunde haben können:
denn ihr helles Auge sieht bald alle Fehler, und ihr richtiger Sinn wird
durch die Größe und Scheußlichkeit derselben immer von Neuem empört:
nur die äußerste Noth kann sie zwingen, sich gar nichts davon merken zu
lassen oder gar die allerliebsten Auswüchse und Beulen zu streicheln.
Geniale Menschen können vielmehr nur alsdann von vielen persönlich
geliebt werden (denn von der Verehrung aus Autorität ist nicht die Rede),
wenn ihnen die Götter auch eine unverwüstliche Heiterkeit des Sinnes,
einen weltverschönernden Blick schenken, oder auch sie es allmählig
dahin gebracht haben, recht eigentlich die Menschen zu nehmen, wie sie
sind, d. h. die Narren eben auch zum Narren zu haben, wie sich’s gehört.*)
*) Die letzten Worte hier erinnern an Goethes ,,Kophtisches Lied“ mit
dem Refrain:
Thöricht auf Bessrung der Thoren zu harren!
Kinder der Klugheit, o! habet die Narren
Eben zum Narren auch, wie sich’s gehört.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Haben wir nunmehr durch die allerallgemeinsten Betrachtungen, durch
Untersuchung der ersten elementaren Grundzüge des Menschenlebens, uns
insofern a priori überzeugt, das dasselbe schon der ganzen Anlage nach,
keiner wahren Glückseligkeit fähig, sondern wesentlich ein
vielgestaltetes Leiden und ein durchweg unseliger Zustand ist; so könnten
wir jetzt diese Ueberzeugung viel lebhafter in uns erwecken, wenn wir,
mehr a posteriori verfahrend, auf die bestimmteren Fälle eingehen, Bilder
vor die Phantasie bringen und in Beispielen den namenlosen Jammer
schildern wollten, den Erfahrung und Geschichte darbieten, wohin man auch
blicken und in welcher Rücksicht man auch forschen mag. Allein das
Kapitel würde ohne Ende sein und uns von dem Standpunkt der Allgemeinheit
entfernen, welcher der Philosophie wesentlich ist. Zudem könnte man
leicht eine solche Schilderung für eine bloße Deklamation über das
menschliche Elend, wie sie schon oft dagewesen ist, halten und sie als
solche der Einseitigkeit beschuldigen, weil sie von einzelnen Thatsachen
ausginge. Von solchem Vorwurf und Verdacht ist daher unsere ganz kalte und
philosophische, vom Allgemeinen ausgehende und a priori geführte
Nachweisung des im Wesen des Lebens begründeten unumgänglichen Leidens
frei. Die Bestätigung a posteriori aber ist überall leicht zu haben.
Jeder, welcher aus den ersten Jugendträumen erwacht ist, eigene und
fremde Erfahrung beachtet, sich im Leben, in der Geschichte der
Vergangenheit und des eigenen Zeitalters, endlich in den Werken der großen
Dichter umgesehen hat, wird, wenn nicht irgend ein unauslöschlich eingeprägtes
Vorurteil seine Urteilskraft lähmt, wohl das Resultat erkennen, daß
diese Menschenwelt das Reich des Zufalls und des Irrtums ist, die
unbarmherzig darin schalten, im großen, wie im kleinen, neben welchen
aber noch Thorheit und Bosheit die Geißel schwingen: daher es kommt, daß
jedes Bessere nur mühsam sich durchdrängt, das Edle und Weise sehr
selten zur Erscheinung gelangt und Wirksamkeit oder Gehör findet, aber
das Absurde und Verkehrte im Reiche des Denkens, das Platte und
Abgeschmackte im Reiche der Kunst, das Böse und Hinterlistige im Reiche
der Thaten, nur durch kurze Unterbrechungen gestört, eigentlich die
Herrschaft behaupten; hingegen das Treffliche jeder Art immer nur eine
Ausnahme, ein Fall aus Millionen ist, daher auch, wenn es sich in einem
dauernden Werke kundgegeben, dieses nachher, nachdem es den Groll seiner
Zeitgenossen überlebt hat, isoliert dasteht, aufbewahrt wird, gleich
einem Meteorstein, aus einer andern Ordnung der Dinge, als die hier
herrschende ist, entsprungen. — Was aber das Leben des einzelnen
betrifft, so ist jede Lebensgeschichte eine Leidensgeschichte: denn jeder
Lebenslauf ist, in der Regel, eine fortgesetzte Reihe großer und kleiner
Unfälle, die zwar jeder möglichst verbirgt, weil er weiß, daß andere
selten Teilnahme oder Mitleid, fast immer aber Befriedigung durch die
Vorstellung der Plagen, von denen sie gerade jetzt verschont sind, dabei
empfinden müssen; — aber vielleicht wird nie ein Mensch, am Ende seines
Lebens, wenn er besonnen und zugleich aufrichtig ist, wünschen, es
nochmals durchzumachen, sondern, eher als das, viel lieber gänzliches
Nichtsein erwählen. Der wesentliche Inhalt des weltberühmten Monologs im
„Hamlet“ ist, wenn zusammengefaßt, dieser: Unser Zustand ist ein so
elender, daß gänzliches Nichtsein ihm entschieden vorzuziehen wäre.
Wenn nun der Selbstmord uns dieses wirklich darböte, so daß die
Alternative „Sein oder Nichtsein“ im vollen Sinn des Wortes vorläge;
dann wäre er unbedingt zu erwählen, als eine höchst wünschenswerte
Vollendung (a consummation devoutly to be wish`d). Allein in uns ist
etwas, das uns sagt, dem sei nicht so; es sei damit nicht aus, der Tod sei
keine absolute Vernichtung. — Imgleichen ist, was schon der Vater der
Geschichte anführt *), auch wohl seitdem nicht widerlegt worden, daß nämlich
kein Mensch existiert hat, der nicht mehr als einmal gewünscht hätte,
den folgenden Tag nicht zu erleben. Danach möchte die so oft beklagte Kürze
des Lebens vielleicht gerade das Beste daran sein. — Wenn man nun
endlich noch jedem die entsetzlichen Schmerzen und Qualen, denen sein
Leben beständig offensteht, vor die Augen bringen wollte; so würde ihn
Grausen ergreifen: und wenn man den verstocktesten Optimisten durch die
Krankenhospitäler, Lazarette und chirurgische Marterkammern, durch die
Gefängnisse, Folterkammern und Sklavenställe, über Schlachtfelder und
Gerichtsstätten führen, dann alle die finsteren Behausungen des Elends,
wo es sich vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm öffnen und zum
Schluß ihn in den Hungerturm des Ugolino blicken lassen wollte; so würde
sicherlich auch er zuletzt einsehen, welcher Art dieser meilleur des
mondes possibles ist. Woher denn anders hat Dante den Stoff zu seiner Hölle
genommen, als aus dieser unserer wirklichen Welt? Und doch ist es eine
recht ordentliche Hölle geworden. Hingegen als er an die Aufgabe kam, den
Himmel und seine Freuden zu schildern, da hatte er eine unüberwindliche
Schwierigkeit vor sich; weil eben unsere Welt gar keine Materialien zu so
etwas darbietet. Daher blieb ihm nichts übrig, als, statt der Freuden des
Paradieses, die Belehrung, die ihm dort von seinem Ahnherrn, seiner
Beatrix und verschiedenen Heiligen erteilt worden, uns wiederzugeben.
Hieraus aber erhellt genugsam, welcher Art diese Welt ist. Freilich ist am
Menschenleben, wie an jeder schlechten Ware, die Außenseite mit falschem
Schimmer überzogen: immer verbirgt sich was leidet; hingegen was jeder an
Prunk und Glanz erschwingen kann, trägt er zur Schau, und je mehr ihm
innere Zufriedenheit abgeht, desto mehr wünscht er, in der Meinung
anderer als ein Beglückter dazustehen: so weit geht die Thorheit, und die
Meinung anderer ist ein Hauptziel des Strebens eines jeden, obgleich die gänzliche
Nichtigkeit desselben schon dadurch sich ausdrückt, daß in fast allen
Sprachen Eitelkeit, vanitas, ursprünglich Leerheit und Nichtigkeit
bedeutet. — Allein auch unter allem diesen Blendwerk können die Qualen
des Lebens sehr leicht so anwachsen, und es geschieht ja täglich, daß
der sonst über alles gefürchtete Tod mit Begierde ergriffen wird. Ja,
wenn das Schicksal seine ganze Tücke zeigen will, so kann selbst diese
Zuflucht dem Leidenden versperrt und er, unter den Händen ergrimmter
Feinde, grausamen, langsamen Martern ohne Rettung hingegeben bleiben.
Vergebens ruft dann der Gequälte seine Götter um Hilfe an: er bleibt
seinem Schicksal ohne Gnade preisgegeben. Diese Rettungslosigkeit ist aber
eben nur der Spiegel der Unbezwinglichkeit seines Willens, dessen Objektität
seine Person ist. — So wenig eine äußere Macht diesen Willen ändern
oder aufheben kann, so wenig auch kann irgend eine fremde Macht ihn von
den Qualen befreien, die aus dem Leben hervorgehen, welches die
Erscheinung jenes Willens ist. Immer ist der Mensch auf sich selbst zurückgewiesen,
wie in jeder, so in der Hauptsache. Vergebens macht er sich Götter, um
von ihnen zu erbetteln und zu erschmeicheln was nur die eigene
Willenskraft herbeizuführen vermag. Hatte das Alte Testament die Welt und
den Menschen zum Werk eines Gottes gemacht, so sah das Neue Testament, um
zu lehren, daß Heil und Erlösung aus dem Jammer dieser Welt nur von ihr
selbst ausgehen kann, sich genötigt, jenen Gott Mensch werden zu lassen.
Des Menschen Wille ist und bleibt es, wovon alles für ihn abhängt.
Saniassis, Märtyrer, Heilige jedes Glaubens und Namens, haben freiwillig
und gern jede Marter erduldet, weil in ihnen der Wille zum Leben sich
aufgehoben hatte; dann aber war sogar die langsame Zerstörung seiner
Erscheinung ihnen willkommen. Doch ich will der fernern Darstellung nicht
vorgreifen. — Uebrigens kann ich hier die Erklärung nicht zurückhalten,
daß mir der Optimismus, wo er nicht etwan das gedankenlose Reden solcher
ist, unter deren platten Stirnen nichts als Worte herbergen, nicht bloß
als eine absurde, sondern auch als eine wahrhaft ruchlose Denkungsart
erscheint, als ein bitterer Hohn über die namenlosen Leiden der
Menschheit. — Man denke nur ja nicht etwan, daß die christliche
Glaubenslehre dem Optimismus günstig sei; da im Gegenteil in den
Evangelien Welt und Uebel beinahe als synonyme Ausdrücke gebraucht werden
**).
*) Herodot VIl, 46.
**) Hiezu Kap. 46 des vierten Buches der Ergänzungen.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Ich wollte, daß die Philosophen, welche den guten Werken einen so großen,
ja ausschließlichen Wert beilegen und selbige für das höchste Ziel des
Menschen halten, sich doch aufs Gewissen fragten, ob diesem ihren so sehr
moralischen Dogma durchaus keine eigennützige Absicht zum Grunde liegt?
ob nicht etwa im stillen die Gefahr sie besorgt macht, welche der Welt
daraus entstehn könnte, wenn die guten Werke nicht mehr den höchsten
Wert behielten, und ob sie folglich bei ihrem Eifer für die guten Werke
nicht so sehr um das ewige, als um das zeitliche Wohl der Menschheit
besorgt wären? — Meine Philosophie ist nämlich die einzige, welche in
der Ethik über die guten Werke hinausgeht und etwas Höheres kennt, nämlich
die Askese. Die guten Werke laufen hinaus auf ein Gleichsetzen, ja
gelegentlich Vorziehen des fremden Besten dem eigenen. Sie sind daher
durchweg relativ; denn die Rücksicht auf das Wohl Anderer modifiziert
unser Wollen des eigenen. Wie nun dies auf unser und der Welt Dasein den
tiefsten Einfluß haben sollte, bleibt geheimnisvoll, ist nicht abzusehn.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
Unter philosophisch rohen Leuten, denen alle die beizuzählen sind, welche
die Kantische Philosophie nicht studiert haben, folglich unter den meisten
Ausländern, nicht weniger unter vielen heutigen Medizinern u. dgl. in
Deutschland, welche getrost auf der Grundlage ihres Katechismus
philosophieren, besteht noch der alte, grundfalsche Gegensatz zwischen
Geist und Materie. Besonders aber haben die Hegelianer, infolge ihrer
ausgezeichneten Unwissenheit und philosophischen Roheit, ihn, unter dem,
aus der vorkantischen Zeit wieder hervorgeholten, Namen „Geist und
Natur“, von neuem in Gang gebracht, unter welchem sie ihn ganz naiv
auftischen, als hätte es nie einen Kant gegeben und gingen wir noch, mit
Allongeperücken geziert, zwischen geschorenen Hecken umher, indem wir,
wie Leibniz im Garten zu Herrenhausen (Leibn. ed. Erdmann p. 755) mit
Prinzessinnen und Hofdamen philosophierten, über „Geist und Natur“,
unter letzterer die geschorenen Hecken, unter ersterem den Inhalt der Perücken
verstehend. — Unter Voraussetzung dieses falschen Gegensatzes gibt es
dann Spiritualisten und Materialisten. Letztere behaupten, die Materie
bringe, durch ihre Form und Mischung, alles, folglich auch das Denken und
Wollen im Menschen hervor; worüber denn die erstern Zeter schreien, u. s.
w.
In Wahrheit aber gibt es weder Geist, noch Materie, wohl aber viel Unsinn
und Hirngespinste in der Welt. Das Streben der Schwere im Steine ist
gerade so unerklärlich, wie das Denken im menschlichen Gehirne, würde
also, aus diesem Grunde, auch auf einen Geist im Steine schließen lassen.
Ich würde daher zu jenen Disputanten sagen: ihr glaubt eine tote, d. h.
vollkommen passive und eigenschaftslose Materie zu erkennen, weil ihr
alles das wirklich zu verstehn wähnt, was ihr auf mechanische Wirkung zurückzuführen
vermögt. Aber wie die physikalischen und chemischen Wirkungen euch
eingeständlich unbegreiflich sind, solange ihr sie nicht auf mechanische
zurückzuführen wißt; gerade so sind diese mechanischen Wirkungen
selbst, also die Aeußerungen, welche aus der Schwere, der
Undurchdringlichkeit, der Kohäsion, der Härte, der Starrheit, der
Elastizität, der Fluidität, u. s. w. hervorgehn, ebenso geheimnisvoll,
wie jene, ja, wie das Denken im Menschenkopf. Kann die Materie, ihr wißt
nicht warum, zur Erde fallen: so kann sie auch, ihr wißt nicht warum,
denken. Das wirklich rein und durch und durch, bis auf das Letzte, Verständliche
in der Mechanik geht nicht weiter, als das rein Mathematische in jeder
Erklärung, ist also beschränkt auf Bestimmungen des Raumes und der Zeit.
Nun sind aber diese beiden, samt ihrer ganzen Gesetzlichkeit, uns a priori
bewußt, sind daher bloße Formen unsers Erkennens, und gehören ganz
allein unseren Vorstellungen an. Ihre Bestimmungen sind also im Grunde
subjektiv und betreffen nicht das rein Objektive, das von unserer
Erkenntnis Unabhängige, das Ding an sich selbst. Sobald wir aber, selbst
in der Mechanik, weiter gehn, als das rein Mathematische, sobald wir zur
Undurchdringlichkeit, zur Schwere, zur Starrheit, oder Fluidität, oder
Gaseität, kommen, stehn wir schon bei Aeußerungen, die uns ebenso
geheimnisvoll sind, wie das Denken und Wollen des Menschen, also beim
direkt Unergründlichen: denn ein solches ist jede Naturkraft. Wo bleibt
nun also jene Materie, die ihr so intim kennt und versteht, daß ihr alles
aus ihr erklären, alles auf sie zurückführen wollt? — Rein
begreiflich und ganz ergründlich ist immer nur das Mathematische; weil es
das im Subjekt, in unserm eigenen Vorstellungsapparat, Wurzelnde ist:
sobald aber etwas eigentlich Objektives auftritt, etwas nicht a priori
Bestimmbares; da ist es sofort auch in letzter Instanz unergründlich. Was
überhaupt Sinne und Verstand wahrnehmen, ist eine ganz oberflächliche
Erscheinung, die das wahre und innere Wesen der Dinge unberührt läßt.
Das wollte Kant. Nehmt ihr nun im Menschenkopfe, als Deum ex machina,
einen Geist an; so müßt ihr, wie gesagt, auch jedem Stein einen Geist
zugestehn. Kann hingegen eure tote und rein passive Materie als Schwere
streben, oder, als Elektrizität, anziehn, abstoßen und Funken schlagen;
so kann sie auch als Gehirnbrei denken. Kurz, jedem angeblichen Geist kann
man Materie, aber auch jeder Materie Geist unterlegen; woraus sich ergibt,
daß der Gegensatz falsch ist.
Also nicht jene Cartesianische Einteilung aller Dinge in Geist und Materie
ist die philosophisch richtige; sondern die in Wille und Vorstellung ist
es: diese aber geht mit jener keinen Schritt parallel. Denn sie
vergeistigt alles, indem sie einerseits auch das dort ganz Reale und
Objektive, den Körper, die Materie, in die Vorstellung verlegt, und
andrerseits das Wesen an sich einer jeden Erscheinung auf Willen zurückführt.
Der Ursprung der Vorstellung der Materie überhaupt als des objektiven,
aber ganz eigenschaftslosen Trägers aller Eigenschaften, habe ich zuerst
in der „Welt als Wille und Vorstellung“ S. 9 (Bd. 2, S. 35 dieser
Gesamtausgabe), und dann, deutlicher und genauer, in der zweiten Auflage
meiner Abhandlung über den Satz vom Grunde, § 21 (Bd.1, S. 116 dieser
Gesamtausgabe), dargelegt und erinnere hier daran, damit man diese neue
und meiner Philosophie wesentliche Lehre nie aus den Augen verliere. Jene
Materie ist demnach nur die objektivierte, d. h. nach außen projizierte
Verstandesfunktion der Kausalität selbst, also das objektiv hypostasierte
Wirken überhaupt, ohne nähere Bestimmung seiner Art und Weise.
Demzufolge gibt, bei der objektiven Auffassung der Körperwelt, der
Intellekt die sämtlichen Formen derselben aus eigenen Mitteln, nämlich
Zeit, Raum und Kausalität, und mit dieser auch den Begriff der abstrakt
gedachten, eigenschafts- und formlosen Materie, die als solche in der
Erfahrung gar nicht vorkommen kann. Sobald nun aber der Intellekt,
mittelst dieser Formen und in ihnen, einen (stets nur von der
Sinnesempfindung ausgehenden) realen Gehalt, d. h. etwas von seinen
eigenen Erkenntnisformen Unabhängiges spürt, welches nicht im Wirken überhaupt,
sondern in einer bestimmten Wirkungsart sich kundgibt; so ist es dies, was
er als Körper, d. h. als geformte und spezifisch bestimmte Materie setzt,
welche also als ein von seinen Formen Unabhängiges auftritt, d. h. als
ein durchaus Objektives. Hiebei hat man sich aber zu erinnern, daß die
empirisch gegebene Materie sich überall nur durch die in ihr sich äußernden
Kräfte manifestiert; wie auch umgekehrt jede Kraft immer nur als einer
Materie inhärierend erkannt wird: beide zusammen machen den empirisch
realen Körper aus. Alles empirisch Reale behält jedoch transcendentale
Idealität. Das in einem solchen empirisch gegebenen Körper, also in
jeder Erscheinung, sich darstellende Ding an sich selbst, habe ich als
Willen nachgewiesen. Nehmen wir nun wieder dieses zum Ausgangspunkt; so
ist, wie ich es öfter ausgesprochen habe, die Materie uns die bloße
Sichtbarkeit des Willens, nicht aber dieser selbst: demnach gehört sie
dem bloß Formellen unserer Vorstellung, nicht aber dem Ding an sich, an.
Diesemgemäß eben müssen wir sie als form- und eigenschaftslos, absolut
träge und passiv denken; können sie jedoch nur in abstracto also denken:
denn empirisch gegeben ist die bloße Materie, ohne Form und Qualität,
nie. Wie es aber nur eine Materie gibt, die, unter den mannigfaltigsten
Formen und Accidenzien auftretend, doch dieselbe ist; so ist auch der
Wille in allen Erscheinungen zuletzt ein und derselbe.
Dem obigen zufolge muß unserm, an seine Formen gebundenen und von Haus
aus nur zum Dienst eines individuellen Willens, nicht zur objektiven
Erkenntnis des Wesens der Dinge, bestimmten Intellekt das, woraus alle
Dinge werden und hervorgehn, eben als die Materie erscheinen, d. h. als
das Reale überhaupt, das Raum und Zeit Erfüllende, unter allem Wechsel
der Qualitäten und Formen Beharrende, welches das gemeinsame Substrat
aller Anschauungen, jedoch für sich allein nicht anschaubar ist; wobei
denn, was diese Materie an sich selbst sein möge, zunächst und
unmittelbar unausgemacht bleibt. Versteht man nun unter dem so viel
gebrauchten Ausdruck Absolutum das, was nie entstanden sein, noch jemals
vergehn kann, woraus hingegen alles, was existiert, besteht und geworden
ist; so hat man dasselbe nicht in imaginären Räumen zu suchen; sondern
es ist ganz klar, daß jenen Anforderungen die Materie gänzlich
entspricht. — Nachdem nun Kant gezeigt hatte, daß die Körper bloße
Erscheinungen seien, ihr Wesen an sich aber unerkennbar bliebe, bin ich
dennoch dahin durchgedrungen, dieses Wesen als identisch mit dem, was wir
in unserm Selbstbewußtsein unmittelbar als Willen erkennen, nachzuweisen.
Ich habe demnach (Ergänzungen zur „Welt als Wille und Vorstellung“
Kap. 24, Bd. 5, S.135 ff. dieser Gesamtausgabe) die Materie dargelegt als
die bloße Sichtbarkeit des Willens. Da nun ferner bei mir jede Naturkraft
Erscheinung des Willens ist; so folgt, daß keine Kraft ohne materielles
Substrat auftreten, mithin auch keine Kraftäußerung ohne irgend eine
materielle Veränderung vor sich gehn kann. Dies stimmt zu der Behauptung
des Zoochemikers Liebig, daß jede Muskelaktion, ja jeder Gedanke im
Gehirn, von einer chemischen Stoffumsetzung begleitet sein müsse. Wir
haben hiebei jedoch immer festzuhalten, daß wir andrerseits die Materie
stets nur durch die in ihr sich manifestierenden Kräfte empirisch
erkennen. Sie ist eben nur die Manifestation dieser Kräfte überhaupt, d.
h. in abstracto, im allgemeinen. An sich ist sie die Sichtbarkeit des
Willens.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
[...] Und sehn wir denn nicht, der besagten elenden Beschaffenheit des
Menschengeschlechts entsprechend, zu allen Zeiten, die großen Genien, sei
es in der Poesie, oder der Philosophie, oder den Künsten, dastehn, wie
vereinzelte Helden, welche allein gegen den Andrang eines Heereshaufens
den verzweifelten Kampf aufrecht erhalten? Denn die Stumpfheit, Roheit,
Verkehrtheit, Albernheit und Brutalität der großen, großen Mehrheit des
Geschlechts steht, in jeder Art und Kunst, ihrem Wirken ewig entgegen und
bildet dadurch jenen feindlichen Heereshaufen, dem sie zuletzt doch
unterliegen. Was auch solche einzelne Helden leisten mögen; es wird
schwer erkannt, spät und nur auf Auktorität geschätzt und leicht,
wenigstens auf eine Weile, wieder verdrängt. Denn immer von neuem wird
gegen dasselbe das Falsche, das Platte, das Abgeschmackte zu Markte
gebracht, und alles dieses sagt jener großen Mehrheit besser zu,
behauptet also meistenteils den Kampfplatz. Mag auch vor derselben der
Kritiker stehn und schreien, wie Hamlet, wann er seiner nichtswürdigen
Mutter die zwei Bildnisse vorhält: „Habt ihr Augen? habt ihr Augen?“
— ach, sie haben keine! Wenn ich die Menschen beim Genusse der Werke großer
Meister beobachte und die Art ihres Beifalls sehe; so fallen mir dabei oft
die zur sogenannten Komödie abgerichteten Affen ein, die sich wohl
ziemlich menschlich gebärden, dazwischen aber immer verraten, daß das
eigentliche innere Prinzip jener Gebärden ihnen dennoch abgeht, indem sie
die unvernünftige Natur durchblicken lassen.
Dem allen zufolge ist die oft gebrauchte Redensart, daß einer „über
seinem Jahrhundert stehe“, dahin auszulegen, daß er über dem
Menschengeschlechte überhaupt steht, weshalb eben er nur von solchen
unmittelbar erkannt wird, welche schon selbst sich bedeutend über das Maß
der gewöhnlichen Fähigkeiten erheben: diese aber sind zu selten, als daß
deren zu jeder Zeit eine Anzahl vorhanden sein könnte. Ist also jener in
diesem Stücke nicht besonders vom Schicksale begünstigt; so wird er
„von seinem Jahrhundert verkannt“, d. h. so lange ohne Geltung
bleiben, bis die Zeit allmählich die Stimmen der seltenen, ein Werk hoher
Gattung zu beurteilen fähigen Köpfe zusammengebracht hat. Danach heißt
es dann bei der Nachwelt: „der Mann stand über seinem Jahrhundert,“
statt „über der Menschheit“: diese nämlich wird gern ihre Schuld
einem einzigen Jahrhundert aufbürden. Hieraus folgt, daß wer über
seinem Jahrhunderte gestanden hat, wohl auch über jedem andern gestanden
haben würde; es sei denn, daß in irgend einem, durch einen seltenen Glücksfall,
einige fähige und gerechte Beurteiler, in der Gattung seiner Leistungen,
zugleich mit ihm geboren worden wären; wie, einem schönen indischen
Mythos zufolge, wann Wischnu sich als Held inkarniert, dann zu gleicher
Zeit Brahma als Sänger seiner Thaten auf die Welt kommt; daher eben
Valmiki, Vyasa und Kalidasa Inkarnationen des Brahma sind *). — In
diesem Sinne nun kann man sagen, daß jedes unsterbliche Werk sein
Zeitalter auf die Probe stellt, ob nämlich es im stande sein werde,
dasselbe zu erkennen: meistens besteht es die Probe nicht besser, als die
Nachbarn des Philemon und Baukis, welche den unerkannten Göttern die Thüre
wiesen. Demnach geben den richtigen Maßstab für den intellektuellen Wert
eines Zeitalters nicht die großen Geister, die in demselben auftraten; da
ihre Fähigkeiten das Werk der Natur sind und die Möglichkeit der
Ausbildung derselben zufälligen Umständen anheimgestellt war: sondern
ihn gibt die Aufnahme, welche ihre Werke bei ihren Zeitgenossen gefunden
haben: ob nämlich ihnen ein baldiger und lebhafter Beifall ward, oder ein
später und zäher, oder ob er ganz der Nachwelt überlassen blieb. Dies
wird besonders dann der Fall sein, wenn es Werke hoher Gattung sind. Denn
der oben erwähnte Glücksfall wird um so gewisser ausbleiben, je
Wenigeren Überhaupt zugänglich die Gattung ist, in der ein großer Geist
arbeitet. Hier liegt der unermeßliche Vorteil, in welchem, hinsichtlich
ihres Ruhmes, die Dichter stehn, indem sie beinahe allen zugänglich sind.
Hätte Walter Scott nur von etwan hundert Personen gelesen und beurteilt
werden können; so wäre vielleicht irgend ein gemeiner Skribler ihm
vorgezogen worden, und wann nachher die Sache sich aufgeklärt hätte, würde
auch ihm die Ehre zu teil geworden sein, „über seinem Jahrhundert
gestanden zu haben“. — Wenn nun aber gar noch zur Unfähigkeit jener
hundert Köpfe, die im Namen eines Zeitalters ein Werk zu beurteilen
haben, bei ihnen sich Neid, Unredlichkeit und Zielen nach persönlichen
Zwecken gesellt; — dann hat ein solches Werk das traurige Schicksal
dessen, der vor einem Tribunal plaidiert, dessen sämtliche Beisitzer
bestochen sind.
Dementsprechend zeigt die Litterargeschichte durchgängig, daß die,
welche die Einsichten und Erkenntnisse selbst sich zu ihrem Zwecke
machten, verkannt und verlassen sitzen geblieben sind; während die,
welche mit dem bloßen Scheine derselben paradierten, die Bewunderung
ihrer Zeitgenossen, nebst den Emolumenten, gehabt haben.
Denn zunächst ist die Wirksamkeit eines Schriftstellers dadurch bedingt,
daß er den Ruf erlange, man müsse ihn lesen. Diesen Ruf nun aber werden,
durch Künste, Zufall und Wahlverwandtschaft, hundert Unwürdige schnell
erlangen, während ein Würdiger langsam und spät dazu kommt **). Jene nämlich
haben Freunde; weil das Pack stets in Menge vorhanden ist und eng
zusammenhält: er aber hat nur Feinde; weil geistige Ueberlegenheit, überall
und in allen Verhältnissen, das Verhaßteste auf der Welt ist: und nun
gar bei den Stümpern im selben Fache, die selbst für etwas gelten möchten.
— Sollten die Philosophieprofessoren etwan meinen, daß hier auf sie und
auf ihre mehr als dreißig Jahre lang eingehaltene Taktik gegen meine
Werke angespielt werde; so haben sie es getroffen.
Weil nun dies alles sich so verhält, so ist, um etwas Großes zu leisten,
etwas, das seine Generation und sein Jahrhundert überlebt,
hervorzubringen, eine Hauptbedingung, daß man seine Zeitgenossen, nebst
ihren Meinungen, Ansichten und daraus entspringendem Tadel und Lobe, für
gar nichts achte. Diese Bedingung findet jedoch sich immer von selbst ein,
sobald die übrigen beisammen sind: und das ist ein Glück. Denn wollte
einer, beim Hervorbringen solcher Werke, die allgemeine Meinung, oder das
Urteil der Fachgenossen berücksichtigen; so würden sie, bei jedem
Schritte, ihn vom rechten Wege abführen. Daher muß wer auf die Nachwelt
kommen will, sich dem Einflusse seiner Zeit entziehn, dafür aber freilich
auch meistens dem Einfluß auf seine Zeit entsagen und bereit sein, den
Ruhm der Jahrhunderte mit dem Beifall der Zeitgenossen zu erkaufen.
Wann nämlich irgend eine neue und daher paradoxe Grundwahrheit in die
Welt kommt; so wird man allgemein sich ihr hartnäckig und möglichst
lange widersetzen, ja, sie noch dann leugnen, wann man schon wankt und
fast überführt ist. Inzwischen wirkt sie im stillen fort und frißt, wie
eine Säure, um sich, bis alles unterminiert ist: dann wird hin und wieder
ein Krachen vernehmbar, der alte Irrtum stürzt ein, und nun steht plötzlich,
wie ein aufgedecktes Monument, das neue Gedankengebäude da, allgemein
anerkannt und bewundert. Freilich pflegt das alles sehr langsam zu gehn.
Denn auf wen zu hören sei merken die Leute in der Regel erst, wann er
nicht mehr da ist, so daß das hear, hear! erschallt, nachdem der Redner
abgetreten.
Ein besseres Schicksal hingegen erwartet die Werke gewöhnlichen Schlages.
Sie entstehn im Fortgang und Zusammenhang der Gesamtbildung ihres
Zeitalters, sind daher mit dem Geiste der Zeit, d. h. den gerade
herrschenden Ansichten, genau verbunden und auf das Bedürfnis des
Augenblicks berechnet. Wenn sie daher nur irgend einiges Verdienst haben;
so wird dasselbe sehr bald anerkannt, und sie werden, als eingreifend in
die Bildungsepoche ihrer Zeitgenossen, bald Anteil finden: ihnen wird
Gerechtigkeit widerfahren, ja, oft mehr als solche, und dem Neide geben
sie doch nur wenig Stoff; da, wie gesagt, tantum quisque laudat, quantum
se posse sperat imitari. Aber jene außerordentlichen Werke, welche
bestimmt sind, der ganzen Menschheit anzugehören und Jahrhunderte zu
leben, sind, bei ihrem Entstehn, zu weit im Vorsprung, ebendeshalb aber
der Bildungsepoche und dem Geiste ihrer eigenen Zeit fremd. Sie gehören
diesen nicht an, sie greifen in ihren Zusammenhang nicht ein, gewinnen
also den darin Begriffenen kein Interesse ab. Sie gehören eben einer
andern, einer höhern Bildungsstufe und einer noch fern liegenden Zeit an.
Ihre Laufbahn verhält sich zu der jener andern, wie die des Uranus zu der
des Merkur. Ihnen widerfährt daher, vorderhand, keine Gerechtigkeit: man
weiß nicht, was man damit soll, läßt sie also liegen, um seinen kleinen
Schneckengang fortzusetzen. Sieht doch auch das Gewürm nicht den Vogel in
der Luft. [...]
*) Polier, Mythol. d. lndous, Vol. 1, p. 172 — 190.
**) In der Regel werden Quantität und Qualität des Publikums eines
Werkes in umgekehrtem Verhältnis stehn, daher z. B. aus den zahlreichen
Auflagen eines Dichterwerkes keineswegs auf dessen Wert zu schließen ist.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
[...] Man denke nicht, daß es mit diesem Gange der Dinge sich jemals
bessern werde. Die elende Beschaffenheit des Menschengeschlechts nimmt
zwar in jeder Generation eine etwas veränderte Gestalt an, ist aber zu
allen Zeiten dieselbe. Die ausgezeichneten Geister dringen selten bei
Lebzeiten durch; weil sie im Grunde doch bloß von den ihnen schon
verwandten ganz und recht eigentlich verstanden werden.
Da nun den Weg zur Unsterblichkeit, aus so vielen Millionen, selten auch
nur einer geht; so muß er notwendig sehr einsam sein, und wird die Reise
zur Nachwelt durch eine entsetzlich öde Gegend zurückgelegt, die der
Lybischen Wüste gleicht, von deren Eindruck bekanntlich keiner einen
Begriff hat, als wer sie gesehn. Inzwischen empfehle ich zu dieser Reise
vor allem leichte Bagage; weil man sonst zu vieles unterwegs abwerfen muß.
Man sei daher stets des Ausspruchs Balthazar Gracians eingedenk: Lo bueno,
si breve, dos vezes bueno (das Gute, wenn kurz, ist doppelt gut), welcher
überhaupt den Deutschen ganz besonders zu empfehlen ist. —
Zu der kurzen Spanne Zeit, in der sie leben, verhalten sich die großen
Geister wie große Gebäude zu einem engen Platze, auf dem sie stehn. Man
sieht nämlich diese nicht in ihrer Größe, weil man zu nahe davor steht;
und aus der analogen Ursache wird man jene nicht gewahr; aber wann ein
Jahrhundert dazwischen liegt, werden sie erkannt und zurückgewünscht.
Ja, selbst der eigene Lebenslauf des vergänglichen Sohnes der Zeit, der
ein unvergängliches Werk hervorgebracht hat, zeigt zu diesem ein großes
Mißverhältnis, — analog dem der sterblichen Mutter, wie Semele, oder
Maja, die einen unsterblichen Gott geboren hat, oder dem entgegengesetzten
der Thetis zum Achill. Denn Vergängliches und Unvergängliches stehn in
zu großem Widerspruch. Seine kurze Spanne Zeit, sein bedürftiges, bedrängtes,
unstetes Leben wird selten erlauben, daß er auch nur den Anfang der glänzenden
Bahn seines unsterblichen Kindes sehe, oder irgend für das gelte, was er
ist. Sondern ein Mann von Nachruhm bleibt das Widerspiel eines Edelmannes,
als welcher ein Mann von Vorruhm ist.
Inzwischen läuft, für den Berühmten, der Unterschied zwischen dem Ruhme
bei der Mitwelt und dem bei der Nachwelt, am Ende bloß darauf hinaus, daß
beim ersteren seine Verehrer von ihm durch den Raum, beim andern durch die
Zeit getrennt sind. Denn unter den Augen hat er sie, auch beim Ruhm der
Mitwelt, in der Regel nicht. Die Verehrung verträgt nämlich nicht die Nähe;
sondern hält sich fast immer in der Ferne auf; weil sie, bei persönlicher
Gegenwart des Verehrten, wie Butter an der Sonne schmilzt. Demnach werden
selbst den schon bei der Mitwelt Berühmten neun Zehntel der in seiner Nähe
Lebenden bloß nach Maßgabe seines Standes und Vermögens ästimieren,
und allenfalls wird beim übrigen Zehntel, infolge einer aus der Ferne
gekommenen Kunde, ein dumpfes Bewußtsein seiner Vorzüge stattfinden.
Ueber diese Inkompatibilität der Verehrung mit der persönlichen
Anwesenheit und des Ruhmes mit dem Leben haben wir einen gar schönen
lateinischen Brief des Petrarca: in der mir vorliegenden venezianischen
Ausgabe, von 1492, seiner epistolae familiares ist es der zweite und an
den Thomas Messanensis gerichtet. Er sagt, unter anderm, daß sämtliche
Gelehrte seiner Zeit die Maxime hätten, alle Schriften geringzuschätzen,
deren Verfasser ihnen auch nur ein einziges Mal zu Gesichte gekommen wäre.
— Sind demnach die Hochberühmten, hinsichtlich der Anerkennung und
Verehrung, immer auf die Ferne gewiesen, so kann es ja so gut die
zeitliche, wie die räumliche sein. Freilich erhalten sie bisweilen aus
dieser, aber nie aus jener, Kunde davon: dafür jedoch ist das echte, große
Verdienst im stande, seinen Ruhm bei der Nachwelt zu anticipieren. Ja, wer
einen wirklich großen Gedanken erzeugt, wird, schon im Augenblicke der
Konzeption desselben, seines Zusammenhanges mit den kommenden
Geschlechtern inne; so daß er dabei die Ausdehnung seines Daseins durch
Jahrhunderte fühlt und auf diese Weise, wie für die Nachkommen, so auch
mit ihnen lebt. Wenn nun andererseits wir, von der Bewunderung eines großen
Geistes, dessen Werke uns eben beschäftigt haben, ergriffen, ihn zu uns
heranwünschen, ihn sehn, sprechen, und unter uns besitzen möchten; so
bleibt auch diese Sehnsucht nicht unerwidert: denn auch er hat sich
gesehnt nach einer anerkennenden Nachwelt, welche ihm die Ehre, Dank und
Liebe zollen würde, die eine neiderfüllte Mitwelt ihm verweigerte.
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
[...] Der Wille ist ewiges Streben. Es liegt in seiner
Natur, daß er niemals befriedigt werden kann. Denn erreicht er ein Ziel,
so muß er sofort zu einem neuen forteilen. Hörte er als Streben auf, so
wäre er nicht mehr Wille. Da das menschliche Leben seinem Wesen nach
Wille ist, so gibt es in demselben keine Befriedigung, sondern nur ewiges
Lechzen nach einer solchen. Die Entbehrung bereitet Schmerz. Dieser ist
also notwendig mit dem Leben verbunden. Alle Freude und alles Glück kann
nur auf Täuschung beruhen. Zufriedenheit ist nur durch Illusion möglich,
die durch Besinnen auf das wahre Wesen der Welt vernichtet wird. Die Welt
ist nichtig. Ein Weiser ist nur, wer das im vollen Umfange einsieht. Das
Anschauen der ewigen Ideen und deren Verkörperung in der Kunst kann für
Augenblicke über das Elend der Welt hinwegführen, denn der ästhetisch
Genießende versenkt sich in die ewigen Ideen, und weiß nichts von den
besonderen Leiden seines Individuums. Er verhält sich rein erkennend,
nicht wollend, also auch nicht leidend. Das Leiden tritt aber sofort
wieder ein, wenn er in das alltägliche Leben zurückgeworfen wird. Die
einzige Rettung aus dem Elend ist, gar nicht zu wollen, das Wollen in sich
zu ertöten. Das geschieht durch Unterdrückung aller Wünsche, durch
Askese. Der Weise wird alle Wünsche in sich auslöschen, seinen Willen
vollständig verneinen. Er kennt kein Motiv, das ihn zum Wollen nötigen könnte.
Sein Streben geht nur noch auf das Eine: Erlösung vom Leben. Das ist kein
Motiv mehr, sondern ein Quietiv. Jedes einzelne Wollen ist durch das
allgemeine Wollen bestimmt, daher unfrei; nur der Universalwille ist durch
nichts bestimmt, also frei. Nur die Verneinung des Willens ist eine That
der Freiheit, weil sie nicht durch einen einzelnen Willensakt, sondern
durch den Einen Willen selbst hervorgerufen werden kann. Alles einzelne
Wollen ist Wollen eines Motivs, daher Willensbejahung.
Durch den Selbstmord wird keine Verneinung des Willens herbeigeführt. Der
Selbstmörder vernichtet nur sein besonderes Individuum; nicht den Willen,
sondern nur eine Erscheinung des Willens. Die Askese aber vertilgt nicht
bloß das Individuum, sondern den Willen selbst innerhalb des Individuums.
Sie muß zuletzt zur völligen Erlöschung alles Seins, zur Erlösung von
allem Leiden führen. Verschwindet der Wille, so ist damit auch jede
Erscheinung vernichtet. Die Welt ist dann eingegangen in ewige Ruhe, in
das Nichts, in dem allein kein Leiden, somit Seligkeit ist.
Der Wille ist eine Einheit. Er ist in allen Wesen ein und derselbe. Der
Mensch ist nur als Erscheinung ein Individuum, dem Sein nach nur der
Ausdruck des allgemeinen Weltwillens. Der eine Mensch ist nicht in
Wahrheit von dem andern geschieden. Was dieser leidet, muß jener auch als
sein eigenes Leiden ansehen, er muß es mitleiden. Das Mitleid ist der
Ausdruck dafür, daß niemand ein besonderes Leiden hat, sondern jeder das
allgemeine Leid empfindet. Das Mitleid ist die Grundlage der Moral. Es
vernichtet den Egoismus, der nur darauf ausgeht, das eigene Leiden zu
mildern. Das Mitleid bewirkt eine Handlungsweise des Menschen, die auf
Beseitigung fremden Leidens geht. Nicht auf Grundsätze, die die Vernunft
sich gibt, baut sich die Moral auf, sondern auf das Mitleid, also auf ein
Gefühl. [...]
Arthur Schopenhauer 1788 – 1860
|
|